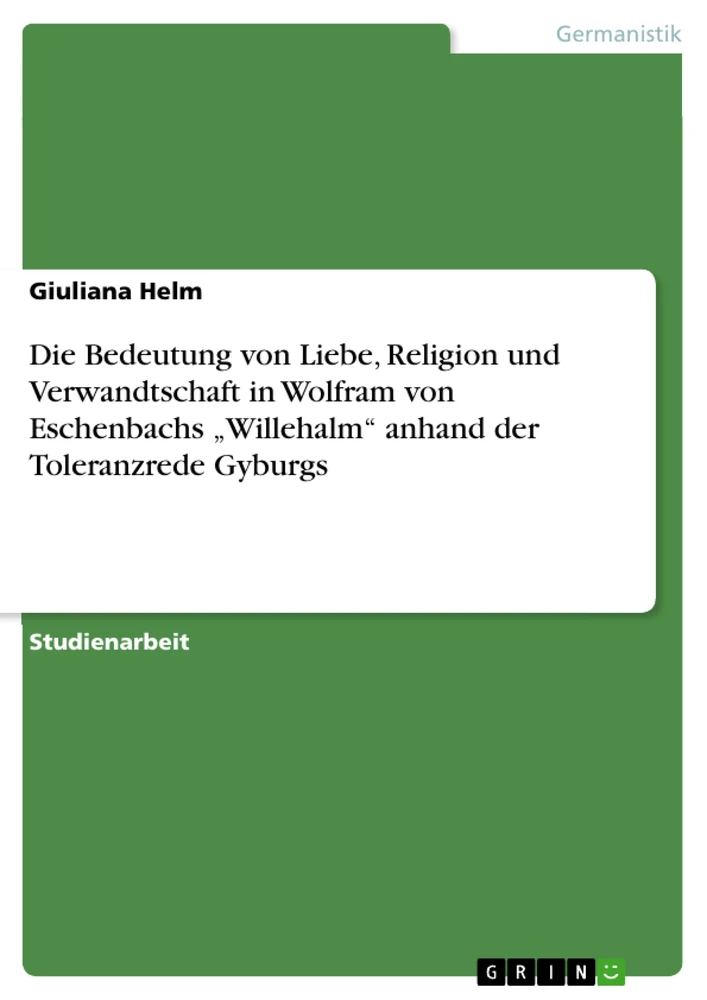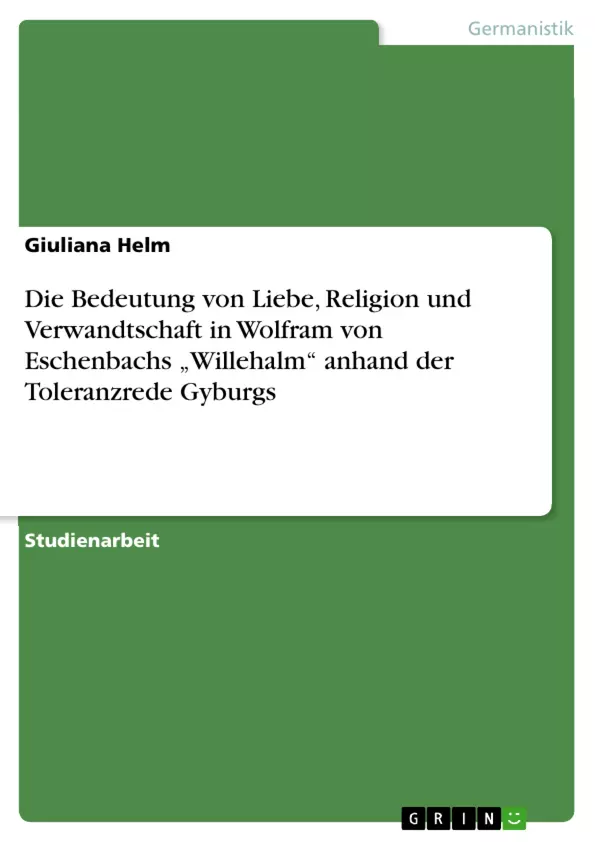Im Mittelalter wurden alle Nicht-Christen, also Andersgläubige, im Allgemeinen als Heiden bezeichnet. Die Verhaltens- und Denkweise der mittelalterlichen Bevölkerung wurde von einem alten Heidenbild beeinflusst, das auf einem Irrglauben beruhte. Den Heiden schrieb man Eigenschaften wie Unhöfischkeit, Eigentümlichkeit und Unkeuschheit zu. Der verbreitete Glaube, sie seien Kinder des Teufels, entfachte die grausamen Kreuzzüge der Christen gegenüber den Ungläubigen. Diese Thematik nahmen viele mittelalterliche Dichter auf, analysierten und interpretierten sie eingehend.
Wolfram von Eschenbach war einer dieser Dichter. In seinem Kreuzzugepos „Willehalm“ stellte er den Konflikt zwischen den muslimischen Sarazenen und den christlichen Franzosen in einer neuen Sichtweise dar und prägte damit die Weltanschauung seiner Zeit genossen nachhaltig.
In „Willehalm“ geht es aber nicht nur um die blutigen Schlachten zwischen Christen und Heiden, sondern auch um die Bedeutung von Liebe, Religion, Glaube und Verwandtschaft. So konvertiert die Heidin Gyburg aus Liebe zu Willehalm zum Christentum und löst damit einen grausamen Rachefeldzug ihrer heidnischen Familie gegen die Christen aus. Mit ihrer Toleranzrede, die sie vor der zweiten Schlacht auf Alischanz hielt, versucht sie, die schrecklichen Auswirkungen der Schlacht zu mildern und appelliert an die Grundfeste des christlichen Glaubens, an die Nächstenliebe und die Schonung der heidnischen Feinde.
In der vorliegenden Arbeit soll die Toleranzrede Gyburgs und ihre Bedeutung auf Liebe, Religion und Verwandtschaft hinsichtlich der Unterschiede zwischen Christen und Heiden näher untersucht werden. An verschiedenen Themen soll beispielhaft die Veränderung des Heidenbildes analysiert werden. Zudem soll veranschaulicht werden, wie Wolfram in „Willehalm“ einen Ansatz gegen die Kreuzzugideologie erschafft, sein tolerantes Verhalten gegenüber Andersgläubigen beschreibt und an die Grundpfeiler christlichen Glaubens erinnert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wahrnehmung von Christen und Heiden in der mittelalterlichen volkssprachigen Literatur und die Toleranz gegenüber den Fremden
- Der Konflikt zwischen Christen und Heiden, veranschaulicht an Hand Gyburgs Toleranzrede in Wolframs von Eschenbach „Willehalm“
- Die Bedeutung von Toleranz im „Willehalm“ - Wolframs positives Verhalten gegenüber den Heiden
- Gyburgs Ehebruch, ihre Konvertierung zum Christentum und der dadurch ausgelöste Doppelkrieg
- Die berühmte Toleranzrede Gyburgs
- Die Bedeutung von Liebe und Verwandtschaft in Gyburgs Toleranzrede
- Die Bedeutung von Taufe und Gotteskindschaft in Gyburgs Toleranzrede
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Toleranzrede Gyburgs in Wolframs von Eschenbachs Epos „Willehalm“. Sie untersucht die Bedeutung dieser Rede im Kontext des mittelalterlichen Konflikts zwischen Christen und Heiden, insbesondere die Aspekte von Liebe, Religion und Verwandtschaft. Dabei soll analysiert werden, wie Wolfram in seinem Werk ein differenzierteres Bild der Heiden zeichnet und einen Ansatz gegen die Kreuzzugideologie entwickelt.
- Das Heidenbild in der mittelalterlichen Literatur und die Entwicklung einer toleranteren Haltung gegenüber den Fremden
- Die Darstellung des Konflikts zwischen Christen und Heiden in Wolframs „Willehalm“
- Die Bedeutung von Liebe, Religion und Verwandtschaft in Gyburgs Toleranzrede
- Wolframs Ansatz gegen die Kreuzzugideologie und seine positive Sichtweise auf die Heiden
- Die Veränderung des Heidenbildes im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt den Konflikt zwischen Christen und Heiden im Mittelalter sowie Wolframs „Willehalm“ als wichtige Quelle für die Untersuchung dieses Themas vor. Sie betont die Bedeutung von Liebe, Religion und Verwandtschaft in der Toleranzrede Gyburgs.
Kapitel 2 beleuchtet die allgemeine Wahrnehmung von Christen und Heiden in der mittelalterlichen volkssprachigen Literatur. Es wird deutlich, dass die Heiden im Allgemeinen als „Götzendiener“ und „Verdammte“ angesehen wurden. Das Kapitel zeigt auch auf, dass sich im Laufe der Zeit durch kulturellen Austausch und das Ritterideal eine wohlwollendere Sichtweise auf die Heiden entwickelte.
Kapitel 3 untersucht den Konflikt zwischen Christen und Heiden im „Willehalm“ im Detail, mit Fokus auf Gyburgs Toleranzrede. Es wird gezeigt, wie Wolfram in seinem Werk ein differenzierteres Bild der Heiden zeichnet als seine Zeitgenossen, wobei er deren religiösen Bindungen und Sitten respektiert. Der Abschnitt beleuchtet auch die Bedeutung von Liebe, Taufe und Gotteskindschaft in Gyburgs Rede.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen: Toleranzrede, Gyburg, Wolfram von Eschenbach, Willehalm, Christen, Heiden, Mittelalter, Liebe, Religion, Verwandtschaft, Kreuzzüge, Heidenbild, Toleranz, Kreuzzugideologie, Differenzierung, höfisches Ritterideal, Gotteskindschaft, Taufe, Verdammnis, Erlösung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Gyburgs Toleranzrede?
Gyburg appelliert an die christlichen Ritter, auch gegenüber den heidnischer Feinden Mitleid und Schonung walten zu lassen, da diese ebenfalls Geschöpfe Gottes sind.
Wie stellte das Mittelalter 'Heiden' üblicherweise dar?
Heiden wurden oft als unhöfisch, unkeusch und "Kinder des Teufels" diffamiert, was zur Rechtfertigung der grausamen Kreuzzüge diente.
Warum konvertierte Gyburg zum Christentum?
Gyburg konvertierte aus Liebe zu Willehalm, was jedoch einen blutigen Rachefeldzug ihrer ursprünglichen heidnischen Familie gegen die Christen auslöste.
Was ist das Besondere an Wolframs Heidenbild?
Wolfram von Eschenbach zeichnet ein differenziertes Bild, indem er die religiösen Sitten der Heiden respektiert und sie als ritterlich und gottgewollt darstellt, statt sie nur zu verteufeln.
Welche Rolle spielt die Verwandtschaft in der Erzählung?
Die Verwandtschaft ist ein zentrales Motiv, da der Krieg ein Kampf zwischen Familienmitgliedern ist. Gyburg betont, dass Christen und Heiden durch Gott miteinander verwandt sind.
- Quote paper
- Giuliana Helm (Author), 2013, Die Bedeutung von Liebe, Religion und Verwandtschaft in Wolfram von Eschenbachs „Willehalm“ anhand der Toleranzrede Gyburgs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304105