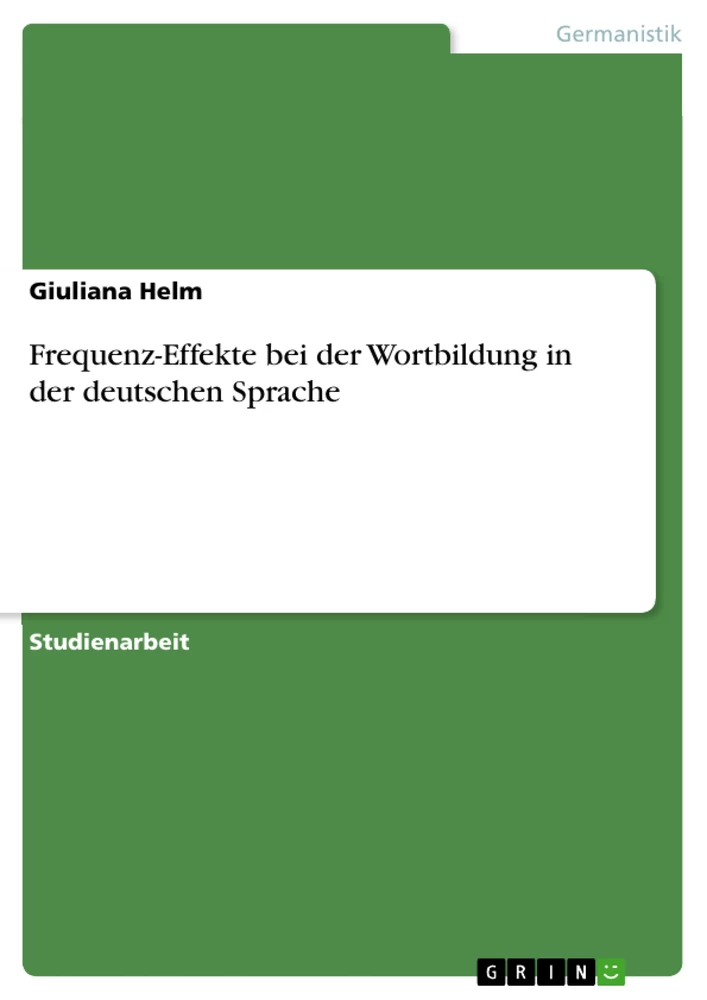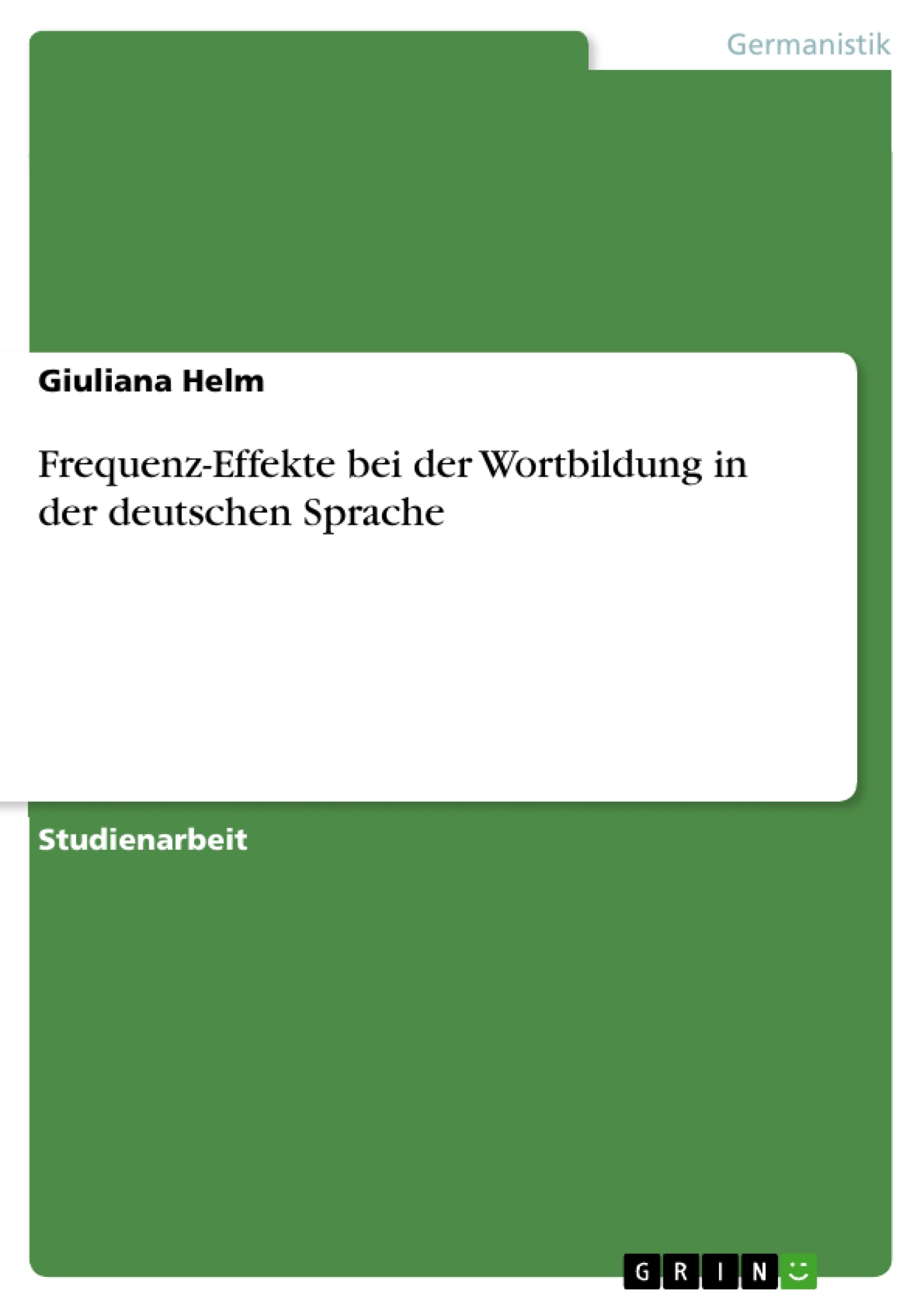Wie legen Sprachwissenschaftler Gesetzmäßigkeiten der deutschen Sprache fest? Woran können Sprachstrukturen bestimmt werden? Welcher Wortschatz wird am häufigsten benutzt oder ab welcher Benutzungshäufigkeit wird ein Wort in den Duden aufgenommen? Für diese und noch viel mehr Fragen, spielt Worthäufigkeit eine wichtige Rolle.
Linguisten können nicht nur anhand von Häufigkeitsverteilungen, Aufschluss über Verwendung und Strukturen in der Sprache geben, sondern auch beim Spracherwerb feststellen, welcher Wortschatz am Häufigsten verwendet wird. Sie geben somit Auskunft darüber, welcher Wortschatz zuerst erlernt werden soll oder welche Wörter nun in den Duden aufgenommen werden. Mit Worthäufigkeit können Aussagen über die Wortschatzvielfalt und dessen Wachstum in allen Sprachen und in jedem beliebigen Text getroffen werden.
Hierbei wird die Anzahl der Wörter, die sehr häufig vorkommen, mit der Anzahl der seltenen Wörter verglichen.
Nicht nur im Deutschen, sondern auch in jeder anderen Sprache gibt es bestimmte Wortkonstruktionen, die häufiger verwendet werden als andere. Dieses Phänomen nennt sich demnach Frequenz und ist eine äußerst wichtige Quelle zur Erklärung von Sprache. Fachterminologisch ausgedrückt, ist Frequenz somit die Vorkommenshäufigkeit, mit der ein bestimmtes Phänomen inmitten einer sprachlichen Struktur auftritt.
Frequenz besitzt des Weiteren die Eigenschaft, die Struktur einer Sprache so zu beeinflussen, dass sogenannte Frequenz-Effekte entstehen. Da diese Effekte bisher hauptsächlich in der englischen Sprachforschung untersucht wurden und somit in der deutschen sprachwissenschaftlichen Literatur kaum deutsche Beispiele auffindbar sind, geht es in der Ausarbeitung dieser Seminararbeit vor allem um Frequenz-Effekte, die in der deutschen Sprache vorkommen und zusätzlich einen starken Einfluss auf die Morphologie haben.
Inhaltsverzeichnis
- Frequenz-Effekte in der Sprache
- Frequenz-Effekte im Deutschen
- Ausblick auf verschiedene Varianten von Frequenz-Effekten
- Asymmetrien bei der Flexion
- Häufige und seltene Kategorien
- Die Wechselbeziehung zwischen Häufigkeit, Kürze und Differenzierung
- Lokale Frequenzumkehrungen
- Frequenz und Abweichungen
- Token Frequency: Frequenz und Hemmungen bei der Derivation
- Der Einfluss von Frequenz-Effekten auf die deutsche Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Frequenz-Effekte in der deutschen Sprache, insbesondere deren Einfluss auf die Morphologie. Da die Forschung auf diesem Gebiet bisher hauptsächlich im Englischen angesiedelt ist, liegt der Fokus auf der Identifizierung und Analyse deutscher Beispiele. Die Arbeit differenziert zwischen Token Frequency und Type Frequency und beleuchtet verschiedene Arten von Frequenz-Effekten, untermauert durch eindrückliche Beispiele.
- Untersuchung von Frequenz-Effekten in der deutschen Morphologie
- Differenzierung zwischen Token Frequency und Type Frequency
- Analyse verschiedener Arten von Frequenz-Effekten im Deutschen
- Beispielhafte Veranschaulichung der Effekte
- Vergleich mit englischen Forschungsergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Frequenz-Effekte in der Sprache: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Worthäufigkeit in der Sprachwissenschaft ein. Es wird die Bedeutung der Worthäufigkeit für die Analyse von Sprachstrukturen, Spracherwerb und die Erstellung von Wörterbüchern erläutert. Der Begriff Frequenz als Vorkommenshäufigkeit eines sprachlichen Phänomens wird definiert, und die Entstehung von Frequenz-Effekten durch die Einflussnahme der Häufigkeit auf die Sprachstruktur wird beschrieben. Die Arbeit fokussiert sich auf Frequenz-Effekte im Deutschen und deren morphologischen Auswirkungen. Die Unterscheidung zwischen Token Frequency (Vorkommenshäufigkeit) und Type Frequency (Anzahl der Lexeme mit bestimmten Eigenschaften) wird als Grundlage für die weitere Analyse gelegt.
Frequenz-Effekte im Deutschen: Dieses Kapitel befasst sich mit Frequenz-Effekten in der Wortbildung, speziell in der Flexion und Derivation. Es wird zwischen Type Frequency und Token Frequency unterschieden und erklärt, wie diese verschieden in Flexion und Derivation auftreten. Token Frequency beeinflusst die Sprachstruktur, indem häufig vorkommende Lexeme in bestimmten Kontexten vorhersehbarer und leichter merkbar sind. Phonetische Veränderungen in hochfrequenten Lexemen schreiten schneller voran, was an Beispielen wie Abkürzungen im Englischen illustriert wird. Gleichzeitig können hochfrequente Formen der Analogiebildung widerstehen, was einen gegenläufigen Effekt darstellt.
Token Frequency: Frequenz und Hemmungen bei der Derivation: [This section would require further information from the original text to provide a 75+ word summary. The provided text only gives a brief introduction to this topic].
Der Einfluss von Frequenz-Effekten auf die deutsche Sprache: [This section, like the previous one, needs more information from the original text to create a substantial summary. The provided text excerpt does not offer sufficient detail about this chapter's content.]
Schlüsselwörter
Frequenz-Effekte, Token Frequency, Type Frequency, Morphologie, Flexion, Derivation, Wortbildung, deutsche Sprache, Häufigkeit, Sprachstruktur, Spracherwerb.
Häufig gestellte Fragen zu: Frequenz-Effekte in der deutschen Sprache
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht Frequenz-Effekte in der deutschen Sprache, insbesondere ihren Einfluss auf die Morphologie. Sie konzentriert sich auf die Identifizierung und Analyse deutscher Beispiele, da die Forschung auf diesem Gebiet bisher hauptsächlich im Englischen angesiedelt ist. Die Arbeit differenziert zwischen Token Frequency und Type Frequency und beleuchtet verschiedene Arten von Frequenz-Effekten mit anschaulichen Beispielen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Untersuchung von Frequenz-Effekten in der deutschen Morphologie, Differenzierung zwischen Token Frequency und Type Frequency, Analyse verschiedener Arten von Frequenz-Effekten im Deutschen, beispielhafte Veranschaulichung der Effekte und Vergleich mit englischen Forschungsergebnissen. Die Kapitel befassen sich mit allgemeinen Frequenz-Effekten in der Sprache, detailliert mit Frequenz-Effekten im Deutschen (insbesondere Flexion und Derivation), sowie dem Einfluss der Token Frequency auf die Derivation und dem Gesamt-Einfluss von Frequenz-Effekten auf die deutsche Sprache.
Was ist der Unterschied zwischen Token Frequency und Type Frequency?
Die Arbeit unterscheidet klar zwischen Token Frequency (Vorkommenshäufigkeit eines Wortes) und Type Frequency (Anzahl der Lexeme mit bestimmten Eigenschaften). Diese Unterscheidung ist grundlegend für die Analyse der Frequenz-Effekte in Flexion und Derivation.
Wie beeinflussen Frequenz-Effekte die deutsche Morphologie?
Die Arbeit untersucht, wie die Häufigkeit des Auftretens von Wörtern und Wortformen die Morphologie der deutschen Sprache beeinflusst. Häufige Lexeme zeigen in bestimmten Kontexten eine höhere Vorhersagbarkeit und Merkbarkeit. Phonetische Veränderungen schreiten in hochfrequenten Lexemen schneller voran, während hochfrequente Formen der Analogiebildung wiederstehen können. Die genauen Auswirkungen werden in den Kapiteln zur Flexion und Derivation detailliert behandelt.
Welche konkreten Beispiele für Frequenz-Effekte werden genannt?
Die bereitgestellte Zusammenfassung nennt zwar keine konkreten Beispiele, verspricht aber die Veranschaulichung der Effekte anhand eindrücklicher Beispiele im Haupttext der Seminararbeit. Die Beispiele würden sich wahrscheinlich auf Veränderungen in der Flexion und Derivation aufgrund von Wortfrequenz beziehen.
Wie wird die Arbeit mit englischen Forschungsergebnissen verglichen?
Die Arbeit vergleicht die gefundenen Frequenz-Effekte im Deutschen mit bereits bestehenden Forschungsergebnissen aus dem Englischen. Dies dient dazu, sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufzuzeigen und die spezifischen Eigenschaften der deutschen Sprache in Bezug auf Frequenz-Effekte hervorzuheben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Frequenz-Effekte, Token Frequency, Type Frequency, Morphologie, Flexion, Derivation, Wortbildung, deutsche Sprache, Häufigkeit, Sprachstruktur, Spracherwerb.
- Citation du texte
- Giuliana Helm (Auteur), 2013, Frequenz-Effekte bei der Wortbildung in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304106