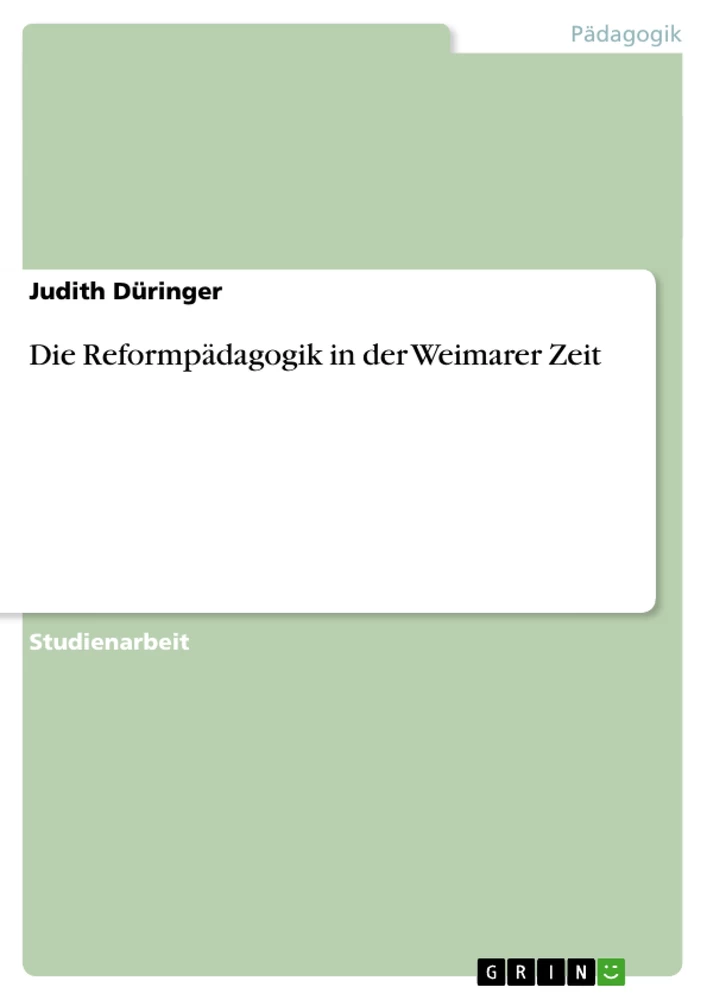1. Kennzeichen der Weimarer Zeit
1.1. Politische Merkmale der Epoche
1.2. Soziale und ökonomische Merkmale der Epoche
1.3. Geistesgeschichtlich – kulturelle Merkmale der Epoche
2. Die Rolle von Kindern und Jugendlichen in sozialen Formationen von Familie
3. Bildungs- und Erziehungsinstitutionen
3.1. Schule
3.2. Kindergarten
3.3. Konfessionelle Erziehung
4. Pädagogische Grundideen der Epoche
4.1. Reformpädagogische Bewegungen
4.1.1 Die Kunsterziehungsbewegung
4.1.2 Die Arbeitsschulbewegung
4.1.3 Die Landerziehungsheimbewegung
4.1.4 Die Jugendbewegung
5. Maria Montessori
5.1. Biographie
5.2. Grundideen der Montessori Pädagogik
1. Kennzeichen der Weimarer Zeit
1.1. Politische Merkmale der Epoche
Die politische Situation der Weimarer Zeit ist in Deutschland wesentlich geprägt durch das Bemühen, nach Ende der Monarchie und verlorenem Weltkrieg einen demokratischen und parlamentarischen Neuanfang zu finden. Allein die Tatsache, dass das Parlament nach Weimar ausweichen muss, um den politischen Unruhen und Wirrnissen in Berlin zu entgehen, macht die Gefährdung des neuen politischen Systems deutlich. Zwischen links- und rechtsextremen Strömungen versucht eine Vielzahl von Parteien und Gruppen, politisch Einfluss zu nehmen und an der Macht teilzuhaben.
In der Arbeiterschicht findet eine starke Identifizierung mit dem politischen System der Republik statt. Obwohl lediglich durch die Wahlen Einfluss auf die politischen Entwicklungen genommen werden kann, drückt sich eine positive „Staatsgesinnung“ in der politisch organisierten Arbeiterschaft aus. Durch die in der Verfassung repräsentierten Freiheitsrechte werden Chancen gesehen, „von der formalen zur sozialen Demokratie fortzuschreiten“ .
Inhaltsverzeichnis
- Kennzeichen der Weimarer Zeit
- Politische Merkmale der Epoche
- Soziale und ökonomische Merkmale der Epoche
- Geistesgeschichtlich – kulturelle Merkmale der Epoche
- Die Rolle von Kindern und Jugendlichen in sozialen Formationen von Familie
- Bildungs- und Erziehungsinstitutionen
- Schule
- Kindergarten
- Konfessionelle Erziehung
- Pädagogische Grundideen der Epoche
- Reformpädagogische Bewegungen
- Die Kunsterziehungsbewegung
- Die Arbeitsschulbewegung
- Die Landerziehungsheimbewegung
- Die Jugendbewegung
- Reformpädagogische Bewegungen
- Maria Montessori
- Biographie
- Grundideen der Montessori Pädagogik
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Vorlesung „Einführung in die Allgemeine Erziehungswissenschaft“ im Wintersemester 2001/2002 befasst sich mit der Reformpädagogik in der Weimarer Zeit. Die Vorlesung beleuchtet die politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Gegebenheiten der Weimarer Republik und deren Einfluss auf die Rolle von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft. Darüber hinaus werden wichtige Reformpädagogische Bewegungen und deren Kernideen vorgestellt.
- Die politischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Weimarer Zeit
- Die Rolle von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft
- Die wichtigsten Reformpädagogischen Bewegungen
- Die Kernideen der Reformpädagogik in der Weimarer Zeit
- Die Bedeutung von Familie und Schule für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Vorlesung behandelt die Kennzeichen der Weimarer Zeit. Es werden die politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Merkmale der Epoche beleuchtet. Die politischen Merkmale sind durch das Bemühen geprägt, nach Ende der Monarchie und verlorenem Weltkrieg einen demokratischen und parlamentarischen Neuanfang zu finden. Die sozialen und ökonomischen Merkmale werden durch die Folgen der hohen Reparationszahlungen und die hohe Inflation geprägt. Die kulturelle Situation der Weimarer Zeit zeichnet sich durch einen Aufbruch aus der geistigen Enge und gesellschaftlichen Beschränkung der wilhelminischen Zeit aus.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Rolle von Kindern und Jugendlichen in sozialen Formationen von Familie. Die Familie und das unmittelbare Wohngebiet stellen das primäre Sozialisationsfeld dar, während die Schule zum sekundären Sozialisationsfeld gehört. Die ökonomische Lage der Arbeiterfamilien nach 1918 ist durch Enge, Hunger, Sorgen und Existenznot gekennzeichnet. Die Kinder stehen in der Rangordnung der Familie ganz unten und müssen bereits in jungen Jahren durch hartes und langes Arbeiten zum Lebensunterhalt beitragen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Vorlesung sind: Reformpädagogik, Weimarer Zeit, Kinder, Jugendliche, Familie, Schule, Sozialisation, politische Merkmale, soziale Merkmale, ökonomische Merkmale, kulturelle Merkmale, Arbeiterfamilie, Kunsterziehungsbewegung, Arbeitsschulbewegung, Landerziehungsheimbewegung, Jugendbewegung, Montessori-Pädagogik.
- Arbeit zitieren
- Judith Düringer (Autor:in), 2002, Die Reformpädagogik in der Weimarer Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30411