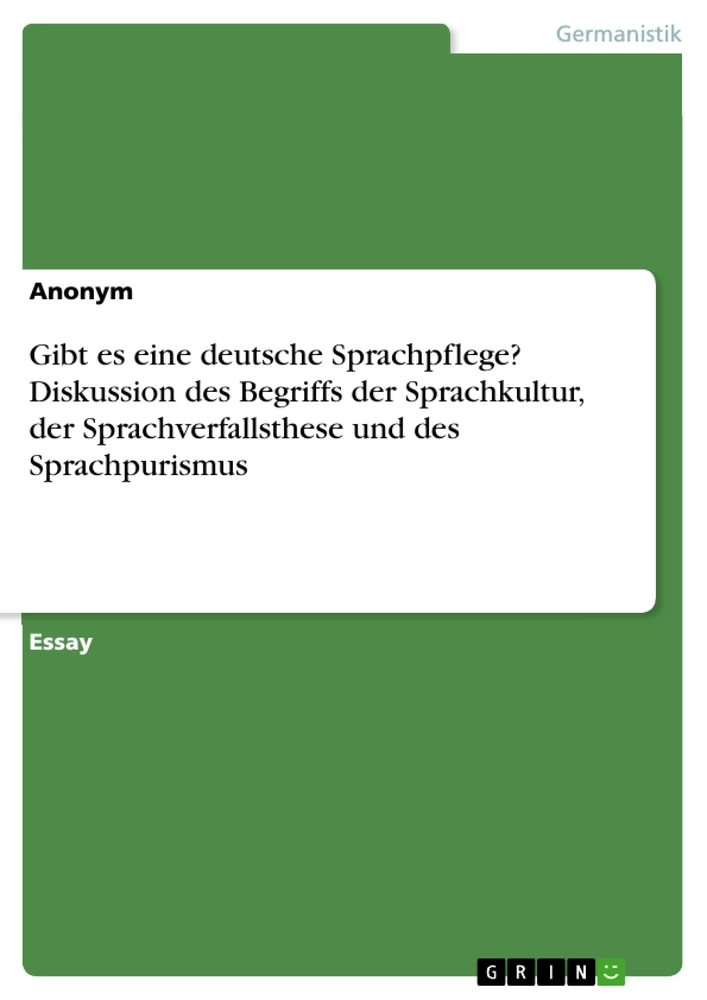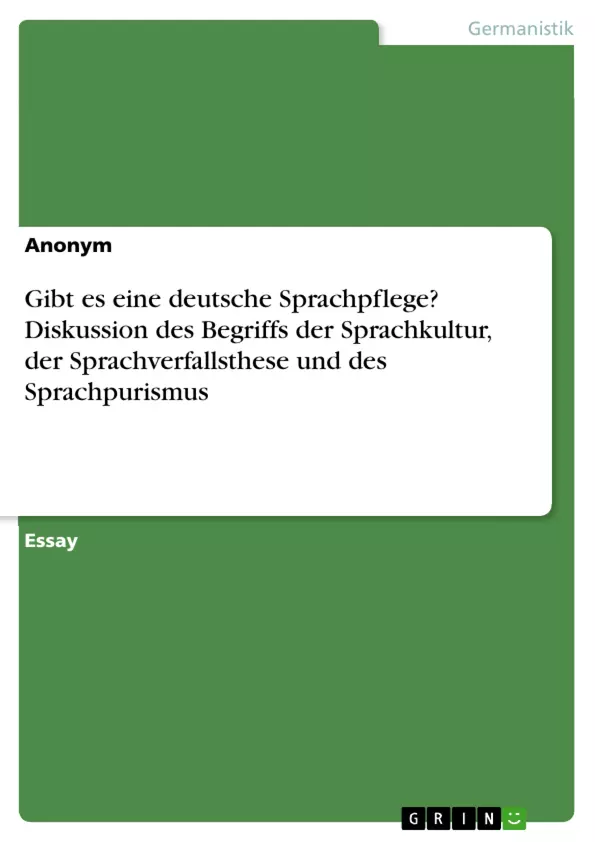Sprechen wir alle bald „Denglisch“? Wird es die deutsche Sprache irgendwann nicht mehr geben? Auf diese und ähnliche Fragestellungen stößt man zuerst, wenn man beginnt sich mit dem Thema der Sprachpflege auseinanderzusetzen. Mit diesen und anderen Fragen möchte ich mich in dieser Arbeit beschäftigen. Des Weiteren möchte ich auf die Begriffe Sprachkultur und Sprachpurismus eingehen. Zu Beginn werde ich versuchen, eine Erklärung zum Begriff der Sprachpflege und dessen Geschichte zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Gibt es eine deutsche Sprachpflege und wenn ja, welche Ziele verfolgt sie?
- Sprachpflege: Begriffserklärung und Geschichte
- Sprachkritik und Sprachwandel
- Sprachpurismus und Sprachreinigung
- Sprachkultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der deutschen Sprachpflege, ihre Ziele und die damit verbundenen Kontroversen. Sie beleuchtet die Geschichte der Sprachpflege in Deutschland, analysiert den Sprachwandel und die Debatte um den sogenannten „Sprachverfall“, und untersucht die Konzepte des Sprachpurismus und der Sprachkultur.
- Die Geschichte der deutschen Sprachpflege und ihrer Institutionen
- Die Debatte um Sprachverfall und die Rolle der Medien
- Der Einfluss des Englischen (und früher des Französischen) auf die deutsche Sprache
- Das Konzept des Sprachpurismus und seine Auswirkungen
- Der Begriff der Sprachkultur und seine Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
Gibt es eine deutsche Sprachpflege und wenn ja, welche Ziele verfolgt sie?: Der einleitende Abschnitt stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Bestehen und den Zielen deutscher Sprachpflege. Er führt in die Debatten um „Denglisch“, Sprachverfall und die Notwendigkeit von Sprachregelungen ein und kündigt die Auseinandersetzung mit den Begriffen Sprachkultur und Sprachpurismus an. Die Einleitung dient als Brücke zu den folgenden Kapiteln, in denen diese Aspekte detailliert beleuchtet werden.
Sprachpflege: Begriffserklärung und Geschichte: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Sprachpflege“ als bewusste Einflussnahme auf die Sprachentwicklung mit dem Ziel, den Sprachgebrauch zu verbessern und die sprachliche Kompetenz zu steigern. Es skizziert die Geschichte der Sprachpflege in Deutschland, beginnend mit den Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts wie der „Fruchtbringenden Gesellschaft“ und dem „Pegnitzschen Blumenorden“, bis hin zur heutigen „Gesellschaft für deutsche Sprache“ (GfdS) und deren Aktivitäten, darunter die Wahl des „Unwort des Jahres“. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Ziele und Methoden der Sprachpflege über die Jahrhunderte.
Sprachkritik und Sprachwandel: Dieses Kapitel beleuchtet die wissenschaftliche Sprachkritik als Grundlage der Sprachpflege und ihren ambivalenten Charakter: Sprachkritik beschreibt und bewertet gleichzeitig den Sprachgebrauch. Es thematisiert den permanenten Sprachwandel und die damit verbundene Wahrnehmung von „Sprachverfall“, insbesondere im Kontext von SMS und E-Mails. Die Arbeit diskutiert unterschiedliche Positionen, von Befürchtungen über einen Sprachzerfall bis hin zu der Perspektive, dass Sprachwandel ein natürlicher Prozess ist, der sich an die aktuellen Kommunikationsbedürfnisse anpasst. Umfragen zur Einstellung der Bevölkerung zum Thema Sprachverfall werden analysiert.
Sprachpurismus und Sprachreinigung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Sprachpurismus, dem Bestreben, die Sprache von fremdsprachlichen Einflüssen zu „reinigen“. Es beleuchtet die Geschichte des Sprachpurismus, insbesondere die Bemühungen der „Fruchtbringenden Gesellschaft“, fremdsprachliche Begriffe durch deutsche Entsprechungen zu ersetzen. Der Text vergleicht dies mit der aktuellen Situation, in der Anglizismen eine zentrale Rolle spielen. Es werden Gegenpositionen, wie die des Direktors des Instituts für Deutsche Sprache, präsentiert, die den Sprachwandel als natürlichen Prozess betonen und die Funktionalität von Anglizismen in der modernen Kommunikation hervorheben.
Sprachkultur: Dieses Kapitel beschreibt den Begriff der Sprachkultur, abgeleitet aus der russischen und tschechischen Sprachwissenschaft, als Bestreben zur Verbesserung des Sprachgebrauchs auf linguistischer Ebene. Es erörtert die Frage, ob eine gezielte Sprachlenkung überhaupt notwendig und sinnvoll ist, da Sprache sich stets mit der Kultur verändert. Die Offenheit gegenüber fremden Einflüssen wird betont, da diese seit jeher Teil der Sprachentwicklung waren. Das stetige Wachstum des deutschen Wortschatzes wird als Gegenargument zum Sprachverfall genannt.
Schlüsselwörter
Sprachpflege, Sprachwandel, Sprachverfall, Sprachpurismus, Sprachkultur, Denglisch, Anglizismen, Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Sprachkritik, wissenschaftliche Sprachbeschreibung, Kommunikationsbedürfnisse, Rechtschreibreform, Mundarten.
FAQ: Deutsche Sprachpflege - Eine umfassende Übersicht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Begriff der deutschen Sprachpflege, ihre Ziele und die damit verbundenen Kontroversen. Sie beleuchtet die Geschichte der Sprachpflege in Deutschland, analysiert den Sprachwandel und die Debatte um den sogenannten „Sprachverfall“, und untersucht die Konzepte des Sprachpurismus und der Sprachkultur.
Gibt es eine deutsche Sprachpflege und wenn ja, welche Ziele verfolgt sie?
Ja, es gibt eine deutsche Sprachpflege. Ihre Ziele sind die Verbesserung des Sprachgebrauchs und die Steigerung der sprachlichen Kompetenz. Die Debatten um "Denglisch", Sprachverfall und die Notwendigkeit von Sprachregelungen stehen dabei im Mittelpunkt.
Was wird unter "Sprachpflege" verstanden und wie hat sich ihr Verständnis im Laufe der Geschichte entwickelt?
Sprachpflege wird als bewusste Einflussnahme auf die Sprachentwicklung definiert, mit dem Ziel, den Sprachgebrauch zu verbessern und die sprachliche Kompetenz zu steigern. Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der Sprachpflege von den Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts (Fruchtbringende Gesellschaft, Pegnitzscher Blumenorden) bis zur heutigen Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) und ihren Aktivitäten (z.B. "Unwort des Jahres").
Wie wird der Sprachwandel und die Kritik am Sprachwandel in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den permanenten Sprachwandel und die damit verbundene Wahrnehmung von „Sprachverfall“, insbesondere im Kontext von SMS und E-Mails. Sie diskutiert unterschiedliche Positionen: von Befürchtungen über einen Sprachzerfall bis hin zur Betrachtung des Sprachwandels als natürlichen Prozess, der sich an aktuelle Kommunikationsbedürfnisse anpasst. Umfragen zur öffentlichen Meinung werden ebenfalls analysiert.
Was ist Sprachpurismus und wie wird er in der Arbeit dargestellt?
Sprachpurismus wird als das Bestreben definiert, die Sprache von fremdsprachlichen Einflüssen zu „reinigen“. Die Arbeit betrachtet die Geschichte des Sprachpurismus, insbesondere die Bemühungen der „Fruchtbringenden Gesellschaft“, fremdsprachliche Begriffe durch deutsche Entsprechungen zu ersetzen. Sie vergleicht dies mit der aktuellen Situation, in der Anglizismen eine zentrale Rolle spielen und präsentiert Gegenpositionen, die den Sprachwandel als natürlichen Prozess betonen.
Was ist Sprachkultur und welche Rolle spielt sie in der Arbeit?
Sprachkultur wird als Bestreben zur Verbesserung des Sprachgebrauchs auf linguistischer Ebene beschrieben. Die Arbeit erörtert, ob eine gezielte Sprachlenkung notwendig und sinnvoll ist, und betont die Offenheit gegenüber fremden Einflüssen als integralen Bestandteil der Sprachentwicklung. Das Wachstum des deutschen Wortschatzes wird als Gegenargument zum Sprachverfall genannt.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Sprachpflege, Sprachwandel, Sprachverfall, Sprachpurismus, Sprachkultur, Denglisch, Anglizismen, Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Sprachkritik, wissenschaftliche Sprachbeschreibung, Kommunikationsbedürfnisse, Rechtschreibreform, Mundarten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Gibt es eine deutsche Sprachpflege? Diskussion des Begriffs der Sprachkultur, der Sprachverfallsthese und des Sprachpurismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304177