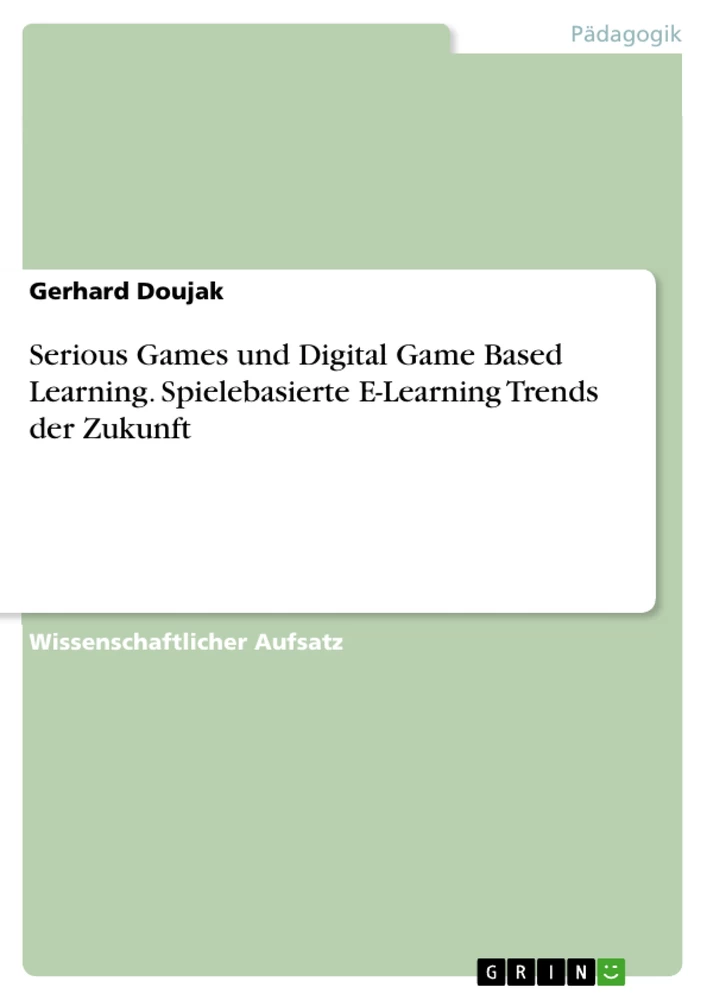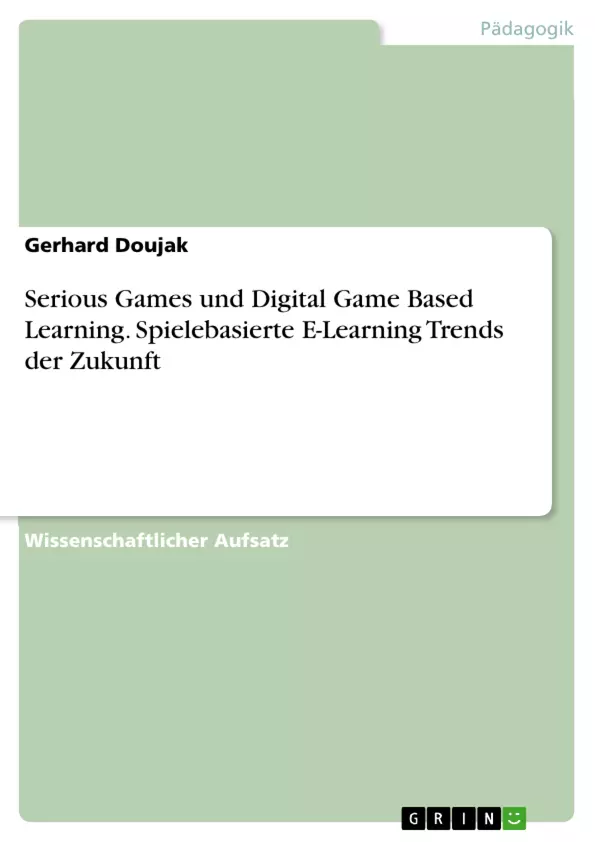Serious Games und Digital Game-Based Learning gehören zu den wichtigen E-Learning-Trends der Zukunft.
Serious Games und Digital Game-Based Learning meint digitale computerbasierte Anwendungen, die Spielen und Lernen miteinander verbinden und damit ernsthafte Lerninhalte und Themen auf unterhaltsame Art und Weise vermitteln und transportieren sollen und wollen.
Den Transfer typischer computerbasierter Spielelemente und -mechanismen auf spielfremde Kontexte und Bereiche, bezeichnet man hierbei als Gamification.
Insbesondere vor dem Hintergrund des voranschreitenden demografischen Wandels und des damit verbundenen Fachkräftemangels gewinnen Serious Games und das Game-Based Learning, als innovatives zeit- und zielgruppenspezifisches Tool, insbesondere für die Rekrutierung und betriebliche Aus- und Weiterbildung des Fach- und Führungskräftenachwuchses, bei Unternehmens- und Personalmanagement, zunehmend an Akzeptanz und Bedeutung.
Doch was genau verbirgt sich hinter den Begriffen „Serious Games“ und „Gamification“?
Welchen Nutzen und Einsatzpotentiale bieten Serious Games und Lernspiele, insbesondere mit Blick auf das Leadership und Human Resources Management?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Aufbau
- Definitionen und Begriffserklärungen
- „Game“ bzw. „Spiel“
- E-Learning
- Serious Games
- (Digital) Game Based Learning
- Zunehmende Akzeptanz für Serious Games
- Der demografische Wandel
- Gamification
- Computer- und Videogames sind zum Massenphänomen geworden
- Zukunftstrend Serious Games
- Serious Game Trends und Treiber
- Trend 1: Digital Game-Based Learning wird internationaler
- Trend 2: „Recrutainment“ als Instrumentarium der Mitarbeitergewinnung
- Trend 3: Der Begriff „Game-Based-Learning“ wird überstrapaziert
- Trend 4: Serious Games sind insbesondere auch Marketing-Tools
- Trend 5: Mit Serious Games neue Zielgruppen erreichen
- Trend 6: Serious Games zum Selbst-Erstellen
- Trend 7: Game Based Learning als Teil des „Gamification“-Trends
- Einsatzbereiche von Serious Games und Gamification
- Vorteile und Wirkung digitaler Spiele aus didaktischer Sicht
- Vorteile digitaler Lernspiele
- Immersion
- Model zum Lernen mit digitalen Spielen
- Ausgewählte Serious Game und Gamification Beispiele
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über Trends, Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten von Serious Games (SG) und Digital Game-Based Learning (DGBL) zu geben. Zusätzlich werden die Wirkungsweisen und Vorteile digitaler Lernspiele skizziert. Abschließend erfolgt eine Bewertung und Handlungsempfehlung für Unternehmen und Organisationen, insbesondere für die Unternehmensführung und das HR-Management.
- Trends und Entwicklungen im Bereich Serious Games und DGBL
- Vorteile und didaktische Wirkungsweisen digitaler Lernspiele
- Einsatzmöglichkeiten von Serious Games und DGBL in Unternehmen
- Der Einfluss des demografischen Wandels auf die Akzeptanz von Serious Games
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Serious Games, DGBL und Gamification
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik von Serious Games und Digital Game-Based Learning (DGBL) als wichtige E-Learning-Trends der Zukunft ein. Sie hebt die Verbindung von Spielen und Lernen zur Vermittlung ernsthafter Lerninhalte hervor und betont die zunehmende Bedeutung dieser Methoden im Kontext des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels. Die Einleitung stellt die zentralen Fragen nach der Bedeutung von Serious Games und Gamification sowie deren Nutzen und Einsatzpotentialen im Leadership und Human Resources Management.
Definitionen und Begriffserklärungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Spiel“, E-Learning, Serious Games, DGBL und Gamification. Es legt die Grundsteine für das Verständnis der weiteren Ausführungen, indem es die jeweiligen Konzepte präzise definiert und voneinander abgrenzt. Die Definitionen bilden die Basis für die Analyse der Trends und Einsatzmöglichkeiten in den folgenden Kapiteln.
Zunehmende Akzeptanz für Serious Games: Dieses Kapitel beleuchtet die soziokulturellen Einflussfaktoren, die zur wachsenden Akzeptanz von digitalen Lernspielen bei Unternehmens- und Personalentscheidern beigetragen haben. Es behandelt den demografischen Wandel, die zunehmende Verbreitung von Computer- und Videospielen und den Trend der Gamification als wichtige Faktoren für die steigende Bedeutung von Serious Games.
Serious Game Trends und Treiber: Dieses Kapitel präsentiert aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Serious Games und Game-Based Learning. Es analysiert verschiedene Trends, wie die Internationalisierung von DGBL, die Nutzung von „Recrutainment“ in der Mitarbeitergewinnung, die Überstrapazierung des Begriffs „Game-Based-Learning“, den Einsatz als Marketing-Tool, die Erschließung neuer Zielgruppen, die Möglichkeit des Selbst-Erstellens von Serious Games und DGBL als Teil des Gamification-Trends. Jeder Trend wird im Detail untersucht und seine Bedeutung für die Zukunft des Feldes beleuchtet.
Einsatzbereiche von Serious Games und Gamification: Dieses Kapitel beschreibt die vielfältigen Anwendungs- und Einsatzbereiche von Serious Games und DGBL. Es beleuchtet die breiten Möglichkeiten und die vielfältigen Anwendungsfälle, die sich aus der Kombination von spielerischen Elementen und Lerninhalten ergeben. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendung und den konkreten Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Kontexten.
Vorteile und Wirkung digitaler Spiele aus didaktischer Sicht: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die didaktischen Vorteile und die Wirkungsweisen von DGBL. Es untersucht die positiven Effekte des Lernens mit digitalen Spielen und beleuchtet Aspekte wie Immersion und die Steigerung der Motivation und des Lernerfolgs. Die didaktischen Prinzipien und die Wirkungsmechanismen werden detailliert analysiert und erklärt.
Model zum Lernen mit digitalen Spielen: Dieses Kapitel stellt ein Modell zum Lernen mit digitalen Spielen vor. Es visualisiert und beschreibt die Prozesse und Interaktionen, die beim Lernen mit digitalen Spielen stattfinden und bietet damit einen strukturierten Rahmen zum Verständnis der Lernprozesse.
Ausgewählte Serious Game und Gamification Beispiele: Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl an Beispielen für Serious Games und Gamification, die die praktische Anwendung der Konzepte illustrieren. Die Beispiele dienen als konkrete Illustrationen der im vorherigen Kapitel beschriebenen Konzepte und Prinzipien. Sie zeigen die Vielfältigkeit und die breite Anwendbarkeit von Serious Games und Gamification.
Schlüsselwörter
Serious Games, Digital Game-Based Learning, Gamification, E-Learning, demografischer Wandel, Mitarbeitergewinnung, Personalentwicklung, didaktische Vorteile, Lernmotivation, Unternehmen, HR-Management.
Häufig gestellte Fragen zu "Serious Games und Digital Game-Based Learning"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Trends, Entwicklungen und Einsatzmöglichkeiten von Serious Games (SG) und Digital Game-Based Learning (DGBL). Sie beleuchtet die Wirkungsweisen und Vorteile digitaler Lernspiele, gibt eine Bewertung und Handlungsempfehlung für Unternehmen und Organisationen, insbesondere für die Unternehmensführung und das HR-Management, und enthält eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Trends und Entwicklungen im Bereich Serious Games und DGBL; Vorteile und didaktische Wirkungsweisen digitaler Lernspiele; Einsatzmöglichkeiten von Serious Games und DGBL in Unternehmen; Der Einfluss des demografischen Wandels auf die Akzeptanz von Serious Games; Definition und Abgrenzung der Begriffe Serious Games, DGBL und Gamification.
Welche Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert und grenzt die Begriffe „Spiel“, E-Learning, Serious Games, DGBL und Gamification präzise voneinander ab. Dies bildet die Grundlage für das Verständnis der weiteren Ausführungen.
Welche Trends im Bereich Serious Games werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt unter anderem folgende Trends: Die Internationalisierung von DGBL, die Nutzung von „Recrutainment“ in der Mitarbeitergewinnung, die Überstrapazierung des Begriffs „Game-Based-Learning“, den Einsatz als Marketing-Tool, die Erschließung neuer Zielgruppen, die Möglichkeit des Selbst-Erstellens von Serious Games und DGBL als Teil des Gamification-Trends.
Welche Vorteile bieten digitale Lernspiele aus didaktischer Sicht?
Die Arbeit untersucht die positiven Effekte des Lernens mit digitalen Spielen, beleuchtet Aspekte wie Immersion und die Steigerung der Motivation und des Lernerfolgs. Die didaktischen Prinzipien und die Wirkungsmechanismen werden detailliert analysiert und erklärt.
Welche Einsatzbereiche von Serious Games und Gamification werden genannt?
Die Arbeit beschreibt die vielfältigen Anwendungs- und Einsatzbereiche von Serious Games und DGBL in verschiedenen Kontexten und zeigt die breiten Möglichkeiten und die vielfältigen Anwendungsfälle, die sich aus der Kombination von spielerischen Elementen und Lerninhalten ergeben.
Enthält die Arbeit praktische Beispiele?
Ja, die Arbeit präsentiert ausgewählte Beispiele für Serious Games und Gamification, die die praktische Anwendung der Konzepte illustrieren und die Vielfältigkeit und die breite Anwendbarkeit von Serious Games und Gamification zeigen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Unternehmen und Organisationen, insbesondere für die Unternehmensführung und das HR-Management, die sich mit den Möglichkeiten des Einsatzes von Serious Games und DGBL im Bereich der Personalentwicklung und Mitarbeitergewinnung auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Serious Games, Digital Game-Based Learning, Gamification, E-Learning, demografischer Wandel, Mitarbeitergewinnung, Personalentwicklung, didaktische Vorteile, Lernmotivation, Unternehmen, HR-Management.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich im Hauptteil des Dokuments und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf.
- Citation du texte
- Gerhard Doujak (Auteur), 2015, Serious Games und Digital Game Based Learning. Spielebasierte E-Learning Trends der Zukunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304256