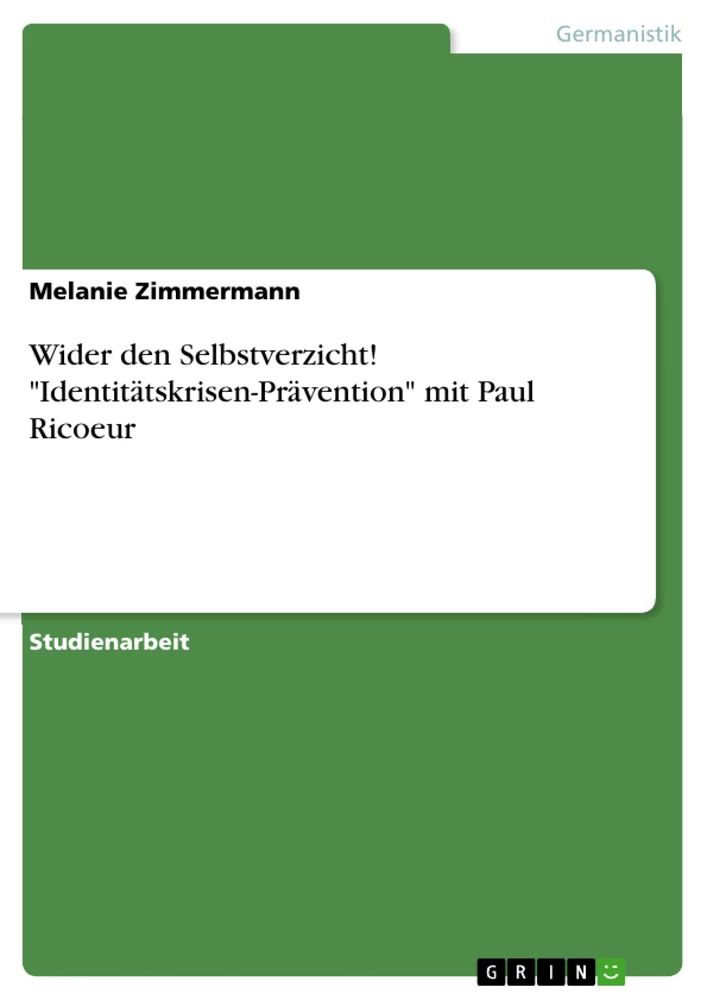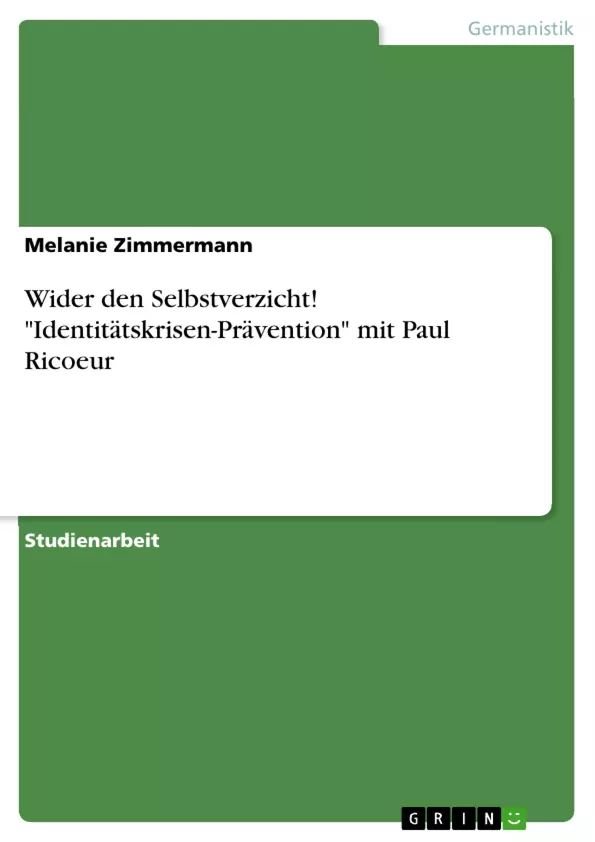Wie nicht nur Beispiele aus der Literatur des 20. Jahrhunderts zeigen, manifestiert sich das Phänomen »mobiler, multipler, selbstreflexiver« werdender Identität besonders in der Literatur und Literaturtheorie – ob in der Moderne bei Rilke, Ehrenstein, Einstein oder Musil zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ob in der Postmoderne und Gegenwart bei Brecht, Handke, Hilbig oder auch Sebald. Ihnen allen ist die Auseinandersetzung mit dem Problem der personalen Identität, das heißt der Dialektik von Beständigkeit und Wandelbarkeit, gemein.
So scheint die Tatsache, daß eine stetig wachsende Menge vor allem an Ich-Erzählern die eigenen Geschichten samt der mit der Begreiflichkeit des Ichs verbundenen Probleme schildert, Odo Marquard in diesem Punkt zu bestätigen: »Wer auf das Erzählen verzichtet, verzichtet auf seine Geschichten; wer auf seine Geschichten verzichtet, verzichtet auf sich selber.« Oder mit Fernando Pessoa: »Sich bewegen heißt leben, sich in Worte fassen heißt überleben.« Für Findung, Erfindung, Kohärenz und Kontinuität der eigenen Identität – trotz Veränderungen – scheint das Erzählen notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt auch Paul Ricoeur mit seiner Konzeption narrativer Identität, derzufolge das Individuum durch das Erzählen und Rezipieren seiner und anderer (Lebens-)Geschichten zu einer Bestimmung seiner eigenen Identität finden kann.
Dieses Konzept wird im Verlauf dieser Arbeit näher erläutert und anhand von Beispielen aus der zeitgenössischen Literatur veranschaulicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 (Post-)Moderne Grundprobleme
- 2.1 Ricoeur und die Philosophische Anthropologie
- 2.2 Erzählen und Sich-selbst-Erzählen
- 3 Idemität und Ipseität
- 3.1 Der Fall »>Tubutsch<<
- 3.2 Der Ausweg Selbstheit
- 4 Narrative Identität
- 5 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem Thema der personalen Identität und deren Herausforderungen im Kontext der Moderne und Postmoderne. Sie untersucht, wie sich das Individuum im Laufe des Lebens und in der Auseinandersetzung mit Veränderungen selbst definiert und welche Rolle das Erzählen dabei spielt.
- Die Dialektik von Beständigkeit und Wandelbarkeit in der personalen Identität
- Die Bedeutung des Erzählens für die Konstruktion von Identität
- Die Philosophische Anthropologie von Helmuth Plessner und Paul Ricoeurs Konzeption der narrativen Identität
- Die Rolle von Literatur und Literaturtheorie bei der Erforschung von Identitätskrisen
- Beispiele aus der zeitgenössischen Literatur zur Veranschaulichung der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Problematik der personalen Identität im Kontext von Veränderung und Entwicklung. Sie bezieht sich auf Beispiele aus der Literatur, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
Kapitel 2: (Post-)Moderne Grundprobleme personaler Identität
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der modernen und postmodernen Lebensweise für die Konstruktion einer stabilen Identität ergeben. Es werden die philosophischen Ansätze von Helmuth Plessner und Paul Ricoeur vorgestellt.
Kapitel 3: Idemität und Ipseität
Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen der Idemität und Ipseität und ihren Implikationen für die Identität des Individuums. Es werden die Konzepte von Ricoeur und die Bedeutung des "Selbst als ein Anderer" erörtert.
Kapitel 4: Narrative Identität
Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Erzählens für die Konstruktion von Identität. Es wird Ricoeurs Konzeption der narrativen Identität vorgestellt und anhand von Beispielen aus der Literatur erläutert, wie das Individuum durch das Erzählen seiner Geschichten zu einer Bestimmung seiner eigenen Identität finden kann.
Schlüsselwörter
Personale Identität, Moderne, Postmoderne, Erzählen, Narrative Identität, Selbst-Erzählen, Philosophische Anthropologie, Helmuth Plessner, Paul Ricoeur, Idemität, Ipseität, Literatur, Literaturtheorie, Veränderung, Wandelbarkeit, Identitätskrisen, Lebensgeschichten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Paul Ricoeur unter „narrativer Identität“?
Narrative Identität bedeutet, dass der Mensch seine Identität durch das Erzählen seiner Lebensgeschichte konstruiert. Das Individuum verbindet Beständigkeit (Idem) und Wandel (Ipse) zu einer kohärenten Geschichte.
Was ist der Unterschied zwischen Idemität und Ipseität?
Idemität (Gleichheit) bezieht sich auf das, was zeitlos gleich bleibt (z. B. genetischer Code). Ipseität (Selbstheit) bezieht sich auf die Beständigkeit des Selbst trotz Veränderungen im Laufe der Zeit.
Warum ist das Erzählen wichtig für das Überleben des Ichs?
Wie Odo Marquard sagt: „Wer auf seine Geschichten verzichtet, verzichtet auf sich selber.“ Das Erzählen schafft Sinnzusammenhänge in einer fragmentierten (post-)modernen Welt.
Welche Rolle spielt die Literatur bei Identitätskrisen?
In der Literatur des 20. Jahrhunderts (z. B. Rilke, Musil) manifestieren sich Identitätsprobleme. Die Analyse dieser Texte hilft, die Dialektik von Beständigkeit und Wandel besser zu verstehen.
Was bedeutet „Selbst als ein Anderer“?
Es ist der Titel eines Hauptwerks von Ricoeur. Er besagt, dass das Selbstverständnis immer die Beziehung zum Anderen und die Sichtweise von außen mit einbezieht.
- Quote paper
- Melanie Zimmermann (Author), 2014, Wider den Selbstverzicht! "Identitätskrisen-Prävention" mit Paul Ricoeur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304290