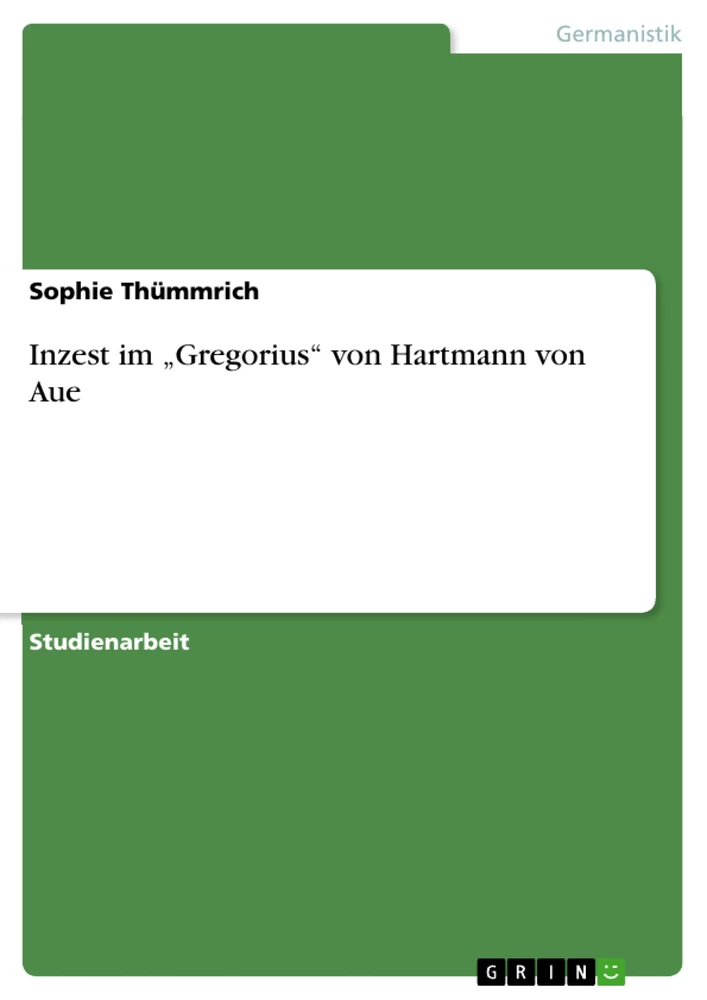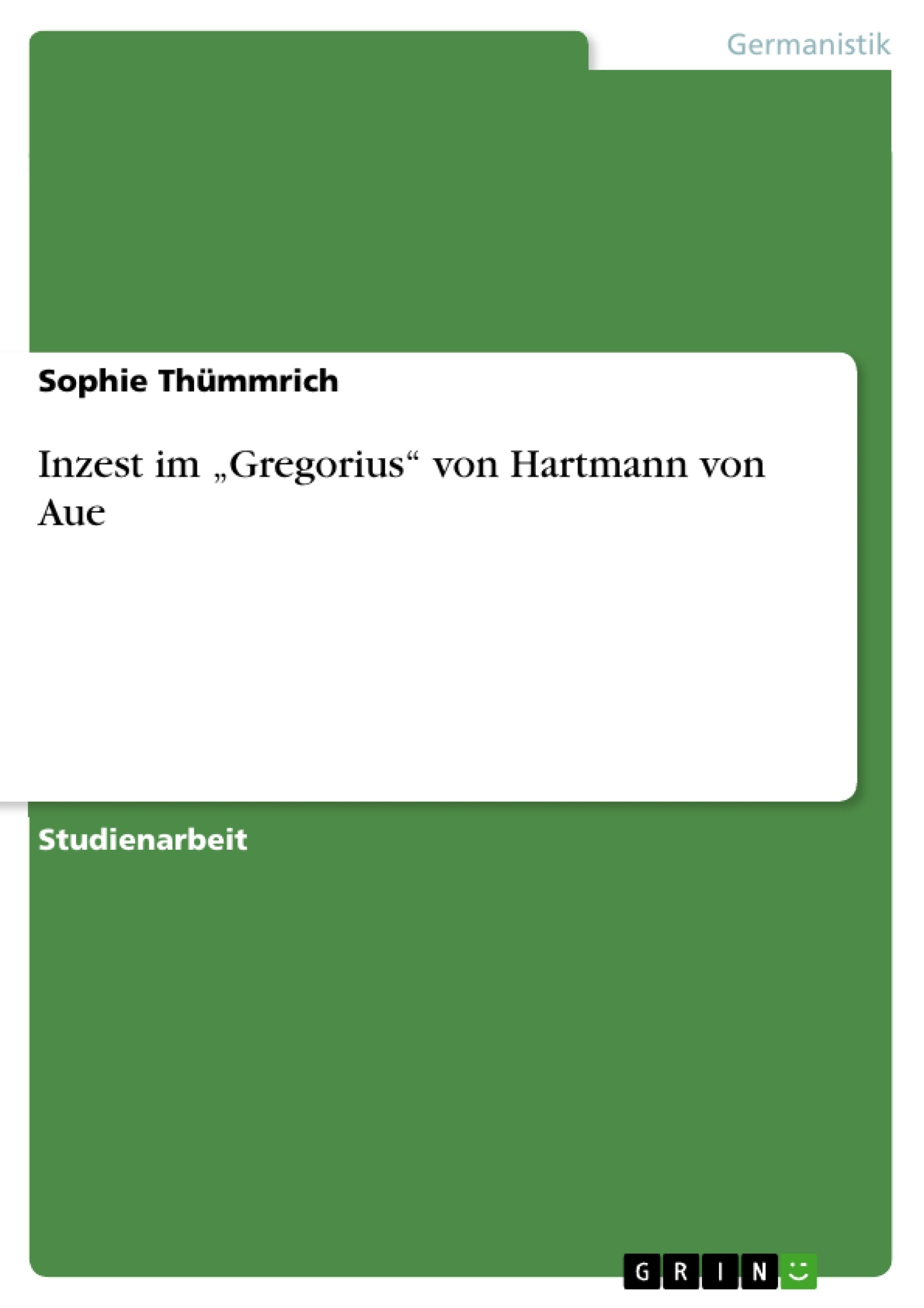Hartmanns von Aue guoter sündære „Gregorius“ zeichnet sich durch die Sünde seiner Eltern, die an ihm begangen worden ist und die Sünde, die er selbst begeht, aus. Die Inzestproblematik ist im Werk handlungstragend. Wie es zu jenen Ereignissen kam und welche Bedeutung dieser doppelte Inzest trägt, sollen zentrale Fragestellungen dieser Arbeit sein.
Zunächst wird der Begriff „Inzest“ klar definiert. Anschließend werde ich den doppelten Inzest im „Gregorius“ thematisieren. Dabei werden die Besonderheiten des Geschwisterinzests und des Inzests zwischen Mutter und Sohn gegenübergestellt. Wie unterscheiden sich die Figurenkonstellationen und die Motive für den jeweiligen Inzest? Zum Abschluss sollen die gewonnenen Ergebnisse in der Schlussbetrachtung aufgezeigt und zusammengefasst werden.
Forschungsgeschichtlich steht die Inzestfrage eng im Zusammenhang mit der viel diskutierten Frage der Schuld im „Gregorius“. Vor allem in den 60er und 70er Jahren erschienen eine Menge Publikationen, die sich der Schuldproblematik befassen. In Thomas Manns „Der Erwählte“ von 1951 wird die Inzestthematik neu rezipiert. Aber auch neuere Literatur beleuchtet andere Aspekte in Bezug auf die Gregoriuserzählung, zum Beispiel nimmt der Aufsatz von Ingrid Kasten von 1993 zur Rolle der Frau im Werk Stellung.
Für die vorliegende Arbeit ist der mittelhochdeutsche Text „Gregorius, der gute Sünder“ nach der Ausgabe von Friedrich Neumann Grundlage. Zur Definition des Inzestbegriffs habe ich den Eintrag in der Enzyklopädie des Märchens genutzt. „Hartmann von Aue. Epoche – Werk – Wirkung“ von Christoph Cormeau und Wilhelm Störmer, sowie Jürgen Wolfs „Einführung in das Werk Hartmanns von Aue“ eigneten sich besonders zur Einführung in die Thematik. Susanne Hafners „Maskulinität in der höfischen Erzählliteratur“ und der Aufsatz „Inzest-Heiligkeit“ von Peter Strohschneider war die wichtigste Literaturbasis für die vorliegende Arbeit, denn sie setzt sich speziell mit dem Inzestproblem auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff „Inzest“
- 3. Der Geschwisterinzest und der Mutter-Sohn-Inzest im Vergleich
- Der Geschwisterinzest
- Der Mutter-Sohn-Inzest
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Inzestthematik in Hartmanns von Aues „Gregorius“. Die zentrale Fragestellung ist die Bedeutung des doppelten Inzestes in der Handlung und die Unterschiede zwischen Geschwisterinzest und Mutter-Sohn-Inzest. Die Arbeit definiert den Begriff „Inzest“, analysiert die jeweiligen Figurenkonstellationen und Motive, und vergleicht die Darstellung beider Inzestformen im Werk.
- Definition des Inzestbegriffs und seine unterschiedliche Auslegung in verschiedenen Kontexten.
- Vergleich des Geschwisterinzestes und des Mutter-Sohn-Inzestes im „Gregorius“.
- Analyse der Handlungsmotive und der Rolle des Teufels.
- Untersuchung der Darstellung der Schuld und des Wissens der beteiligten Figuren.
- Bedeutung der Minne und der Aventiure im Kontext des Inzestes.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Inzestes in Hartmanns von Aues „Gregorius“ ein. Sie stellt die zentrale Fragestellung nach der Bedeutung des doppelten Inzestes im Werk und die methodische Vorgehensweise der Arbeit vor. Die Arbeit wird sich zunächst mit einer Definition des Begriffs "Inzest" befassen, bevor sie den doppelten Inzest im "Gregorius" thematisiert und dabei die Besonderheiten des Geschwisterinzestes und des Inzestes zwischen Mutter und Sohn gegenüberstellt. Abschließend werden die Ergebnisse in einer Schlussbetrachtung zusammengefasst. Die Einleitung verortet die Arbeit auch in der Forschungsgeschichte, indem sie auf die Diskussion der Schuldfrage im "Gregorius" und relevante Sekundärliteratur verweist.
2. Zum Begriff „Inzest“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Inzest“. Es werden die unterschiedlichen Definitionen aus Biologie, Strafrecht und Religionen vorgestellt und verglichen. Die Arbeit erläutert, dass der Begriff „Inzest“ im heutigen Sprachgebrauch eine Ehe oder Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten bedeutet, wobei verschiedene Disziplinen den Begriff unterschiedlich definieren. Das Kapitel beleuchtet die historischen und kulturellen Unterschiede bezüglich der Akzeptanz von Inzest und thematisiert das Inzesttabu als ein Gesetz, das eine Ordnung herstellt und zwischen Verwandten und Nicht-Verwandten unterscheidet. Es werden zudem Beispiele aus Mythologie und Volkserzählungen angeführt, um die verschiedenen Ausprägungen und Bedeutungen des Inzestmotivs zu veranschaulichen.
3. Der Geschwisterinzest und der Mutter-Sohn-Inzest im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht den Geschwisterinzest und den Mutter-Sohn-Inzest im „Gregorius“. Es analysiert die Unterschiede in den Figurenkonstellationen, den Handlungsstrukturen (Minne vs. Aventiure), dem Verhältnis von Wissen und Schuld sowie Hartmanns Schreibstil in der Darstellung beider Inzestformen. Das Kapitel hebt die besondere Nähe der Geschwister hervor, die von Hartmann als positiv dargestellt wird, während die Handlungsmotive des Bruders detailliert erörtert werden, einschliesslich der Rolle des Teufels. Im Gegensatz dazu wird der Mutter-Sohn-Inzest kurz und knapp beschrieben, wobei die Figuren unwissentlich den Inzest begehen. Dieser Vergleich verdeutlicht die unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung beider Inzestformen innerhalb des Erzählkontextes.
Schlüsselwörter
Inzest, Hartmann von Aue, Gregorius, Geschwisterinzest, Mutter-Sohn-Inzest, Minne, Aventiure, Schuld, Tabubruch, Mittelalter, mittelhochdeutsche Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu "Hartmanns von Aues Gregorius" - Inzestthematik
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Inzestthematik in Hartmanns von Aues "Gregorius", insbesondere den doppelten Inzest (Geschwister- und Mutter-Sohn-Inzest). Sie untersucht die Bedeutung dieser Inzestformen für die Handlung, vergleicht ihre Darstellung und beleuchtet die Unterschiede zwischen Geschwisterinzest und Mutter-Sohn-Inzest im Werk. Die Arbeit umfasst eine Definition des Begriffs "Inzest", eine Analyse der Figurenkonstellationen und Motive sowie eine Betrachtung der Schuldfrage und der Rolle des Teufels.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Punkte: Definition des Inzestbegriffs in verschiedenen Kontexten, Vergleich von Geschwister- und Mutter-Sohn-Inzest in "Gregorius", Analyse der Handlungsmotive und der Rolle des Teufels, Untersuchung der Darstellung von Schuld und Wissen der Figuren sowie die Bedeutung von Minne und Aventiure im Kontext des Inzestes.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Einleitung in die Thematik, Fragestellung und Methode), Definition des Begriffs "Inzest" (mit biologischen, rechtlichen und religiösen Perspektiven), Vergleich von Geschwister- und Mutter-Sohn-Inzest in "Gregorius" (Analyse der Figurenkonstellationen, Handlungsstrukturen, Wissen und Schuld), Schlussbetrachtung (Zusammenfassung der Ergebnisse) und Literaturverzeichnis.
Wie wird der Begriff "Inzest" definiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Definitionen von "Inzest" aus Biologie, Strafrecht und Religionen. Es wird herausgestellt, dass der Begriff im heutigen Sprachgebrauch eine Ehe oder Geschlechtsverkehr zwischen Verwandten bezeichnet, wobei die genaue Definition je nach Disziplin variiert. Die Arbeit beleuchtet auch historische und kulturelle Unterschiede in der Akzeptanz von Inzest und das Inzesttabu als ordnungstiftendes Gesetz.
Wie werden Geschwisterinzest und Mutter-Sohn-Inzest in "Gregorius" verglichen?
Das Kapitel zum Vergleich analysiert die Unterschiede in den Figurenkonstellationen, den Handlungsstrukturen (Minne vs. Aventiure), dem Verhältnis von Wissen und Schuld sowie Hartmanns Schreibstil in der Darstellung beider Inzestformen. Es hebt die besondere Nähe der Geschwister und die detaillierte Erörterung der Handlungsmotive des Bruders hervor, im Gegensatz zur knappen Darstellung des unwissentlichen Mutter-Sohn-Inzestes. Die unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung beider Inzestformen im Erzählkontext wird verdeutlicht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Inzest, Hartmann von Aue, Gregorius, Geschwisterinzest, Mutter-Sohn-Inzest, Minne, Aventiure, Schuld, Tabubruch, Mittelalter, mittelhochdeutsche Literatur.
Welche Rolle spielt der Teufel in der Arbeit?
Die Rolle des Teufels wird im Zusammenhang mit den Handlungsmotiven, insbesondere beim Geschwisterinzest, analysiert. Die Arbeit untersucht, wie der Teufel in die Handlung eingreift und die Ereignisse beeinflusst.
Welche Bedeutung haben Minne und Aventiure im Kontext des Inzestes?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Minne und Aventiure im Kontext des Inzestes und wie diese Konzepte in die Darstellung des Geschwister- und Mutter-Sohn-Inzestes eingebunden sind. Der Vergleich dieser Konzepte innerhalb der unterschiedlichen Inzestformen wird analysiert.
- Citar trabajo
- Sophie Thümmrich (Autor), 2010, Inzest im „Gregorius“ von Hartmann von Aue, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304304