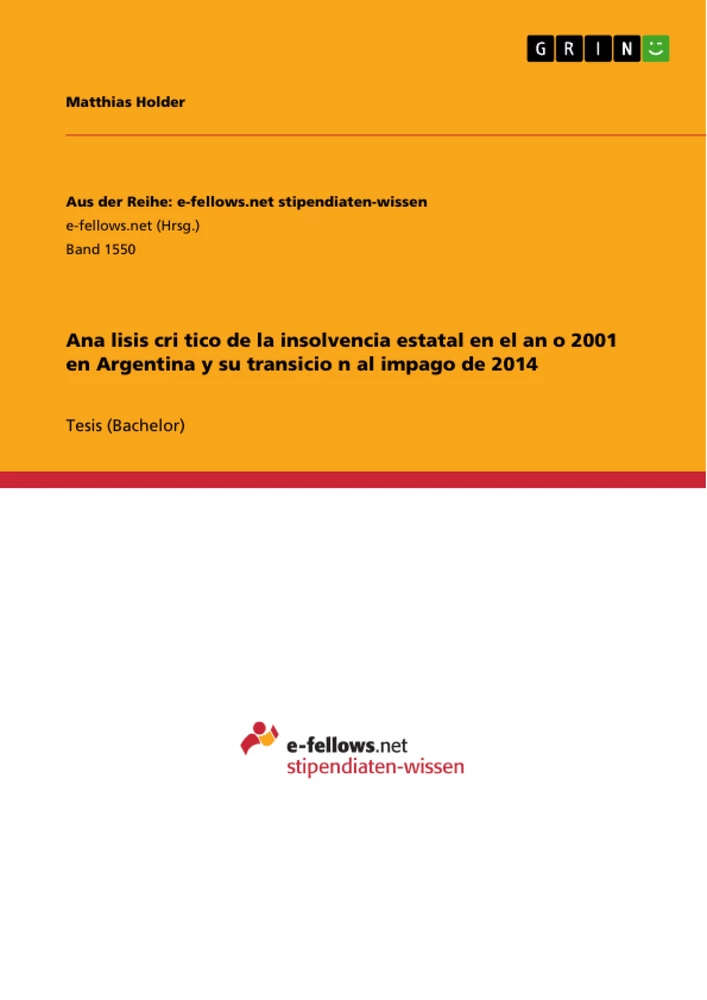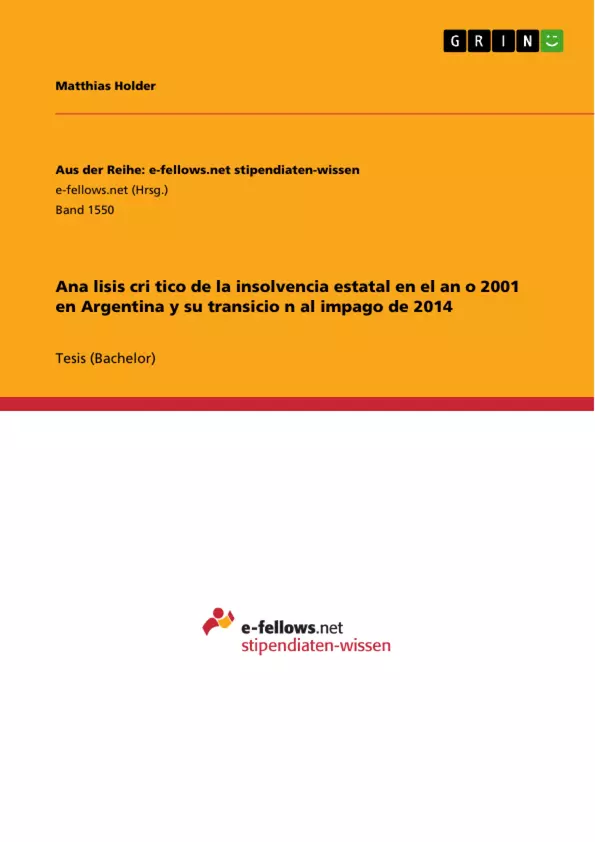Este trabajo analiza la transición de Argentina desde la insolvencia estatal en 2001 al impago de la deuda pública en 2014. Además, se estudia si la segunda crisis es una consecuencia directa de la gran depresión en 2001. Tras el análisis de varios textos académicos, se razona que el impago actual reside entre otras cosas en graves fallos en el proceso de la reestructuración de la deuda. Con ello, los dos acontecimientos están conectados indisolublemente. Para Argentina la superación de este impago constituye un paso decisivo en recuperar su antigua importancia económica.
This paper analyses Argentina ́s development from the sovereign bankruptcy in 2001 to the default on payment in 2014. Furthermore, the text examines if the second crisis can be constituted as a direct result of the great depression in 2001. Given the analysis of numerous academic papers, you can conclude that the mismanagement of the debts´ restructuring is among other things the origin of the current default. Therefore, the two events are strongly connected. For Argentina, it is decisive to overcome the contemporary crisis in order to regain its past economic strength.
Inhaltsverzeichnis
- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. METODOLOGÍA
- 3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
- 3.1 EL PERIODO DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
- 3.2 EL PERONISMO
- 3.3 HIPERINFLACIÓN DE LOS AÑOS OCHENTA
- 4. MEDIDAS ECONÓMICAS EN LOS AÑOS NOVENTA E INCIDENCIA EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ECONOMÍA
- 4.1 SISTEMA FINANCIERO Y TIPO DE CAMBIO
- 4.2 COMERCIO EXTERIOR
- 4.3 PRIVATIZACIONES
- 5. LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LA CRISIS DE 2001
- 5.1 DEFICIENCIAS ECONÓMICAS DOMÉSTICAS
- 5.2 CHOQUES EXTERNOS
- 6. LA ÉPOCA POST-CRISIS
- 6.1 SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
- 6.2 PRÁCTICAS EN LA ERA DEL “KIRCHNERISMO”
- 6.3 REESTRUCTURACIÓN DE LAS DEUDAS
- 7. EL IMPAGO DE LA DEUDA PÚBLICA EN 2014
- 7.1 EXPLICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL IMPAGO Y DEL MARCO LEGAL
- 7.2 CONSECUENCIAS DE LAS NEGOCIACIONES FRACASADAS
- 7.3 COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LAS DOS INSOLVENCIAS
- 8.PERSPECTIVAS FUTURAS PARA LA ECONOMÍA ARGENTINA
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text untersucht die Entwicklung Argentiniens von der staatlichen Insolvenz im Jahr 2001 bis zum Zahlungsausfall der Staatsverschuldung im Jahr 2014. Ziel ist es, die Beziehung zwischen diesen beiden Krisen zu analysieren und zu ergründen, ob die zweite Krise eine direkte Folge der großen Depression von 2001 ist. Dabei werden die Ursachen und Folgen der ersten Krise beleuchtet, insbesondere die Rolle der Staatsverschuldungs-restrukturierung und die Frage, ob diese die spätere Zahlungsunfähigkeit beeinflusst hat.
- Die staatliche Insolvenz in Argentinien im Jahr 2001
- Die Gründe für die Wirtschaftskrise in Argentinien im Jahr 2001
- Die Rolle der Staatsverschuldungs-restrukturierung im Zusammenhang mit der Krise von 2001
- Der Zahlungsausfall der Staatsverschuldung im Jahr 2014
- Die Beziehung zwischen den beiden Krisen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beleuchtet zunächst die historischen und wirtschaftlichen Hintergründe Argentiniens und analysiert die Ursachen der Krise von 2001, die auf interne wirtschaftliche Schwächen und externe Schocks zurückzuführen sind. Anschließend werden die Maßnahmen der argentinischen Regierung im Zuge der Staatsverschuldungs-restrukturierung nach der Krise von 2001 untersucht. Der Text beleuchtet die Folgen dieser Maßnahmen und führt zur Frage, ob diese die spätere Zahlungsunfähigkeit im Jahr 2014 beeinflusst haben. Schließlich werden die Hintergründe des Zahlungsausfalls von 2014 und dessen Folgen analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die argentinische Wirtschaftskrise von 1999 bis 2002, die staatliche Insolvenz, die Staatsverschuldungs-restrukturierung, der "Kirchnerismo", der Zahlungsausfall von 2014, die RUFO-Klausel und die Vergleichbarkeit der beiden Krisen.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptursachen für die argentinische Krise 2001?
Die Krise resultierte aus internen wirtschaftlichen Schwächen (wie dem festen Wechselkurs), externen Schocks und einer massiven Staatsverschuldung.
Wie hängen die Insolvenz von 2001 und der Zahlungsausfall von 2014 zusammen?
Die Arbeit argumentiert, dass Fehlentscheidungen bei der Umschuldung nach 2001 und rechtliche Konflikte direkt zum Zahlungsausfall im Jahr 2014 führten.
Was versteht man unter „Kirchnerismo“ im wirtschaftlichen Kontext?
Es bezeichnet die Ära unter Néstor und Cristina Kirchner, die durch eine spezifische Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie die Reorganisation der Staatsschulden geprägt war.
Was ist die RUFO-Klausel?
Die „Rights Upon Future Offers“-Klausel besagte, dass Argentinien freiwilligen Gläubigern keine schlechteren Bedingungen bieten durfte als anderen, was die Verhandlungen 2014 blockierte.
Wie unterschieden sich die makroökonomischen Indikatoren der beiden Krisen?
Die Arbeit vergleicht wichtige Kennzahlen wie Inflation, BIP-Entwicklung und Arbeitslosigkeit zwischen der Depression von 2001 und der Situation 2014.
Welche Rolle spielten die Privatisierungen der 90er Jahre?
Die massiven Privatisierungen unter Menem in den 90ern schufen kurzfristig Einnahmen, trugen aber zur langfristigen Instabilität und Abhängigkeit bei, die 2001 eskalierte.
- Quote paper
- Matthias Holder (Author), 2015, Análisis crítico de la insolvencia estatal en el año 2001 en Argentina y su transición al impago de 2014, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304352