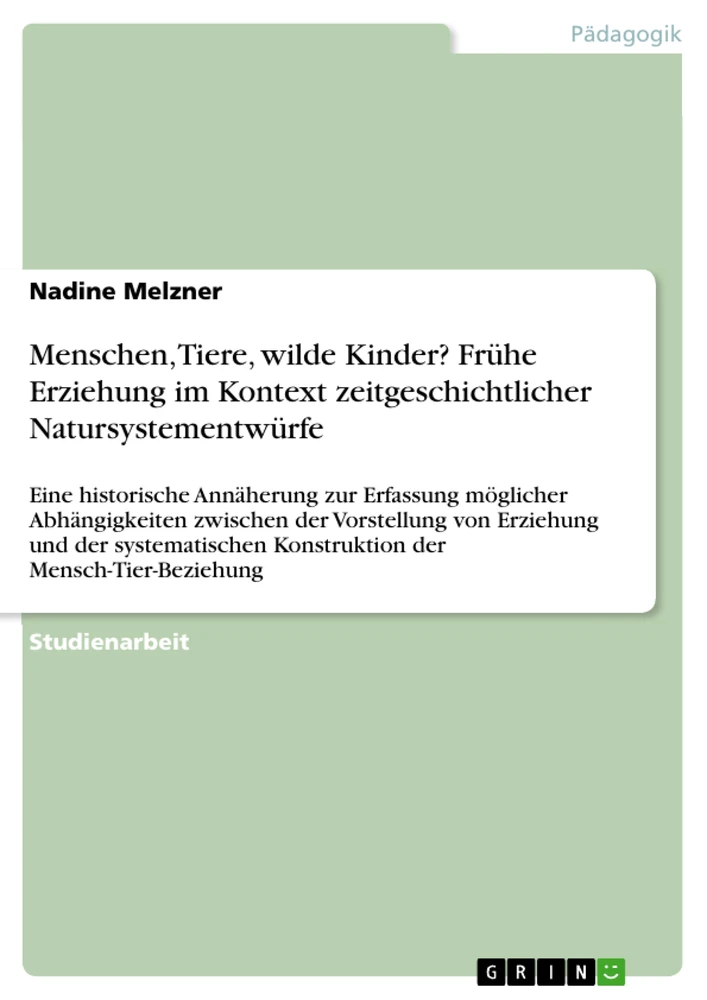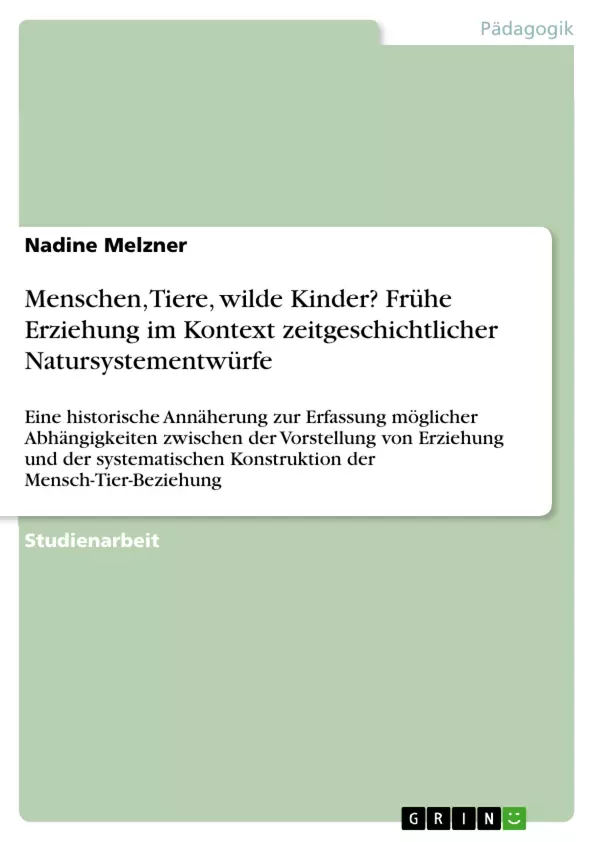Analog zum zunehmenden Voranschreiten des Zivilisationsprozesses innerhalb einer Gesellschaft kommt es zur kontinuierlichen Verstärkung der Ambivalenz zwischen Emotionalität und Brutalität. Während in vielen ärmeren ländlichen Gebieten der Erde menschliches und tierisches Wohlergehen noch miteinander einher gehen, zeigt sich in den westlich-industrialisierten Ländern ein hochgradig zerrissenes Bild: Schlachthöfe automatisieren und ökonomisieren ihren Betrieb; gleich um die Ecke werden Tiersalons, Kostümläden, Praxen und Schulen für Tiere errichtet. Hier hat der Mensch das Tier domestiziert und benötigt es fortan nur noch zum „[B]etüddeln“.
Schlägt man sodann die Zeitung auf und liest von der Forderung nach „Grundrechte[n] für Menschenaffen“, ist es durchaus legitim, danach zu fragen, welcher Floh den Menschen da wohl geritten haben muss. Es scheint, als würde der Durchschnittsbürger den Widerspruch im eigenen Denken und Handeln nicht bemerken. Von Situation zu Situation modifiziert er seine Einstellung wie ein Chamäleon, das sich trotz schwarz-weiß gesprenkelter Umgebung nicht von der Gesellschaft abzuheben vermag.
Aber woher nimmt sich die Krone der Schöpfung all die Rechte und das Selbstbewusstsein? Gibt es eine Kluft zwischen Mensch und Tier, die von beiden Seiten weder durch Vormachen und „Nachäffen“, noch durch angeborene Eigenschaften, höhere Mächte oder biologisch-phylogenetischen Zufallsschwankungen überwunden werden kann? Oder macht sich der Mensch durch derartigen Übereifer bloß zum Affen und hat die Krone gar wie eine diebische Elster den Tieren gestohlen? Hat er seinen vermeintlich hohen Status vielleicht sogar denselben zu verdanken und steht womöglich auf deren Stufe, holt man ihn erst von seinem hohen Ross?
All diese Überlegungen stellen eine Art Bauplan für die Konstruktion klassifizierender Natur- oder Biosysteme dar, die die verschiedensten Bestandteile eines Organismus in Beziehung zueinander erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Aktualität und Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung
- Charakterisierung der Mensch-Tier-Beziehung zwischen Bibel und Früher Neuzeit
- Die Frühe Neuzeit - Ordnungssysteme und die Entdeckung der Kindheit
- Wilde Kinder - Beschreibung, Abgrenzung und das aufkommende Interesse an ihren raren Quellen durch die zeitgenössische Wissenschaft
- Einbindung der Wilden Kinder in den neuzeitlichen Diskurs über Wesen und Wertigkeit des Menschen
- Gestaltwandel der Erziehung am Beispiel Locke
- Das „,Systema Naturae“ von Linne. Versuch einer übersichtlichen und überdauernden Gliederung der Natur
- Folgen des Systema Naturae für die Erziehung
- Analyse der literarischen Klassifikation der Wolfskinder von Midnapur als Beispiel der Moderne
- Erzieherische Konsequenzen für die Wilden Kinder
- Erzieherische Konsequenzen der Wilden Kinder
- Intersystemischer Interpretationsspielraum – eine Konklusion
- Darstellung der Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage nach der Abhängigkeit zwischen Erziehung und den Konstruktionsprozessen der Mensch-Tier-Beziehung. Sie analysiert, wie historische Natur- und Biosysteme den Menschen im Vergleich zum Tier positionieren und wie sich diese Positionierungen auf Erziehungspraktiken auswirken. Dabei steht die Rolle der „Wilden Kinder“ im Zentrum der Betrachtung.
- Historische Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung
- Systematische Konstruktion von Mensch-Tier-Beziehungen
- Einfluss von Naturphilosophie und Klassifikationssystemen auf Erziehung
- Die Rolle der „Wilden Kinder“ im Diskurs über Mensch und Tier
- Erzieherische Implikationen der Mensch-Tier-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ambivalenz der Mensch-Tier-Beziehung in der Gegenwart und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor. Das zweite Kapitel untersucht die Mensch-Tier-Beziehung in der Bibel und der Frühen Neuzeit. Es werden die Ordnungssysteme und die Entdeckung der Kindheit in dieser Epoche beschrieben sowie das Interesse der Wissenschaft an „Wilden Kindern“ aufgezeigt. Kapitel drei analysiert den Einfluss des „Systema Naturae“ von Linne auf die Erziehung und die Einordnung der „Wilden Kinder“ in den neuzeitlichen Diskurs über Mensch und Tier. Das vierte Kapitel widmet sich der literarischen Klassifikation der Wolfskinder von Midnapur und analysiert die erzieherischen Konsequenzen für diese Kinder.
Schlüsselwörter
Mensch-Tier-Beziehung, Erziehung, Wilde Kinder, Frühe Neuzeit, Systema Naturae, Klassifikation, Anthropologie, Naturphilosophie, Erziehungsgeschichte, historische Annäherung
Häufig gestellte Fragen
Was untersuchen "Wilde Kinder" im pädagogischen Diskurs?
Wilde Kinder (oder Wolfskinder) dienen als Grenzfälle, um die Grenze zwischen Mensch und Tier sowie den Einfluss von Erziehung auf die menschliche Natur zu erforschen.
Welchen Einfluss hatte Carl von Linné auf das Menschenbild?
Durch sein "Systema Naturae" klassifizierte Linné den Menschen biologisch im Tierreich, was weitreichende Konsequenzen für das Verständnis von Erziehung und menschlicher Sonderstellung hatte.
Wie veränderte sich die Mensch-Tier-Beziehung in der Frühen Neuzeit?
In dieser Epoche entstanden neue Ordnungssysteme und die wissenschaftliche "Entdeckung der Kindheit", was zu einer systematischeren Abgrenzung zwischen menschlicher Zivilisation und tierischer Natur führte.
Welche Rolle spielt John Locke in dieser Arbeit?
Locke wird als Beispiel für den Gestaltwandel der Erziehung angeführt, insbesondere im Hinblick darauf, wie das Wesen des Menschen durch äußere Einflüsse geformt wird.
Was sind die "Wolfskinder von Midnapur"?
Es handelt sich um ein historisches Beispiel für wilde Kinder, an dem die Arbeit die literarische Klassifikation und die daraus resultierenden erzieherischen Konsequenzen analysiert.
Warum ist die Mensch-Tier-Beziehung heute ambivalent?
Die Arbeit thematisiert den Widerspruch zwischen industrieller Tiernutzung (Schlachthöfe) und der gleichzeitigen emotionalen Vermenschlichung von Haustieren in modernen Gesellschaften.
- Arbeit zitieren
- Nadine Melzner (Autor:in), 2015, Menschen, Tiere, wilde Kinder? Frühe Erziehung im Kontext zeitgeschichtlicher Natursystementwürfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304409