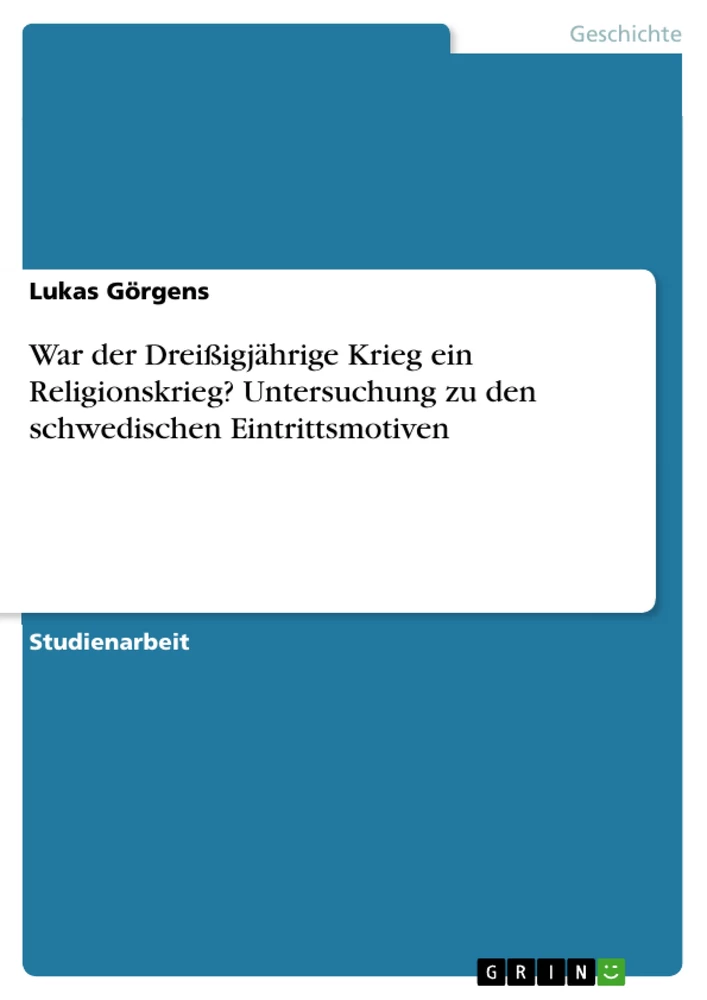Bernhard Maier erklärt in einem Artikel aus der Lexikonreihe „Religion in Geschichte und Gegenwart“, dass die Bezeichnung „Religionskrieg“ mit den Auseinandersetzungen zwischen europäischen Christen im 16. und 17. Jhd. entstanden ist. Dennoch kann der Begriff auch allgemein auf alle Konflikte mit einem religiösen Hintergrund übertragen werden, was der Grund dafür ist, dass es zu Überschneidungen mit anderen Kriegstypen kommt.
Wie groß die religiösen Einflüsse nämlich genau sein müssen, um beispielsweise einen Religions- von einem Hegemonialkrieg zu unterscheiden, kann nicht allgemeingültig bestimmt werden und daher bleibt der Begriff unscharf. Wenn selbst Lexika, die ja von kurzen, aber trotzdem genauen Beiträgen leben, nur eine grobe Skizze des Begriffs liefern können, muss zunächst ein Maßstab aufgestellt werden, anhand dessen untersucht werden kann, ob die Bezeichnung „Religionskrieg“ für einen bestimmten Konflikt sinnvoll ist.
Da der Dreißigjährige Krieg besonders durch die Vielzahl seiner Akteure auffällt, ist es mein Vorschlag, die Motive der Kriegsparteien zum Eintritt in den Konflikt gesondert zu betrachten und abzuwägen, ob diese für eine konfessionelle Interpretation des Krieges sprechen oder nicht. Der Eintritt Schwedens 1630 sorgte für eine weitere Internationalisierung des Dreißigjährigen Krieges und die Absichten König Gustav II. Adolfs sorgen noch in der heutigen Forschung für Diskussionen, weshalb sich die gewählte Herangehensweise hier besonders anbietet. Meine Vermutung ist, dass nicht religiöse, sondern ideologiebedingte expansionistische Motive ausschlaggebend für Gustav Adolfs Intervention in den Dreißigjährigen Krieg waren, was gegen die Bezeichnung „Religionskrieg“ für diesen Konflikt spricht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die religiosen Motive Schwedens
2.1. Gustav II. Adolf als Retter des Protestantismus
2.2. Wie viel religiose Motivation steckte tatsdchlich in der schwedischen Intervention ?
3. Die politischen Motive Schwedens
3.1. Fuhrte Schweden einen Defensivkrieg?
3.2. Das „Dominium maris Baltici"
4. Die ideologischen Motive Schwedens
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
7. Quellenverzeichnis
8. Anhang
-
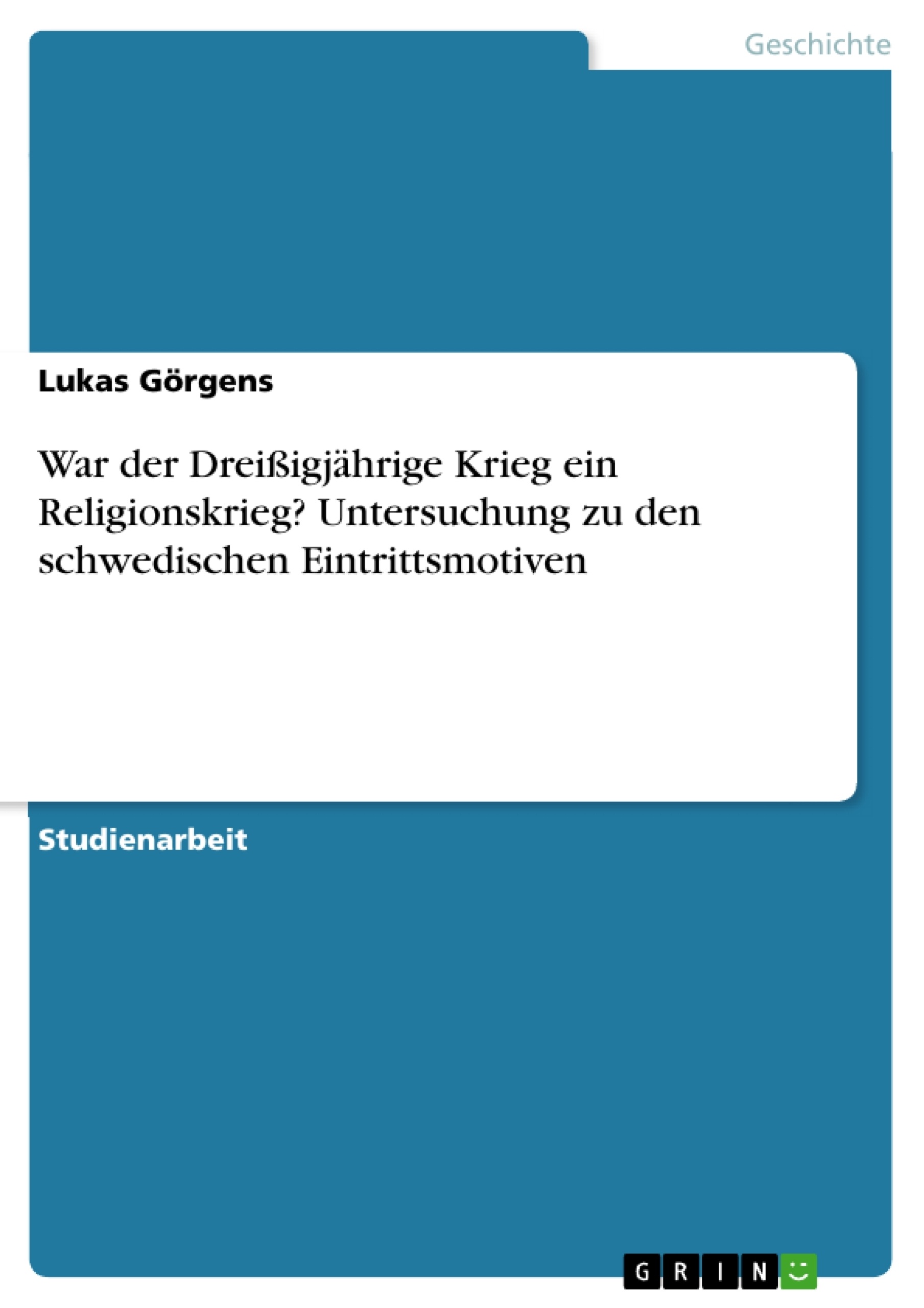
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.