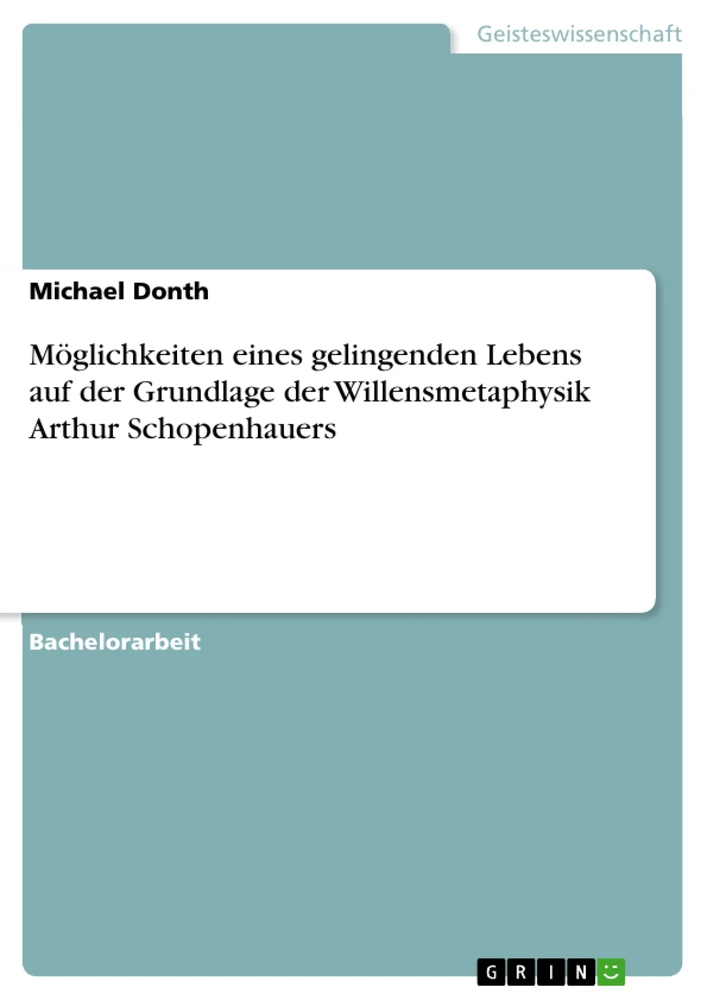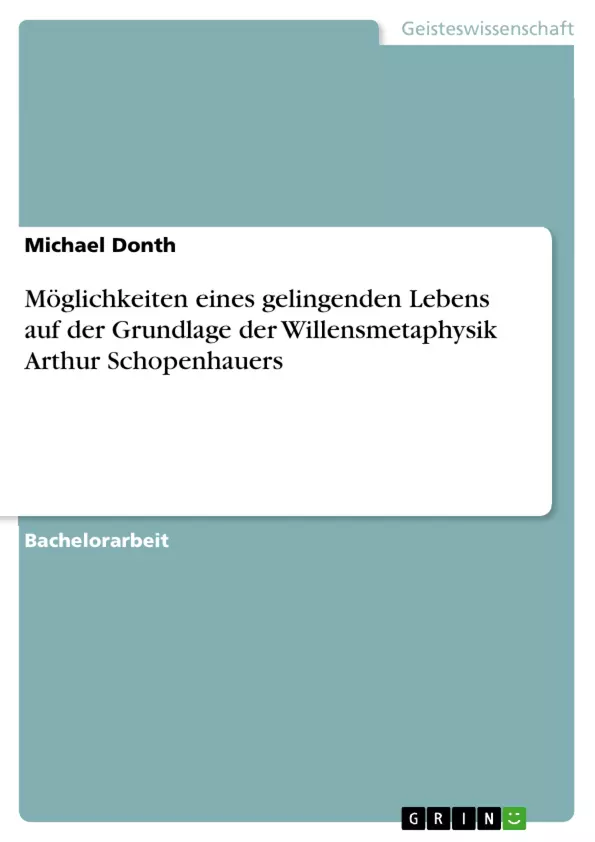Literatur zu Lebenshilfe und Lebensglück hat heute Hochkonjunktur. In großer Zahl stapeln sich Bücher zu diesem Thema in den Philosophie-Abteilungen der Buchhandlungen. Wie man leben soll, um glücklich zu werden, dieses Thema ist so alt wie die Philosophie selbst und wird den Menschen wohl auch in Zukunft beschäftigen. Schon Aristoteles suchte nach dem höchsten Gut, wonach alle Menschen streben, und nannte diese Gut εὐδαιμονία (eudaimonía), ein Wort, das meist mit 'Glück' oder 'Glückseligkeit' übersetzt wird.
Was kann uns ein Pessimist, der das Leben verneint, wie Arthur Schopenhauer es tat, über ein gelingendes und glückliches Leben sagen? Nach seiner Philosophie steht der Mensch vor der Wahl, das Leben entweder zu bejahen oder es zu verneinen. Letzterer Weg wird in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung zum summum bonum, dem absoluten Gut erklärt. Mit Radikalität findet Schopenhauer in seinem Weg der Lebensverneinung „jene Zufriedenheit [...], die nicht wieder gestört werden kann, [die] allein welterlösend ist.“ (WI, 322) Eine solch extreme und pessimistische Sichtweise auf das Leben mag abschreckend wirken., aber man muss der Radikalität Schopenhauers nicht folgen. Sich auf ihn einzulassen, eröffnet Perspektiven: Seine Metaphysik über den Willen zum Leben gibt Anreize, das eigene Wollen und seine Resultate für das eigene Lebensglück zu überdenken. Nicht in der extremen Lebensverneinung findet sich dann Erlösung, sondern in der Tendenz der Willensbeschwichtigung.
Diese Arbeit will darstellen, inwiefern Schopenhauers Philosophie trotz ihres Pessimismus' als Anleitung zu einem gelingenden Leben beitragen kann.
Neben seinem Hauptwerk finden sich zahlreiche andere Schriften, u.a. die Aphorismen zur Lebensweisheit und Die Kunst glücklich zu sein. Diese Schriften stehen in einer gewissen Spannung zu seinem Hauptwerk, denn er lässt sich dort „von dem höheren, metaphysisch-ethischen Standpunkte, zu welchem [seine] eigentliche Philosophie hinleitet“ (AL, 11) herab und erörtert die Glücksmöglichkeiten, welche sich eröffnen, wenn man trotz aller Einsicht, die seine Philosophie liefert, das Leben bejaht. Doch die Gemeinsamkeit der Schriften ist größer. Die Welt als Wille und Vorstellung stellt den radikalen Weg dar, während die Aphorismen und Lebensregeln jene Tendenz der Willensbeschwichtigung ausdrücken, von der ausführlich die Rede sein wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Frage nach dem guten Leben
- Die Welt als Wille und Vorstellung
- Die Welt als Vorstellung
- Die Welt als Wille
- Lebensbejahung und Unsterblichkeit
- Ein gelingendes Leben als bejahter Wille
- Das Leiden
- Leiden durch endloses Streben und Langeweile
- Perspektivenwechsel
- Leiden durch Egoismus und dem daraus resultierenden Kampf der Individuen
- Lebensverneinung
- Willensbeschwichtigung
- Aphorismen zur Lebensweisheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern Arthur Schopenhauers Philosophie, trotz ihres Pessimismus, als Anleitung zu einem gelingenden Leben dienen kann. Sie beleuchtet die Frage, wie Schopenhauers Metaphysik über den Willen zum Leben Anreize für die Reflexion über das eigene Wollen und seine Folgen für das Lebensglück bietet. Dabei stellt sie die These auf, dass nicht die extreme Lebensverneinung, sondern die Tendenz der Willensbeschwichtigung den Weg zur Erlösung weist.
- Schopenhauers Philosophie als Leitfaden für ein gelingendes Leben
- Die Rolle des Willens in Schopenhauers Metaphysik
- Die Bedeutung von Lebensbejahung und Lebensverneinung
- Das Leiden als Motor für die Suche nach einem gelingenden Leben
- Die Möglichkeit der Willensbeschwichtigung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik des gelingenden Lebens ein und stellt Schopenhauers pessimistische Philosophie als möglichen Ansatzpunkt für die Reflexion über Lebensglück dar. Sie hebt die Spannungen zwischen Schopenhauers Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung" und seinen Aphorismen zur Lebensweisheit hervor.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Frage nach dem guten Leben. Es beleuchtet die historische Entwicklung dieser Frage, beginnend bei Aristoteles und seiner Vorstellung von Eudaimonia (Glückseligkeit). Darüber hinaus wird diskutiert, ob es eine objektive Antwort auf die Frage nach dem guten Leben geben kann.
- Im dritten Kapitel wird Schopenhauers Metaphysik der Welt als Wille und Vorstellung erläutert. Es werden die Konzepte der Welt als Vorstellung und der Welt als Wille sowie die Auswirkungen auf die Lebensbejahung und -verneinung dargelegt.
- Das vierte Kapitel widmet sich dem Thema des Leidens. Es untersucht die Ursachen von Leiden, wie z.B. das Streben nach Glück, den Egoismus und den Kampf der Individuen. Außerdem werden die Möglichkeiten der Lebensverneinung und der Willensbeschwichtigung erörtert.
Schlüsselwörter
Schopenhauer, Willensmetaphysik, Lebensbejahung, Lebensverneinung, Leiden, Willensbeschwichtigung, Glück, Eudaimonia, Metaphysik, Philosophie, Lebensweisheit, Gelingen, Glückseligkeit, Lebenskunst, Selbstreflexion, Selbstverwirklichung.
Häufig gestellte Fragen
Kann Schopenhauers Pessimismus zu einem glücklichen Leben führen?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass Schopenhauers Philosophie durch die Reflexion über das Wollen und die "Willensbeschwichtigung" Wege zu einem gelingenden Leben eröffnet.
Was versteht Schopenhauer unter der "Welt als Wille"?
Der "Wille" ist für Schopenhauer der blinde, rastlose Drang, der allem Dasein zugrunde liegt und die Ursache für das menschliche Leiden ist.
Was ist "Willensbeschwichtigung"?
Es ist der Zustand, in dem der Mensch sein unaufhörliches Streben erkennt und zur Ruhe bringt, was zu einer tiefen, ungestörten Zufriedenheit führen kann.
Was unterscheidet sein Hauptwerk von den "Aphorismen zur Lebensweisheit"?
Während das Hauptwerk den radikalen Weg der Lebensverneinung lehrt, bieten die Aphorismen praktische Regeln für ein möglichst angenehmes Leben bei bejahtem Willen.
Warum leiden Menschen laut Schopenhauer?
Leiden entsteht durch endloses Streben, unerfüllte Wünsche, Langeweile und den Egoismus, der zum Kampf zwischen Individuen führt.
Welche Rolle spielt die Kunst in Schopenhauers Lebenskunst?
Die Arbeit beleuchtet, wie Ästhetik und Erkenntnis Momente der Erlösung vom Willensdrang bieten können.
- Arbeit zitieren
- Michael Donth (Autor:in), 2015, Möglichkeiten eines gelingenden Lebens auf der Grundlage der Willensmetaphysik Arthur Schopenhauers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304467