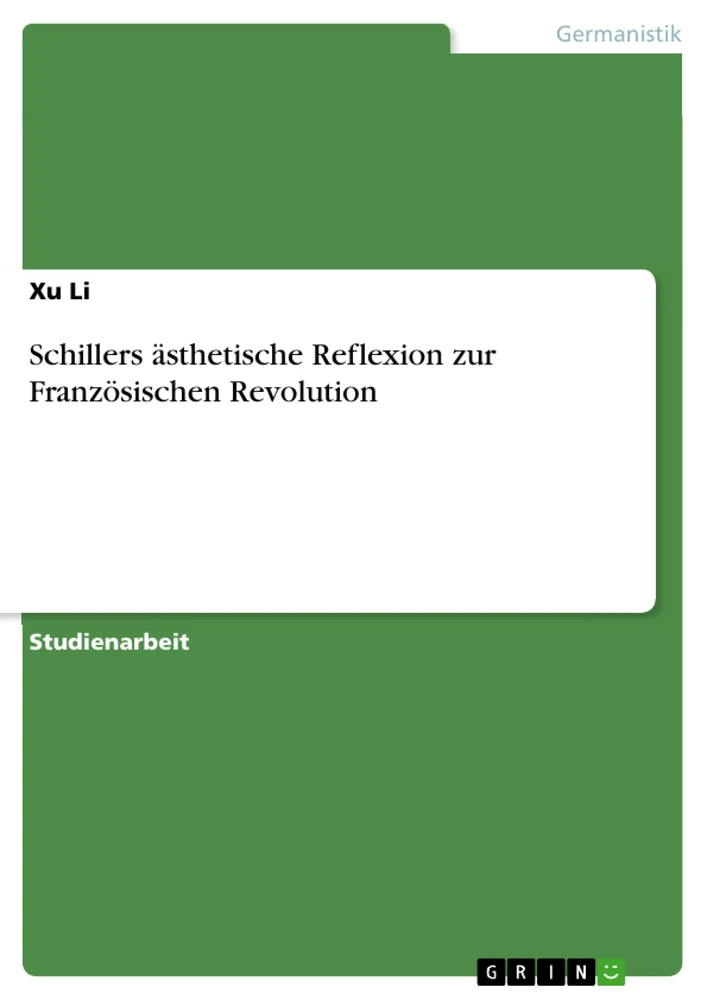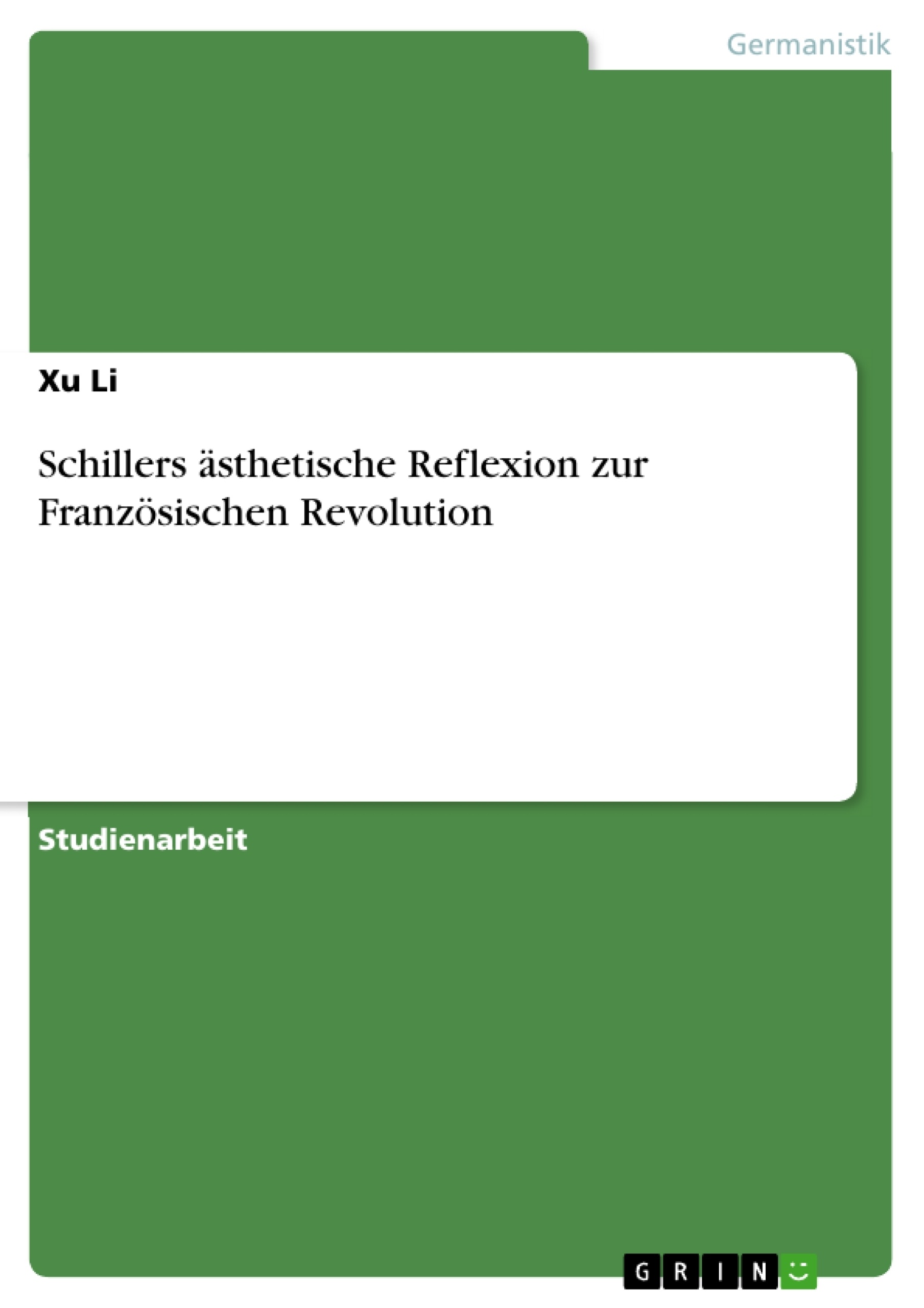In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts verbreiteten sich im Hintergrund der Aufklärung die Gedanken Freiheit und Gleichheit in Europa überall, die auch von einem Großteil der Bevölkerung akzeptiert wurden. Der Sieg des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs rief die Sehnsucht nach Freiheit und Gleichheit hervor. Zwar litten die Bürger Frankreichs unter der Brotnot, aber der König Ludwig XVI. wollte durch die Wiedereröffnung der Generalstände die Steuern vom dritten Stand erhöhen, der raus das Bürgertum und die Bauernschaft vertrat.
Anschließend brach die Große Revolution in Paris aus und das feudalabsolutistische Ancien Régime wurde damit umgewälzt.Vor der Revolution verfasste Friedrich Schiller die Dramen gegen Tyrannei, besonders gegen die absolutistische Despotie und gab er zugleich leidenschaftliche Unterstützung für Humanismus, Aufklärung und geistige, moralische sowie physische Freiheit des Individuums, z. B. "Die Räuber" (1781), "Verschwörung des Fiesco zu Genua" (1783) und "Kabale und Liebe" (1784), weswegen wahrscheinlich ihm die gerade im Entstehen begriffene französische Republik den Ehrenbürgerbrief eintrug.
Allerdings wurde Schiller allmählich vom Verlauf der Französischen Revolution enttäuscht, insbesondere den Septembermorden 1792 und der Hinrichtung des Königs am 21. Januar 1793. Dies führt ihn damit zur Ansicht, durch Ästhetik zur menschlichen Emanzipation beitragen zu wollen, nachdem die politische in seinen Augen gescheitert war und auf baldige Regeneration im Politischen keine Hoffnung bestand.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Französische Revolution in Schillers Augen
- 2.1. Phase der Errichtung der konstitutionellen Monarchie
- 2.2. Phase der Konventsherrschaft
- 2.3. Phase der Bürgerlichen Republik/Restauration
- 3. Reflexion über die Niederlage der Französischen Revolution in Schillers Schrift “Über die ästhetische Erziehung des Menschen”
- 3.1. Das Spannungsfeld zwischen Revolution und Freiheit
- 3.2. Gesellschaftsbild und Schreckensherrschaft
- 3.3. Notstaat/Naturstaat und Vernunftstaat
- 4. Schillers ästhetische Konzeption
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Französischen Revolution auf Friedrich Schillers ästhetische Theorie. Sie analysiert Schillers Kritik an verschiedenen Phasen der Revolution und beleuchtet, wie diese Erfahrungen seine Konzeption der ästhetischen Erziehung prägten. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Schillers politischer und ästhetischer Philosophie im Kontext der revolutionären Ereignisse.
- Schillers anfängliche Unterstützung der Französischen Revolution und seine spätere Enttäuschung.
- Die Rolle der Ästhetik als Mittel zur menschlichen Emanzipation in Schillers Werk.
- Analyse der drei Phasen der Französischen Revolution nach Schiller.
- Schillers Kritik an der Schreckensherrschaft und seine Vorstellungen vom idealen Staat.
- Die Verbindung zwischen Schillers ästhetischer Theorie und seiner politischen Philosophie.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Französischen Revolution und Schillers anfängliche Begeisterung für die revolutionären Ideale von Freiheit und Gleichheit, die sich in seinen frühen Dramen widerspiegeln. Sie führt in die Forschungsfrage ein, die sich mit dem Einfluss der Revolution auf Schillers ästhetische Theorie auseinandersetzt und die Struktur der Arbeit skizziert. Die anfängliche Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Revolution wird bereits hier als Ausgangspunkt für die spätere kritische Auseinandersetzung Schillers mit den Ereignissen in Frankreich erwähnt.
2. Französische Revolution in Schillers Augen: Dieses Kapitel unterteilt die Französische Revolution in drei Phasen: die Errichtung der konstitutionellen Monarchie, die Konventsherrschaft und die Phase der Bürgerlichen Republik/Restauration. Es beschreibt Schillers wechselnde Reaktionen auf diese Phasen, von anfänglicher Zurückhaltung und Misstrauen bis hin zu späterer Enttäuschung und Abscheu angesichts der Gewalt und des Terrors. Schillers kritische Auseinandersetzung mit den Ereignissen wird hier als Grundlage für seine spätere Fokussierung auf die ästhetische Erziehung dargestellt, die als Alternative zur gescheiterten politischen Revolution gesehen wird. Die Zusammenfassung der verschiedenen Phasen beinhaltet detaillierte Ausführungen zu Schillers Reaktion auf die Ereignisse. Schillers anfängliche Hoffnung wird im Kontrast zu seinen späteren Enttäuschungen deutlich.
Schlüsselwörter
Französische Revolution, Friedrich Schiller, Ästhetische Erziehung, Freiheit, Gleichheit, Schreckensherrschaft, Notstaat, Vernunftstaat, Politische Philosophie, Ästhetische Theorie, Humanismus, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Der Einfluss der Französischen Revolution auf Friedrich Schillers Ästhetische Theorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Französischen Revolution auf Friedrich Schillers ästhetische Theorie. Sie analysiert seine Kritik an verschiedenen Phasen der Revolution und beleuchtet, wie diese Erfahrungen seine Konzeption der ästhetischen Erziehung prägten. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Schillers politischer und ästhetischer Philosophie im Kontext der revolutionären Ereignisse.
Welche Phasen der Französischen Revolution werden betrachtet?
Die Arbeit unterteilt die Französische Revolution in drei Phasen: die Errichtung der konstitutionellen Monarchie, die Konventsherrschaft und die Phase der Bürgerlichen Republik/Restauration. Schillers Reaktionen auf jede Phase werden detailliert analysiert, von anfänglicher Unterstützung bis hin zu späterer Enttäuschung und Kritik.
Wie beschreibt die Arbeit Schillers anfängliche Haltung zur Französischen Revolution?
Die Arbeit beschreibt Schillers anfängliche Begeisterung für die revolutionären Ideale von Freiheit und Gleichheit, die sich in seinen frühen Dramen widerspiegelt. Diese anfängliche Hoffnung auf eine positive Entwicklung bildet den Ausgangspunkt für die spätere kritische Auseinandersetzung mit den Ereignissen.
Welche Rolle spielt die ästhetische Erziehung in Schillers Denken nach den Erfahrungen mit der Revolution?
Die Arbeit argumentiert, dass Schillers kritische Auseinandersetzung mit der Gewalt und dem Terror der Französischen Revolution ihn zu einer Fokussierung auf die ästhetische Erziehung als Alternative zur gescheiterten politischen Revolution führte. Die Ästhetik wird als Mittel zur menschlichen Emanzipation betrachtet.
Wie wird Schillers Kritik an der Französischen Revolution dargestellt?
Schillers Kritik konzentriert sich auf die Schreckensherrschaft und die Abweichung von den ursprünglichen Idealen der Revolution. Die Arbeit analysiert seine Vorstellungen vom idealen Staat und die Verbindung zwischen seiner ästhetischen und politischen Philosophie im Kontext der revolutionären Ereignisse.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte umfassen die Französische Revolution, Friedrich Schiller, ästhetische Erziehung, Freiheit, Gleichheit, Schreckensherrschaft, Notstaat, Vernunftstaat, politische Philosophie, ästhetische Theorie, Humanismus und Aufklärung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Französische Revolution in Schillers Augen (unterteilt in drei Unterkapitel zu den verschiedenen Phasen der Revolution), ein Kapitel über die Reflexion über die Niederlage der Französischen Revolution in Schillers Schrift “Über die ästhetische Erziehung des Menschen” (mit Unterkapiteln zu Spannungsfeld zwischen Revolution und Freiheit, Gesellschaftsbild und Schreckensherrschaft sowie Notstaat/Naturstaat und Vernunftstaat), ein Kapitel zu Schillers ästhetischer Konzeption und ein Fazit.
- Arbeit zitieren
- Xu Li (Autor:in), 2015, Schillers ästhetische Reflexion zur Französischen Revolution, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304473