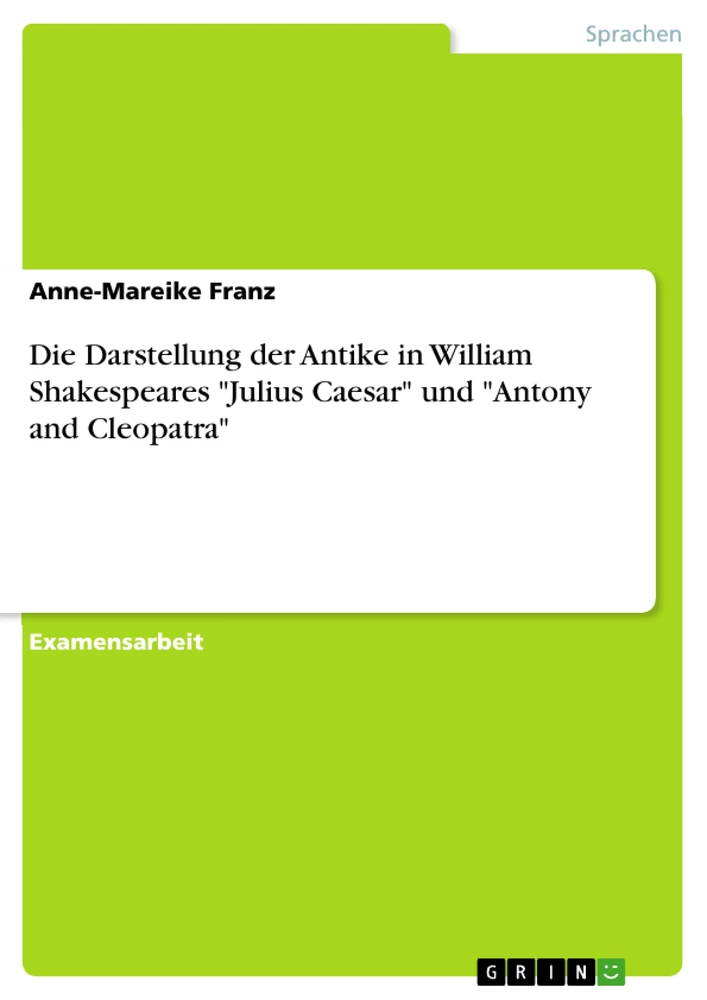Die folgende Darstellung wird sich aufgrund der chronologischen Nähe der Geschehnisse und der starken politischen und sozialen Kontraste auf die Tragödien Julius Caesar und Antony Cleopatra konzentrieren, jedoch wird der Schwerpunkt nicht auf einer reinen Sachanalyse der Werke liegen. Vielmehr wird das von Shakespeare entworfene Bild der Antike zur Zeit des Umbruchs von der Römischen Republik zur Monarchie von zentraler Bedeutung sein. Hierbei ist vor allem die Sorgfalt und Faktentreue Shakespeares zu betrachten. Um den Vorwurf bewerten und diskutieren zu können, Shakespeares römische Figuren seien lediglich „Elizabethans in disguise“ (Cantor, S.7), ist zunächst ein Vergleich mit den üblichen Maßstäben der elisabethanischen Historiographie und den vorhandenen historischen Quellen notwendig. Des weiteren ist zu klären, welchen Einfluss nun die eigene Wirklichkeit Shakespeares auf die Darstellung der Figuren und Ereignisse in den beiden Roman Plays hatte. Aber auch, welche Parallelen in der römischen und elisabethanischen Wirklichkeit in Bezug auf politische, soziale und religiöse Sachverhalte zu finden sind. Auch die Person Shakespeares wird von Bedeutung sein, um zu erörtern, inwiefern die Behandlung antiker Themen dazu beitrug, dass sich ein „Normalsterblicher“ aus der Mittelschicht eine Stellung in der eigenen Kultur seiner Zeit erarbeitete, in der er den ehrwürdigen Vergleich durch seine Zeitzeugen mit antiken Größen wie Sokrates nicht scheuen musste.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Bedeutung der Antike in der Renaissance
- 1. Die Wiedergeburt der Antike durch den Humanismus
- 1.1 In der Literatur
- 1.2 In Kunst und Architektur
- 1.3 Patriotische Bestrebungen versus Antikes Erbe
- 2. Römische Geschichte als Exemplum
- 2.1 Römische Wertvorstellungen als civil guidance
- 2.2 Militärische Taktiken als Lehrbuch britischer Herrscher
- 2.3 Römische Machthaber und das Wheel of Fortune
- 1. Die Wiedergeburt der Antike durch den Humanismus
- III Elisabethanische Historiographie
- 1. Wahrheitsempfinden der Elisabethanischen Historiographen
- 1.1 Die Chronisten der Tudors
- 1.2 Legitimation Englands als Erbe Roms
- 2. Shakespeares Quellen
- 2.1 Shakespeares Bildung
- 2.2 Shakespeares Zugang zu antiken Stoffen
- 2.3 Shakespeare und Plutarch
- 2.3.1 Parallelen und Änderungen bei Julius Caesar
- 2.3.2 Parallelen und Änderungen bei Antony and Cleopatra
- 1. Wahrheitsempfinden der Elisabethanischen Historiographen
- IV Shakespeares politisch-historische Doppelperspektive
- 1. Vergangenheitsbezogene Dimension
- 1.1 Das Ende der römischen Republik – Suche nach der idealen Staatsform
- 1.1.1 Verfall römischer Tugenden
- 1.1.2 Das Scheitern der Demokratie
- 1.2 Der Anfang des Römischen Imperiums – Suche nach Stabilität
- 1.2.1 Flucht aus dem öffentlichen Leben
- 1.2.2 Ziele und Chancen des Individuums in der Monarchie
- 1.2.3 Vergleich Rom und Ägypten
- 1.3 Einfluss der römischen Wertvorstellungen
- 1.3.1 Römische „virtus“ versus „ambitio“
- 1.3.2 Römische Freundschaft
- 1.3.3 Römische Vorstellungen von Ehe und Liebe
- 1.3.3.1 Caesar und Calpurnia
- 1.3.3.2 Brutus und Portia
- 1.3.3.3 Antony und Octavia
- 1.3.3.4 Antony und Cleopatra
- 1.3.4 Römischer Suizid und Jenseitsvorstellungen
- 1.4 Repräsentanten unterschiedlicher römischer Lebensvorstellungen
- 1.4.1 Julius Caesar - der gottgleiche Imperator
- 1.4.2 Brutus der Idealist?
- 1.4.3 Cassius - der Revolutionär
- 1.4.4 Antonius – der gescheiterte Feldherr und Liebhaber
- 1.4.5 Octavian - Caesars Erbe
- 1.5 Stellung der Frau in der antiken Welt
- 1.5.1 Portia
- 1.5.2 Calpurnia
- 1.5.3 Octavia
- 1.5.4 Cleopatra
- 1.1 Das Ende der römischen Republik – Suche nach der idealen Staatsform
- 2. Gegenwartsbezogene Dimension
- 2.1 Anachronismen
- 2.2 Parallelen römischer und elisabethanischer Lebenssituationen
- 2.2.1 Monarchie als ideale Staatsform
- 2.2.2 Ethische Kontroversen und Religionskonflikte
- 2.2.3 Einfluss der Bevölkerung
- 2.2.4 Machtkämpfe am Hof – Rebellion oder Anpassung?
- 2.2.5 Der Status der Frau
- 2.2.6 Antikes Ägypten und Elizabethan Theatre
- 2.3 Das Goldene Zeitalter Großbritanniens
- 2.3.1 Blüte der Literatur – Ein Scheinfrieden?
- 2.3.2 James I. als Personifikation des Augustus?
- 1. Vergangenheitsbezogene Dimension
- V Bedeutung der Werke für den Literaten Shakespeare
- 1. Stellung der beiden Stücke in seinem Lebenswerk
- 2. Lenkung der Rezeption des Publikums
- 3. Verwendung von Zeit
- 3.1 zeitliche Raffungen in den Dramen
- 3.2 Manipulation des Zeitbegriffs
- 3.3 Festhalten der Zeit - Kampf gegen die Vergessenheit?
- VI Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Antike in Shakespeares „Julius Caesar“ und „Antony and Cleopatra“. Ziel ist es, Shakespeares politisch-historische Doppelperspektive zu analysieren und die Parallelen zwischen der römischen und elisabethanischen Welt aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet, wie Shakespeare antike Stoffe nutzte, um zeitgenössische Themen zu reflektieren.
- Shakespeares Verwendung antiker Quellen und deren Adaption
- Parallelen zwischen der römischen und elisabethanischen Gesellschaft
- Die Rolle der Frauen in beiden Gesellschaften
- Shakespeares politisches und historisches Bewusstsein
- Der Einfluss des Humanismus auf Shakespeares Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Shakespeares Grabstein, das die Bedeutung des antiken Erbes für den elisabethanischen Kontext hervorhebt. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Umgang elisabethanischer Gelehrter mit der Antike und Shakespeares Rolle darin. Die Einleitung führt die „Roman Plays“ ein und kündigt die Fokussierung auf „Julius Caesar“ und „Antony and Cleopatra“ an, mit dem Ziel, Shakespeares Bild der Antike und dessen Genauigkeit zu untersuchen. Der Vergleich mit elisabethanischer Geschichtsschreibung und die Erforschung der Parallelen zwischen römischer und elisabethanischer Realität werden als weitere Schwerpunkte genannt.
II Bedeutung der Antike in der Renaissance: Dieses Kapitel beschreibt die Wiederentdeckung der Antike während der Renaissance, insbesondere durch den Humanismus. Es beleuchtet den Einfluss antiker Literatur, Kunst und Architektur auf die Renaissance und untersucht den Gebrauch römischer Geschichte als Exemplum für elisabethanische Herrscher. Der Fokus liegt auf der Nutzung römischer Wertvorstellungen, militärischer Taktiken und des Schicksals der römischen Machthaber als Lehrstücke.
III Elisabethanische Historiographie: Dieses Kapitel analysiert die elisabethanische Geschichtsschreibung, ihren Wahrheitsanspruch und die Legitimation Englands als Erbe Roms. Es untersucht Shakespeares Quellen, seine Bildung und seinen Zugang zu antiken Stoffen, insbesondere seine Nutzung von Plutarchs Werken und die damit verbundenen Parallelen und Änderungen in „Julius Caesar“ und „Antony and Cleopatra“.
IV Shakespeares politisch-historische Doppelperspektive: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es untersucht Shakespeares Darstellung der römischen Geschichte aus einer doppelten Perspektive – der vergangenheitsbezogenen und der gegenwartsbezogenen Dimension. Die vergangenheitsbezogene Dimension analysiert den Übergang von der römischen Republik zum Imperium, den Verfall römischer Tugenden, das Scheitern der Demokratie und die Suche nach Stabilität unter der Monarchie. Die gegenwartsbezogene Dimension sucht nach Anachronismen und Parallelen zwischen der römischen und der elisabethanischen Zeit, inklusive der Betrachtung von Monarchie, ethischen Kontroversen, Religionskonflikten, Machtkämpfen und dem Status der Frau.
V Bedeutung der Werke für den Literaten Shakespeare: Dieses Kapitel untersucht die Stellung der beiden Stücke in Shakespeares Gesamtwerk, die Lenkung der Rezeption durch Shakespeare und seine Manipulation des Zeitbegriffs in den Dramen. Es analysiert Shakespeares Umgang mit Zeitraffungen und die Frage, ob sein Festhalten an der Zeit als Kampf gegen die Vergessenheit verstanden werden kann.
Schlüsselwörter
Shakespeare, Antike, Renaissance, Humanismus, Römische Republik, Römisches Imperium, Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Elisabethanische Historiographie, Plutarch, politische Doppelperspektive, Parallelen, Anachronismen, römische Wertvorstellungen, Status der Frau, Machtkampf, Monarchie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Shakespeares politisch-historische Doppelperspektive in Julius Caesar und Antony and Cleopatra"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Shakespeares Darstellung der Antike in seinen Stücken "Julius Caesar" und "Antony and Cleopatra". Der Fokus liegt auf Shakespeares politisch-historischer Doppelperspektive und den Parallelen zwischen der römischen und elisabethanischen Welt. Es wird untersucht, wie Shakespeare antike Stoffe nutzte, um zeitgenössische Themen zu reflektieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Shakespeares Verwendung antiker Quellen und deren Adaption; Parallelen zwischen römischer und elisabethanischer Gesellschaft; die Rolle der Frauen in beiden Gesellschaften; Shakespeares politisches und historisches Bewusstsein; und der Einfluss des Humanismus auf Shakespeares Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Bedeutung der Antike in der Renaissance, Elisabethanische Historiographie, Shakespeares politisch-historische Doppelperspektive, Bedeutung der Werke für den Literaten Shakespeare und Schlussfolgerung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Umgang elisabethanischer Gelehrter mit der Antike und Shakespeares Rolle darin. Sie führt die "Roman Plays" ein und kündigt die Fokussierung auf "Julius Caesar" und "Antony and Cleopatra" an, mit dem Ziel, Shakespeares Bild der Antike und dessen Genauigkeit zu untersuchen. Der Vergleich mit elisabethanischer Geschichtsschreibung und die Erforschung der Parallelen zwischen römischer und elisabethanischer Realität werden als weitere Schwerpunkte genannt.
Worum geht es im Kapitel "Bedeutung der Antike in der Renaissance"?
Dieses Kapitel beschreibt die Wiederentdeckung der Antike während der Renaissance, insbesondere durch den Humanismus. Es beleuchtet den Einfluss antiker Literatur, Kunst und Architektur und untersucht den Gebrauch römischer Geschichte als Exemplum für elisabethanische Herrscher. Der Fokus liegt auf der Nutzung römischer Wertvorstellungen, militärischer Taktiken und des Schicksals der römischen Machthaber als Lehrstücke.
Was wird im Kapitel "Elisabethanische Historiographie" analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die elisabethanische Geschichtsschreibung, ihren Wahrheitsanspruch und die Legitimation Englands als Erbe Roms. Es untersucht Shakespeares Quellen, seine Bildung und seinen Zugang zu antiken Stoffen, insbesondere seine Nutzung von Plutarchs Werken und die damit verbundenen Parallelen und Änderungen in "Julius Caesar" und "Antony and Cleopatra".
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Shakespeares politisch-historische Doppelperspektive"?
Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es untersucht Shakespeares Darstellung der römischen Geschichte aus einer doppelten Perspektive – der vergangenheitsbezogenen und der gegenwartsbezogenen Dimension. Die vergangenheitsbezogene Dimension analysiert den Übergang von der römischen Republik zum Imperium, den Verfall römischer Tugenden, das Scheitern der Demokratie und die Suche nach Stabilität unter der Monarchie. Die gegenwartsbezogene Dimension sucht nach Anachronismen und Parallelen zwischen der römischen und der elisabethanischen Zeit, inklusive der Betrachtung von Monarchie, ethischen Kontroversen, Religionskonflikten, Machtkämpfen und dem Status der Frau.
Was ist das Thema des Kapitels "Bedeutung der Werke für den Literaten Shakespeare"?
Dieses Kapitel untersucht die Stellung der beiden Stücke in Shakespeares Gesamtwerk, die Lenkung der Rezeption durch Shakespeare und seine Manipulation des Zeitbegriffs in den Dramen. Es analysiert Shakespeares Umgang mit Zeitraffungen und die Frage, ob sein Festhalten an der Zeit als Kampf gegen die Vergessenheit verstanden werden kann.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Shakespeare, Antike, Renaissance, Humanismus, Römische Republik, Römisches Imperium, Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Elisabethanische Historiographie, Plutarch, politische Doppelperspektive, Parallelen, Anachronismen, römische Wertvorstellungen, Status der Frau, Machtkampf, Monarchie.
- Quote paper
- Anne-Mareike Franz (Author), 2008, Die Darstellung der Antike in William Shakespeares "Julius Caesar" und "Antony and Cleopatra", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304569