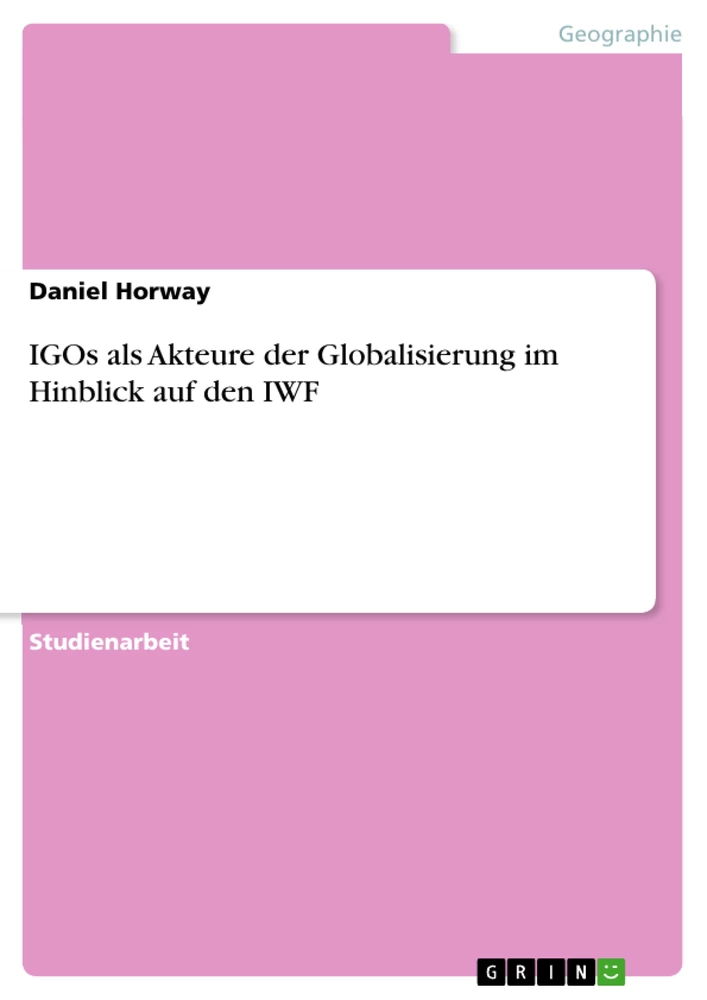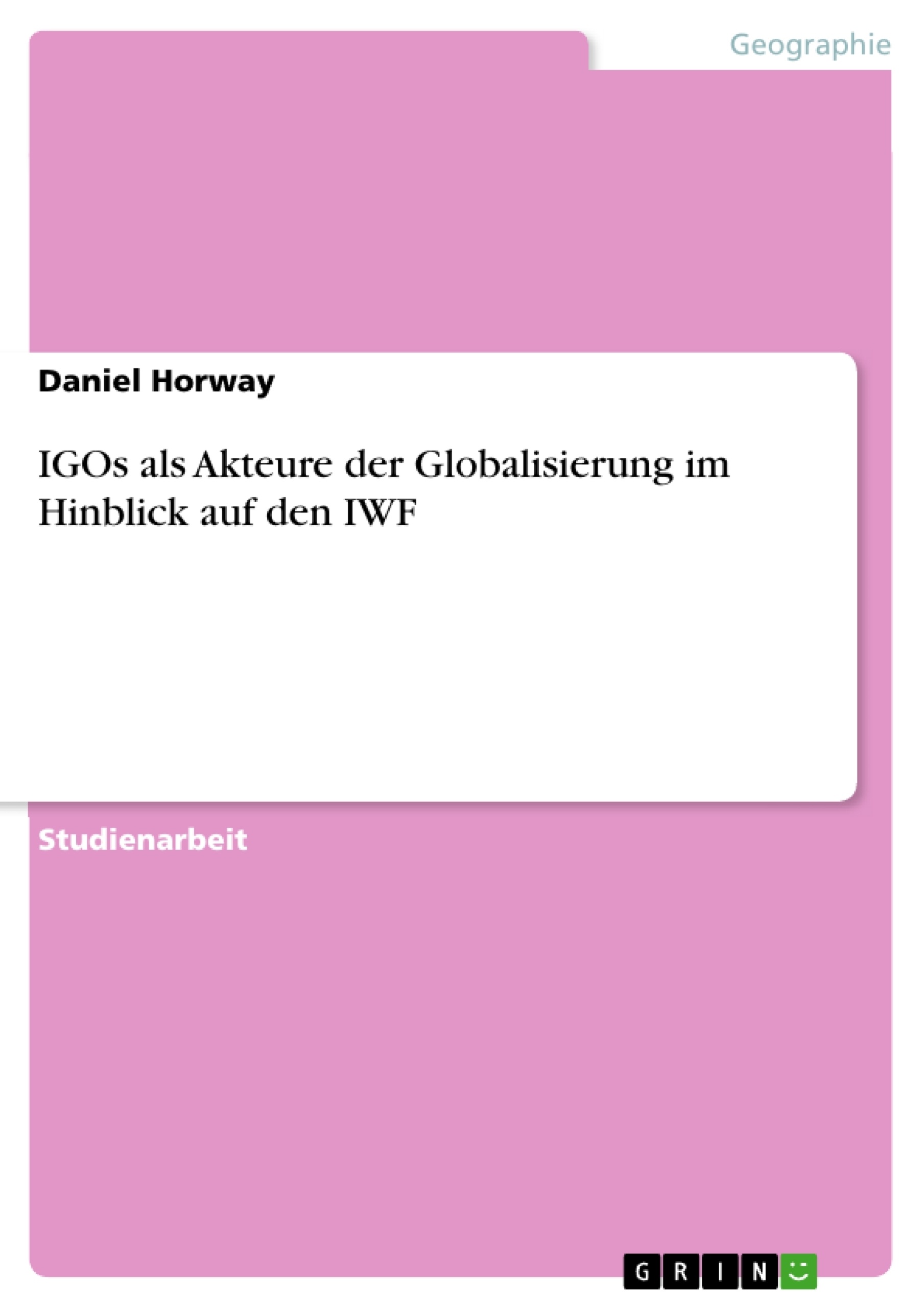Als Ausgangspunkt dieser Ausarbeitung dient die Annahme, dass „Die Globalisierung“ weder als Prozess noch als Zustand hinreichend beschrieben werden kann. Grund dafür ist die schiere Komplexität und das Unvermögen eindeutige Grenzen oder gar Definitionen zu formulieren. Diese mangelnde Trennschärfe scheint jedoch den Kern der Globalisierungsidee zu kennzeichnen. Taylor, Watts und Johnston sprechen von einem „fließenden, flexiblen Konzept“, dass von der Vernetzung der Auslöser, Triebkräfte und Teilnehmern sowie der Ausweitung auf „nahezu alle Bereiche des modernen Lebens“ lebt. Um das Phänomen dennoch beschreiben zu können, müssen die einzelnen Bauteile gesondert analysiert werden. Zu diesem Zweck wird im Folgenden lediglich ein Aspekt herausgegriffen und näher ausgeführt.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Akteur der Globalisierung, sogenannte „Intergovernmental Organizations“ (IGOs) zu untersuchen und deren Beitrag zum Gesamtkonzept der Globalisierung zu beschreiben. Zu diesem Zweck sollen zunächst die Rolle und Bedeutung von IGOs im internationalen Kontext und deren Einflussbereiche beschrieben werden. Worin liegen beispielsweise die Existenzberechtigung und der Vorteil von IGOs und wie wichtig sind sie dadurch auf globaler Ebene?
Im Fokus der Analyse steht der Internationale Währungsfond (IWF) als eine der wichtigsten zwischenstaatlichen Organisationen. In diesem Zusammenhang werden Fragen nach Gerechtigkeit und globaler Machtausübung behandelt. Wie valide ist beispielsweise die Agenda des IWF und wie hoch ist das Reformbedürfnis seiner Mittel und Strategien? Außerdem dient der IWF dazu, die grundlegenden Vorgehensweisen, Organisationsformen und vor allem Probleme vieler IGOs aufzuzeigen wobei an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden muss, dass die exemplarische Funktion und somit eine Generalisierung der Charakteristika des IWF nur bedingt möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Globalisierung ein unscharfes Konzept
- Die Akteure der Globalisierung
- Die Rolle von IGOs im „Global Governance“
- IGOS und die Säulen der Globalisierung
- Diversität von IGOs in Zusammensetzung und Zielvorstellungen
- Der Internationale Währungsfonds (IWF)
- Gründungsmotive
- Die Agenda des IWF
- Strukturanpassungsprogramme (SAPS)
- Konditionalität von SAPS
- Die konkrete Auflagenpolitik von SAPS
- Der IWF in der Kritik
- Auswirkungen von SAPs auf die Programmländer
- Die Ideologische Krise des IWF
- Organisation des IWF
- Reformbedürfnisse
- IGOs, die Weichen der Globalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Intergovernmental Organizations (IGOs) als Akteure der Globalisierung, wobei der Internationale Währungsfonds (IWF) als Beispiel dient. Ziel ist es, die Bedeutung von IGOs im internationalen Kontext, ihre Einflussbereiche und ihre Rolle im „Global Governance“ zu analysieren. Dabei werden die Agenda des IWF, die Auswirkungen seiner Strukturanpassungsprogramme (SAPS) und die Kritik an seiner Ideologie und Organisation beleuchtet.
- Die Bedeutung von IGOs im „Global Governance“
- Die Agenda des IWF und seine Auswirkungen
- Die Kritik an der Ideologie und Organisation des IWF
- Der Einfluss von IGOs auf die Globalisierung
- Das Konzept der Globalisierung und seine Unschärfe
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das unscharfe Konzept der Globalisierung und die Notwendigkeit, die einzelnen Aspekte des Phänomens separat zu analysieren. Das zweite Kapitel widmet sich den Akteuren der Globalisierung, wobei der Fokus auf die Rolle von IGOs liegt. Es werden die Vorteile von IGOs im Vergleich zu Nationalstaaten und transnationalen Unternehmen sowie ihre Bedeutung im „Global Governance“ herausgestellt. Das dritte Kapitel behandelt den IWF als Beispiel für eine wichtige zwischenstaatliche Organisation. Die Gründungsmotive, die Agenda des IWF und die Auswirkungen seiner SAPS werden beleuchtet. Das vierte Kapitel analysiert die Kritik am IWF, die sich auf die Auswirkungen seiner SAPS, die ideologische Krise und die Organisation des IWF bezieht. Das fünfte Kapitel fasst die Bedeutung von IGOs als Weichen der Globalisierung zusammen.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Intergovernmental Organizations (IGOs), Internationaler Währungsfonds (IWF), Global Governance, Strukturanpassungsprogramme (SAPS), Konditionalität, Kritik, Reformbedürfnisse, Macht, Kapital, Einfluss, Regulation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Intergovernmental Organizations (IGOs)?
IGOs sind zwischenstaatliche Organisationen, die von Nationalstaaten gegründet wurden, um globale Aufgaben zu koordinieren und Regeln im internationalen System festzulegen.
Welche Rolle spielt der IWF in der Globalisierung?
Der Internationale Währungsfonds (IWF) agiert als zentraler Akteur zur Sicherung der globalen Finanzstabilität, wird aber auch als Instrument zur Durchsetzung westlicher Wirtschaftspolitik kritisiert.
Was sind Strukturanpassungsprogramme (SAPs)?
SAPs sind Kredite des IWF, die an strenge wirtschaftspolitische Auflagen (Konditionalität) geknüpft sind, um Krisenländer zu reformieren.
Warum wird der IWF oft kritisiert?
Kritikpunkte sind die mangelnde demokratische Legitimation, soziale Härten durch Sparauflagen in Programmländern und eine ideologische Einseitigkeit.
Was versteht man unter „Global Governance“?
Es bezeichnet das Zusammenwirken von Staaten und IGOs, um globale Probleme (wie Finanzkrisen oder Handel) jenseits eines Weltstaates zu regulieren.
- Quote paper
- Daniel Horway (Author), 2014, IGOs als Akteure der Globalisierung im Hinblick auf den IWF, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304602