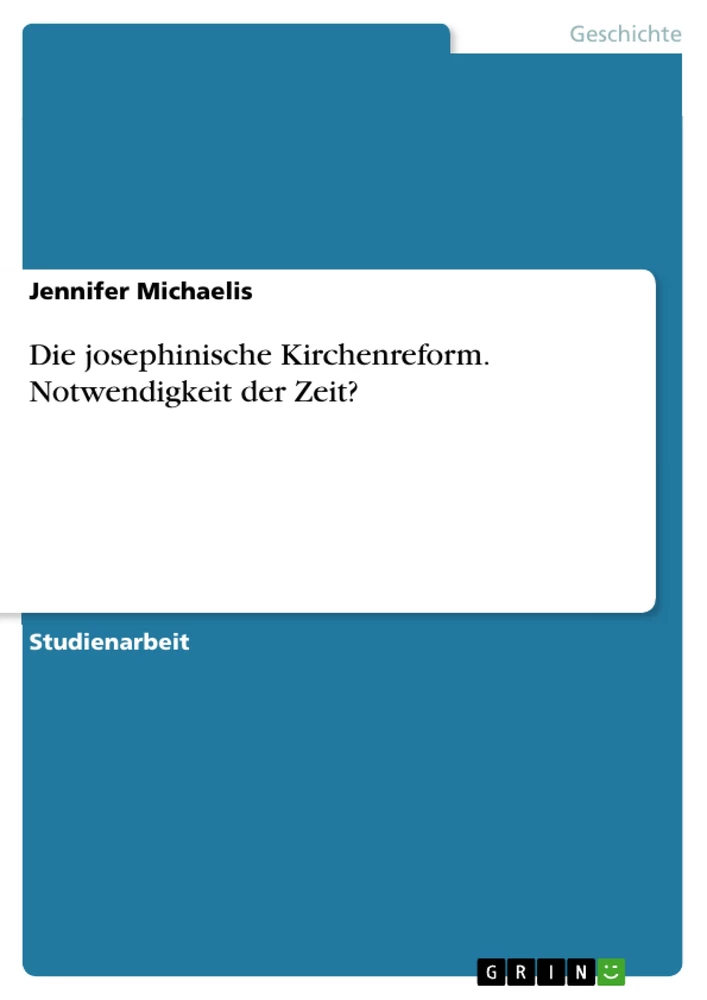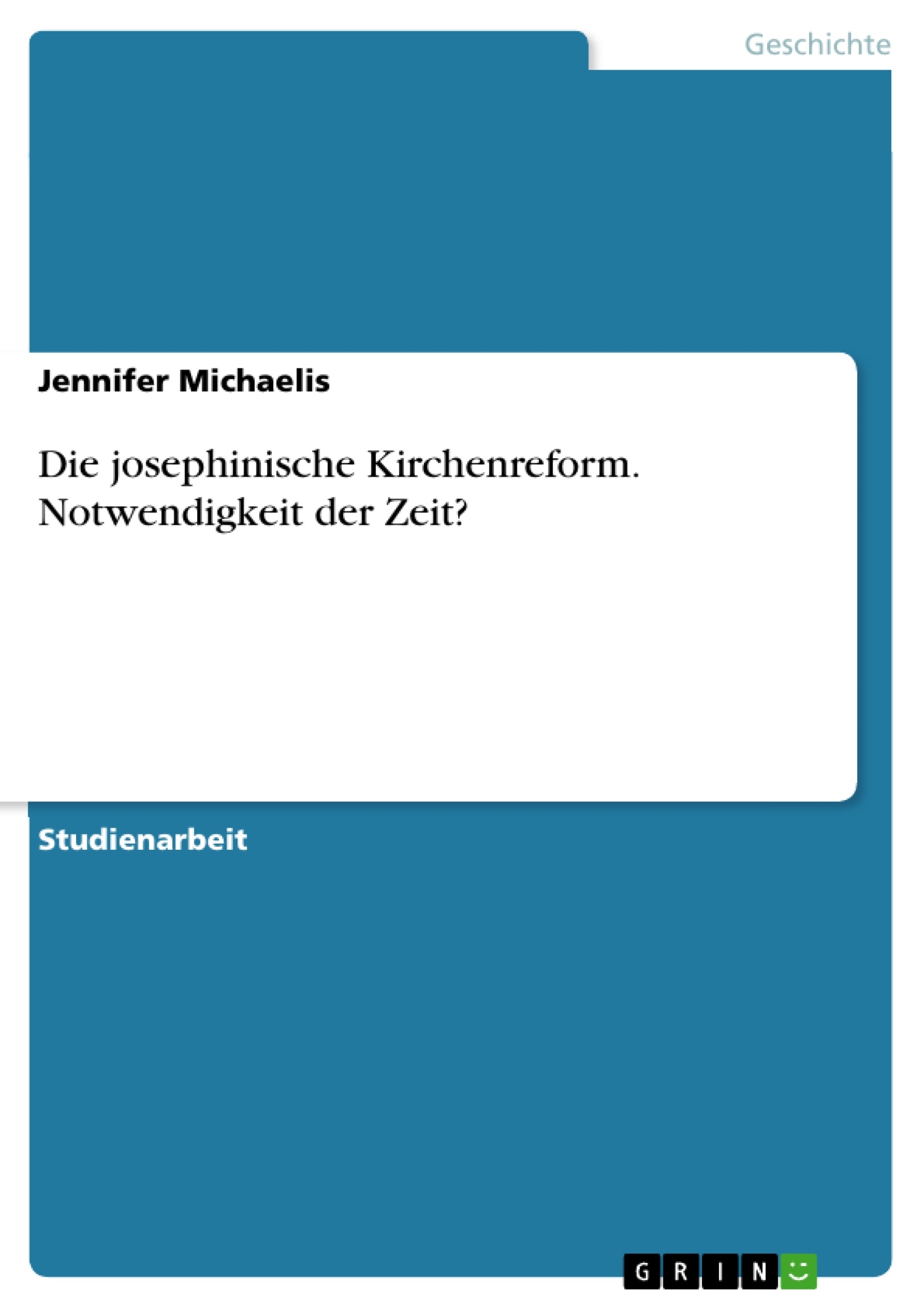Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Thematik des Josephinismus mit dem Schwerpunkt auf die Regierungszeit Kaiser Josephs II., auf dessen Namen das System dieser Staatskirchenpolitik zurückgeht. Mit diesem System wird eine konsequente Unterordnung gesellschaftlicher Angelegenheiten unter die staatliche Verwaltung nach den Prinzipien des aufgeklärten Absolutismus gemeint.
Auch in Religionsangelegenheiten galten die am Staat orientierten Prinzipien Zentralismus, Autorität, aber auch Toleranz. Hierbei soll vor allem die Frage im Mittelpunkt stehen, ob die hier in erster Linie behandelte josephinische Kirchenreform eine Notwendigkeit der Zeit darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Staatskirchentum des Vorjosephinismus
- Joseph II. und seine Kirchenpolitik
- Die Neuregulierung der Pfarreien
- Die Aufhebung der Klöster
- Die Reform des Gottesdienstes
- Der Nachjosephinismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Josephinismus, insbesondere die Kirchenpolitik Kaiser Josephs II. Ziel ist es zu analysieren, ob die josephinische Kirchenreform eine Notwendigkeit der Zeit darstellte. Dazu wird der Vorjosephinismus betrachtet und die Umsetzung der Kirchenpolitik Josephs II. anhand der Neuregulierung der Pfarreien, der Klosteraufhebung und der Gottesdienstreform beleuchtet. Die Nachwirkungen der Reformen werden ebenfalls betrachtet.
- Die Entwicklung des Staatskirchentums vor und während der Regierungszeit Josephs II.
- Die josephinischen Kirchenreformen und ihre Motive.
- Die Rolle des aufgeklärten Absolutismus in der Kirchenpolitik.
- Widerstände und Folgen der Reformen.
- Der Vergleich der Regierungsweise Josephs II. mit anderen absolutistischen Herrschern.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Diese Einführung erläutert das Thema der Arbeit: die Analyse der josephinischen Kirchenreform und die Frage nach ihrer Notwendigkeit. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der den Vorjosephinismus, die Reformen Josephs II. (Pfarreien, Klöster, Gottesdienst) und den Nachjosephinismus umfasst. Die divergierenden Einschätzungen der Person und der Regierungsführung Josephs II. werden ebenfalls angesprochen, wobei sein Bestreben zur Schaffung einer Nationalkirche innerhalb des österreichischen Territoriums hervorgehoben wird.
2. Das Staatskirchentum des Vorjosephinismus: Dieses Kapitel beschreibt das vorherrschende System vor dem Josephinismus. Es thematisiert Reformbewegungen der Aufklärung im Habsburgerreich und deren zeitliche Verzögerung im Vergleich zu Westeuropa. Das Kapitel beleuchtet die ersten Ansätze des Josephinismus in der Lombardei mit der Giunta Economale als erster staatlicher Behörde zur Regulierung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Es wird die Rolle Maria Theresias bei der Zentralisierung des österreichischen Staates und ersten Reformen, wie der Reduktion des Klerus und der Unterdrückung der Jesuiten, dargestellt. Der Einfluss papstfeindlichen Geschichtsunterrichts und Rechtsauffassungen auf Joseph II. wird ebenfalls angesprochen.
3. Joseph II. und seine Kirchenpolitik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kirchenpolitik Josephs II. und dessen Zielen der Zentralisierung und der Unterordnung der Kirche unter den Staat. Es werden Zitate aus den „Rêveries“ Josephs II. präsentiert, die seine politischen Vorstellungen und Methoden zur Stärkung des Staates verdeutlichen. Die Kapitel behandeln die Abschaffung von Privilegien des Adels und der Kirche, das Toleranzedikt von 1781 und die damit verbundene Gleichstellung nicht-katholischer Konfessionen (jedoch mit Einschränkungen), sowie die besondere Behandlung der Juden. Die durch die Reformen ausgelösten Unruhen in der Bevölkerung, insbesondere durch Steuer- und Agrarreformen und das Rekrutierungssystem, werden erwähnt. Die Klosterreform als Höhepunkt der Maßnahmen zur Schwächung der kirchlichen Macht wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Josephinismus, Kirchenreform, aufgeklärter Absolutismus, Kaiser Joseph II., Staatskirchentum, Vorjosephinismus, Nachjosephinismus, Zentralismus, Toleranz, Klosteraufhebung, Pfarreien, Gottesdienst, Maria Theresia, Toleranzedikt, Nationalkirche.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Josephinismus"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Josephinismus, insbesondere die Kirchenpolitik Kaiser Josephs II., und untersucht, ob diese Reform eine Notwendigkeit ihrer Zeit darstellte. Die Analyse umfasst den Zeitraum vor, während und nach der Regierungszeit Josephs II. und beleuchtet verschiedene Aspekte der Kirchenreformen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Staatskirchentums vor und während der Regierungszeit Josephs II., die Motive der josephinischen Kirchenreformen, die Rolle des aufgeklärten Absolutismus, Widerstände und Folgen der Reformen sowie einen Vergleich der Regierungsweise Josephs II. mit anderen absolutistischen Herrschern. Konkrete Beispiele sind die Neuregulierung der Pfarreien, die Aufhebung der Klöster und die Reform des Gottesdienstes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zum Staatskirchentum vor dem Josephinismus, ein Kapitel zur Kirchenpolitik Josephs II. (inkl. Pfarreien, Klöster und Gottesdienst), ein Kapitel zum Nachjosephinismus und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung der jeweiligen Themen.
Was wird im Kapitel zum Vorjosephinismus behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt das bestehende System vor den Reformen Josephs II., beleuchtet Reformbewegungen der Aufklärung im Habsburgerreich und deren zeitliche Verzögerung im Vergleich zu Westeuropa. Es wird die Rolle Maria Theresias und die ersten Ansätze des Josephinismus in der Lombardei mit der Giunta Economale erörtert.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über Joseph II. und seine Kirchenpolitik?
Dieses Kapitel analysiert die Kirchenpolitik Josephs II. mit dem Ziel der Zentralisierung und Unterordnung der Kirche unter den Staat. Es werden Zitate aus seinen "Rêveries" verwendet und die Abschaffung von Privilegien, das Toleranzedikt von 1781, die Behandlung nicht-katholischer Konfessionen und Juden sowie die Auswirkungen der Reformen auf die Bevölkerung (Unruhen durch Steuer-, Agrar- und Rekrutierungsreformen) behandelt. Die Klosteraufhebung wird als Höhepunkt der Maßnahmen zur Schwächung der Kirche hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Josephinismus, Kirchenreform, aufgeklärter Absolutismus, Kaiser Joseph II., Staatskirchentum, Vorjosephinismus, Nachjosephinismus, Zentralismus, Toleranz, Klosteraufhebung, Pfarreien, Gottesdienst, Maria Theresia, Toleranzedikt, Nationalkirche.
Welche zentrale Frage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: War die josephinische Kirchenreform eine Notwendigkeit der Zeit?
Welche Quellen werden verwendet? (Hinweis: Diese Frage kann nicht aus dem gegebenen Text beantwortet werden.)
Die verwendeten Quellen sind im Text nicht explizit aufgeführt. Weitere Informationen dazu sind in der vollständigen Arbeit zu finden.
- Quote paper
- Jennifer Michaelis (Author), 2014, Die josephinische Kirchenreform. Notwendigkeit der Zeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304632