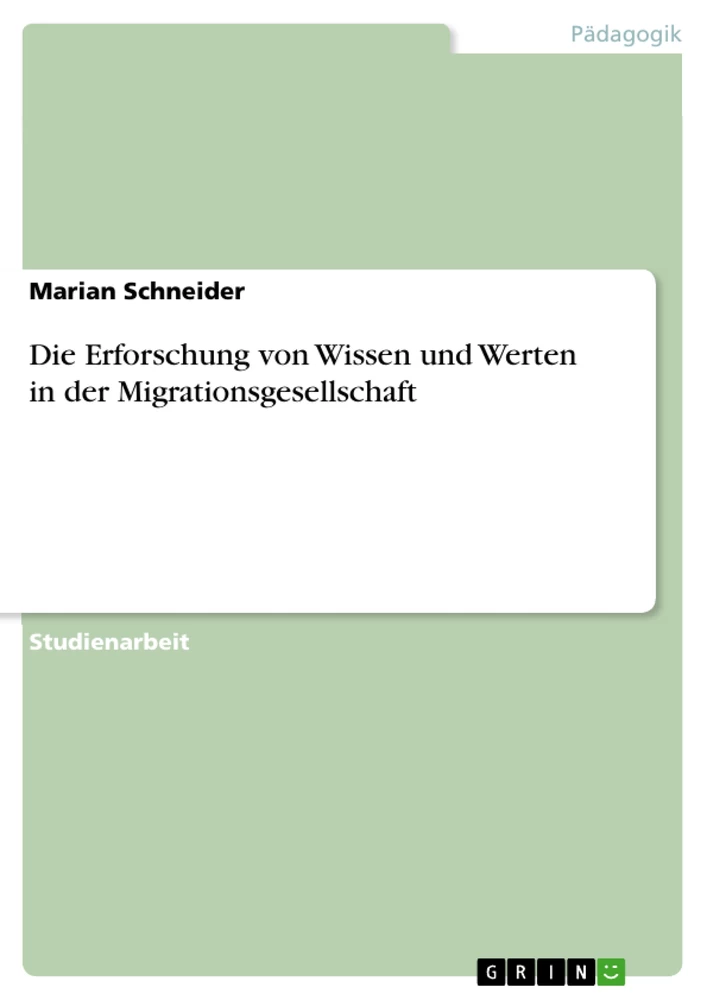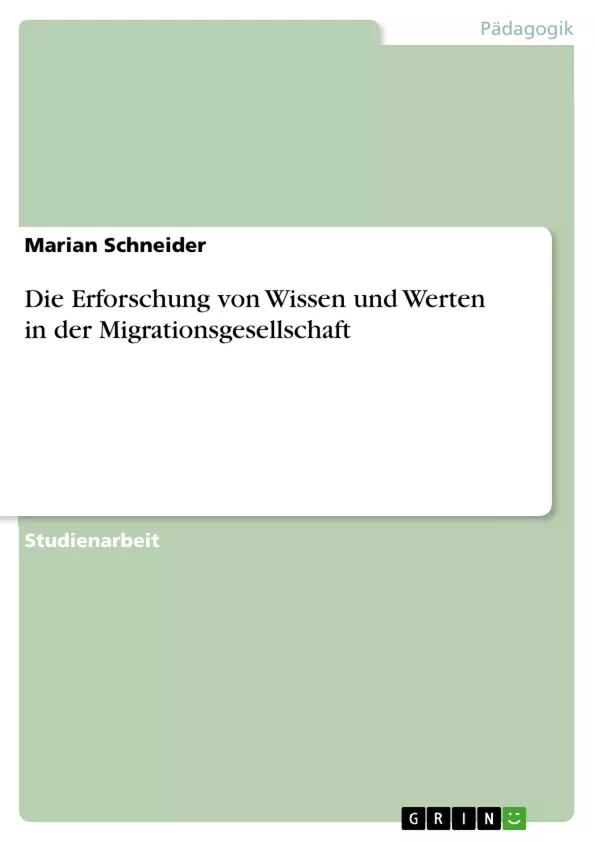Die internationalen Migrationsbewegungen provozieren eine Transformation globaler Gesellschaften zu Migrationsgesellschaften. Dieser Prozess hat nicht nur einen Einfluss auf diejenigen, die in der Zielregion leben, sondern betrifft auch die Migrierenden selbst. Somit verlangt und ermöglicht ein Leben in einer Migrationsgesellschaft, andere Lebensweisen und Stile kennenzulernen, sich immer wieder in neuen Kontexten zu orientieren und über selbst gesetzte Grenzen hinauszudenken. Zudem bedingt das Zusammenleben kultureller Vielfalten eine bestimmte Organisation von Wissen und Zusammenführung von Werten.
In dieser Seminararbeit wird untersucht, wie eine Organisation von Wissen und bestimmter Werte in dem für die Migrationsgesellschaft repräsentativen Forschungsfeld der ‚Migrantenfamilie‘ erfolgt. Anhand der Darstellung von Strukturen und Geschlechterdifferenzen in Migrationsfamilien soll ein Rahmen geschaffen werden, der eine anschließende Analyse von intergenerationellen Weitergabeprozessen von Wissen und Werten ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Migrationsgesellschaft
- Zum Begriff „Migrationsgesellschaft“
- Die Strukturen und Geschlechterdifferenzen in Migrationsfamilien
- Die Forschung von Wissen und Werten in Migrationsfamilien
- Zu den Begriffen „Wissen“ und „Werte“
- Die Forschung von Wissen und Werten
- Die Herausforderungen für pädagogische Organisationen
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Organisation von Wissen und Werten in Migrationsfamilien, insbesondere im Kontext des Forschungsfeldes „Migrantenfamilie“. Sie analysiert die Strukturen und Geschlechterdifferenzen innerhalb dieser Familien, um einen Rahmen für die Untersuchung intergenerationeller Weitergabeprozesse von Wissen und Werten zu schaffen. Die Arbeit integriert die dokumentarische Methode von Karl Mannheim, um einen Ansatz zur Versprachlichung von implizitem Wissen zu entwickeln und so eine Optimierungsmöglichkeit des intergenerationellen Transmissionsprozesses von Wissen vorzustellen. Darüber hinaus wird mithilfe eines Orientierungsmusters von Ralf Bohnsack geprüft, welchen Normen und Habitus einer Orientierung der nachfolgenden Generation zugrunde liegen. Schließlich werden die Herausforderungen einer Migrationsgesellschaft für pädagogische Organisationen abgeleitet und erläutert.
- Analyse der Organisation von Wissen und Werten in Migrationsfamilien
- Untersuchung der Strukturen und Geschlechterdifferenzen in Migrationsfamilien
- Integration der dokumentarischen Methode von Karl Mannheim zur Versprachlichung von implizitem Wissen
- Anwendung eines Orientierungsmusters von Ralf Bohnsack zur Analyse von Normen und Habitus
- Ableitung und Erläuterung der Herausforderungen einer Migrationsgesellschaft für pädagogische Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Migrationsgesellschaft und die Organisation von Wissen und Werten in Migrationsfamilien ein. Das Kapitel „Die Migrationsgesellschaft“ beleuchtet den Begriff „Migrationsgesellschaft“ anhand von Definitionen der Begriffe „Migration“ und „Gesellschaft“ und untersucht die Strukturen und Geschlechterdifferenzen in Migrationsfamilien. Das Kapitel „Die Forschung von Wissen und Werten in Migrationsfamilien“ beschäftigt sich mit den Begriffen „Wissen“ und „Werte“ und analysiert die Forschung in diesem Bereich. Es beleuchtet die Herausforderungen für pädagogische Organisationen in einer Migrationsgesellschaft.
Schlüsselwörter
Migrationsgesellschaft, Migrantenfamilie, Wissen, Werte, intergenerationelle Weitergabe, Geschlechterdifferenzen, dokumentarische Methode, Orientierungsmuster, pädagogische Organisationen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Migrationsgesellschaft?
Es ist eine Gesellschaft, die durch dauerhafte Ein- und Auswanderungsbewegungen transformiert wird und in der kulturelle Vielfalt den Alltag prägt.
Wie werden Wissen und Werte in Migrantenfamilien weitergegeben?
Die Arbeit analysiert intergenerationelle Prozesse, bei denen Wissen oft implizit über den Habitus und familiäre Strukturen vermittelt wird.
Was ist die dokumentarische Methode nach Karl Mannheim?
Diese Methode dient dazu, implizites Wissen (Erfahrungswissen) zu versprachlichen und die tieferliegenden Orientierungsmuster von Menschen zu verstehen.
Welche Rolle spielen Geschlechterdifferenzen in Migrationsfamilien?
Die Arbeit untersucht, wie unterschiedliche Rollenbilder von Männern und Frauen die Organisation von Wissen und die Erziehung beeinflussen.
Welche Herausforderungen ergeben sich für pädagogische Organisationen?
Schulen und andere Einrichtungen müssen lernen, die vielfältigen Wissensbestände und Wertehaltungen von Migrationsfamilien produktiv zu integrieren.
- Citar trabajo
- Marian Schneider (Autor), 2014, Die Erforschung von Wissen und Werten in der Migrationsgesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305078