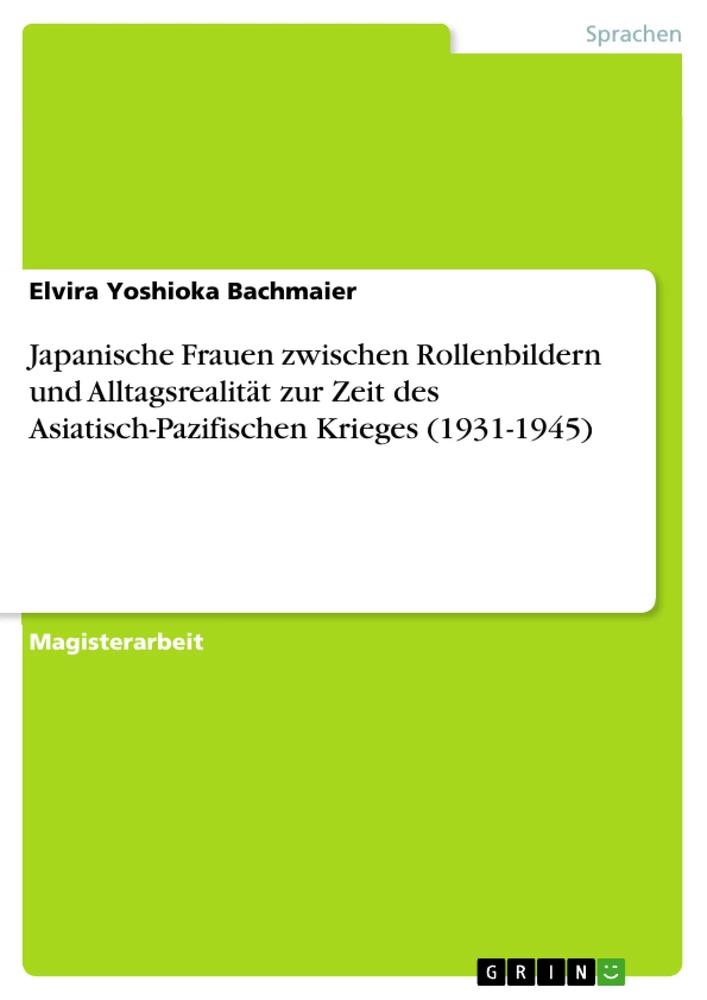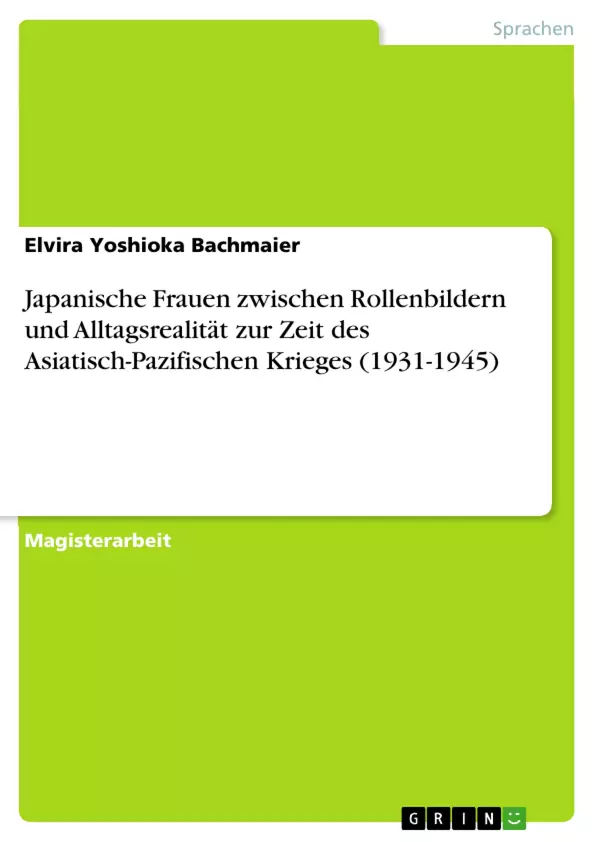Die Frauen Japans sahen sich in der Zeit des Asiatisch-Pazifischen Krieges einem gravierenden Wandel in der Gesellschaft und im Alltagsleben gegenüber. Die zunehmende Militarisierung, die Generalmobilisierung und der sich von Jahr zu Jahr verschlimmernde Krieg veränderten ihr Leben nachhaltig. Doch nicht nur das Alltagsleben wurde durch den Einzug von Ehemännern und Söhnen, durch Ressourcenknappheit und Luftangriffen ins Chaos gestürzt. Damit einhergehend und dem vorausgreifend veränderten sich auch die Erwartungen an die Frau an sich. Im durch und durch militärischem Jargon der Zeit wurde mit Zuspitzung der Kriegslage auch an den Kampfgeist der Frau appelliert. Dennoch betonte man trotz der Notwendigkeit weiblicher Arbeitskräfte in der wachsenden Kriegsindustrie weiterhin dass es die erste Pflicht der Frau sie, für den Staat Kinder zu gebären. Schließlich wurde gar von einem „neuen“, dem „Kriege angemessenen“ Schönheitsideal gesprochen. Diese Veränderungen in den Werteanschauungen wurden zu einem großen Teil von der Regierung initiiert, um ihren Zielen, i.e. einem erfolgreichen Kriegsverlauf, dienlich zu sein. Bei dem Beispiel der Mutterpflichten der Frau, bedeutete dies, das „Menschenmaterial“ für den lang andauernden Krieg zu sichern.
Mit meiner Arbeit möchte ich diese Widersprüche von idealen Rollenbildern und harter Kriegsrealität in den unterschiedlichsten Lebensbereichen jener Zeit darlegen und diskutieren, wie die Frauen im Einzelnen mit solchen Gegensätzen umgingen, ob und wie die Diskrepanzen aufgelöst oder überwunden wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die gesellschaftliche Situation vor dem „15jährigen“ Krieg, gezeigt am Wandel des ryōsai-kenbo-Ideals
- 2.1 Rechtliche Grundlage
- 2.2 Schulbildung
- 2.3 ryōsai kenbo
- 2.4 Debatten um Mutterschutz, Geburtenkontrolle und Änderung des Meiji-Zivilgesetzbuches
- 2.5 Kampf um das Frauenwahlrecht
- 3. Widersprüche von Rollenbildern und Alltagsrealität der japanischen Frauen zur Zeit des 15jährigen Krieges (1931-1945)
- 3.1 Zum Verhältnis von Individuum und Staat
- 3.1.1 Das Individuum, die Familie und der Staat - ein Familienstaat?
- 3.1.1.1 Eheschließung
- 3.1.1.2 Die Frau im ie-System
- 3.1.2 Von der Küche auf die Straße: die Öffentlichkeitsarbeit der Frauenorganisationen
- 3.1.2.1 Aikoku Fujinkai und Kokubō Fujinkai
- 3.1.2.2 Dainippon Fujinkai
- 3.1.2.3 Öffentlicher und privater Einfluss der Frauenorganisationen auf die Bevölkerung
- 3.1.3 Resümee
- 3.2 Produktion und Reproduktion
- 3.2.1 Die pronatalistische Bevölkerungspolitik
- 3.2.2 Sexualität
- 3.2.3 Arbeitskräftemangel und Frauenarbeit
- 3.2.4 Die Debatte um die Einberufung von freiwilligen Frauen-Arbeitstruppen
- 3.2.5 Umgang mit dem Dilemma aus ideologischer Sicht: Förderung der Mutterschaft durch Arbeit
- 3.2.6 Lebensmittelproduktion auf dem Land
- 3.2.7 Resümee
- 3.3 Das Dilemma der Ehefrauen und Mütter von Soldaten: Leben erhalten und Leben darbringen
- 3.3.1 Gunkoku no tsuma und gunkoku no haha
- 3.3.2 Eine militaristische Übersteigerung der „guten Ehefrau und weisen Mutter“?
- 3.4 Die „neue Schönheit“ der Frau: Die Betonung der Natürlichkeit als Anregung zur Konsumreduzierung
- 3.4.1 Kleidung und Schmuck
- 3.4.2 Monpe und Standardkleidung
- 3.4.3 Körperbau
- 3.4.4 Resümee
- 3.5 Passive Opferbereitschaft oder aktive Kampfbereitschaft?
- 3.5.1 Opferbereitschaft als weibliche Tugend
- 3.5.2 Die zunehmende Notwendigkeit weiblicher Kampfbereitschaft
- 3.5.2.1 Freiwillige Kampftruppen
- 3.5.2.2 Gyokusai: Das Zerspringen des Edelsteins
- 3.5.3 Resümee
- Wandel des ryōsai-kenbo-Ideals im Kontext des Krieges
- Konflikt zwischen individuellen Bedürfnissen und staatlichen Erwartungen
- Rolle von Frauenorganisationen in der Kriegsmobilisierung
- Auswirkungen des Krieges auf die Arbeitswelt der Frauen
- Veränderung des Schönheitsideals und der Konsumgewohnheiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle japanischer Frauen während des Asiatisch-Pazifischen Krieges (1931-1945). Im Fokus steht der Widerspruch zwischen den idealisierten Rollenbildern und der Realität des Alltagslebens. Die Studie analysiert, wie die Regierung die Frauen in das Kriegssystem integrierte und welche Auswirkungen dies auf die verschiedenen sozialen Schichten hatte.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext des Krieges und die bisherige Forschungsliteratur. Sie hebt den Fokus auf „gewöhnliche“ japanische Frauen und ihre Erfahrungen im Alltag hervor, im Gegensatz zu den bereits oft untersuchten prominenten Feministinnen.
2. Die gesellschaftliche Situation vor dem „15jährigen“ Krieg, gezeigt am Wandel des ryōsai-kenbo-Ideals: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Situation japanischer Frauen vor dem Krieg. Es untersucht rechtliche Grundlagen, Schulbildung und den Wandel des Ideals der „guten Ehefrau und weisen Mutter“ (ryōsai-kenbo). Debatten um Mutterschutz, Geburtenkontrolle und das Frauenwahlrecht werden ebenso behandelt. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der vorherrschenden gesellschaftlichen Normen, die im Krieg stark verändert wurden.
3. Widersprüche von Rollenbildern und Alltagsrealität der japanischen Frauen zur Zeit des 15jährigen Krieges (1931-1945): Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die Widersprüche zwischen den staatlich propagierten Rollenbildern und der Realität des Alltagslebens japanischer Frauen während des Krieges. Es untersucht das Verhältnis von Individuum und Staat, die Rolle von Frauen in der Produktion und Reproduktion, sowie die spezifischen Herausforderungen für Ehefrauen und Mütter von Soldaten. Die Veränderungen im Schönheitsideal und die Frage der passiven oder aktiven Kampfbereitschaft werden ebenfalls behandelt. Die einzelnen Unterkapitel beleuchten unterschiedliche Aspekte dieses komplexen Themas, von der Einbindung in staatliche Organisationen über die Arbeitsbedingungen bis hin zur emotionalen Belastung.
Schlüsselwörter
Japanische Frauen, Asiatisch-Pazifischer Krieg, ryōsai-kenbo, Rollenbilder, Alltagsrealität, Nationalisierung, Frauenorganisationen, Kriegsmobilisierung, Produktion und Reproduktion, Opferbereitschaft, Kampfbereitschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Rolle japanischer Frauen während des Zweiten Weltkriegs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle japanischer Frauen während des Asiatisch-Pazifischen Krieges (1931-1945) und konzentriert sich auf den Widerspruch zwischen idealisierten Rollenbildern und der Alltagsrealität. Sie analysiert die Integration der Frauen in das Kriegssystem durch die Regierung und die Auswirkungen auf verschiedene soziale Schichten. Im Fokus stehen „gewöhnliche“ Frauen und deren Erfahrungen, im Gegensatz zu bereits oft untersuchten prominenten Feministinnen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des ryōsai-kenbo-Ideals (gute Ehefrau und weise Mutter) im Kontext des Krieges, den Konflikt zwischen individuellen Bedürfnissen und staatlichen Erwartungen, die Rolle von Frauenorganisationen in der Kriegsmobilisierung, die Auswirkungen des Krieges auf die Arbeitswelt der Frauen, und die Veränderung des Schönheitsideals sowie der Konsumgewohnheiten. Es werden rechtliche Grundlagen, Schulbildung vor dem Krieg und Debatten um Mutterschutz, Geburtenkontrolle und Frauenwahlrecht beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur gesellschaftlichen Situation vor dem Krieg (mit Fokus auf den Wandel des ryōsai-kenbo-Ideals), und einem Kernkapitel, welches die Widersprüche zwischen Rollenbildern und der Alltagsrealität der japanischen Frauen während des Krieges analysiert. Das Kernkapitel unterteilt sich in Unterkapitel zu verschiedenen Aspekten, wie dem Verhältnis von Individuum und Staat, Produktion und Reproduktion, den Herausforderungen für Ehefrauen und Mütter von Soldaten, Veränderungen im Schönheitsideal und der Frage nach passiver oder aktiver Kampfbereitschaft der Frauen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Japanische Frauen, Asiatisch-Pazifischer Krieg, ryōsai-kenbo, Rollenbilder, Alltagsrealität, Nationalisierung, Frauenorganisationen, Kriegsmobilisierung, Produktion und Reproduktion, Opferbereitschaft, Kampfbereitschaft.
Welche Frauenorganisationen werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt unter anderem die Aikoku Fujinkai, Kokubō Fujinkai und Dainippon Fujinkai und analysiert deren öffentlichen und privaten Einfluss auf die Bevölkerung.
Wie wird das Verhältnis von Individuum und Staat dargestellt?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen den individuellen Bedürfnissen der Frauen und den staatlichen Erwartungen im Kontext des Krieges. Sie analysiert, wie die Regierung die Frauen in das Kriegssystem integrierte und welche Auswirkungen dies auf die Familienstruktur und das individuelle Leben hatte.
Welche Aspekte der Alltagsrealität japanischer Frauen werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Alltagsrealität, darunter die Arbeitsbedingungen von Frauen, die Lebensmittelproduktion auf dem Land, die Herausforderungen für Ehefrauen und Mütter von Soldaten, sowie die Veränderungen im Bereich der Kleidung, des Schmucks und des Schönheitsideals.
Welche Rolle spielten die Frauenorganisationen während des Krieges?
Die Frauenorganisationen spielten eine wichtige Rolle in der Kriegsmobilisierung. Die Arbeit untersucht ihren Einfluss auf die Bevölkerung und ihre Beteiligung an der Propaganda und der Unterstützung der Kriegsanstrengungen.
Wie wird die Debatte um die Einberufung von freiwilligen Frauen-Arbeitstruppen dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Debatte um die Einberufung von freiwilligen Frauen-Arbeitstruppen und die damit verbundenen ideologischen Aspekte, insbesondere die Förderung der Mutterschaft durch Arbeit.
Wie wird das Thema „Opferbereitschaft“ und „Kampfbereitschaft“ behandelt?
Die Arbeit untersucht die widersprüchlichen Rollenvorstellungen von passiver Opferbereitschaft als weibliche Tugend und der zunehmenden Notwendigkeit weiblicher Kampfbereitschaft, einschließlich der Teilnahme an freiwilligen Kampftruppen und dem Phänomen des Gyokusai (Zerspringen des Edelsteins).
- Citar trabajo
- Elvira Yoshioka Bachmaier (Autor), 2011, Japanische Frauen zwischen Rollenbildern und Alltagsrealität zur Zeit des Asiatisch-Pazifischen Krieges (1931-1945), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305095