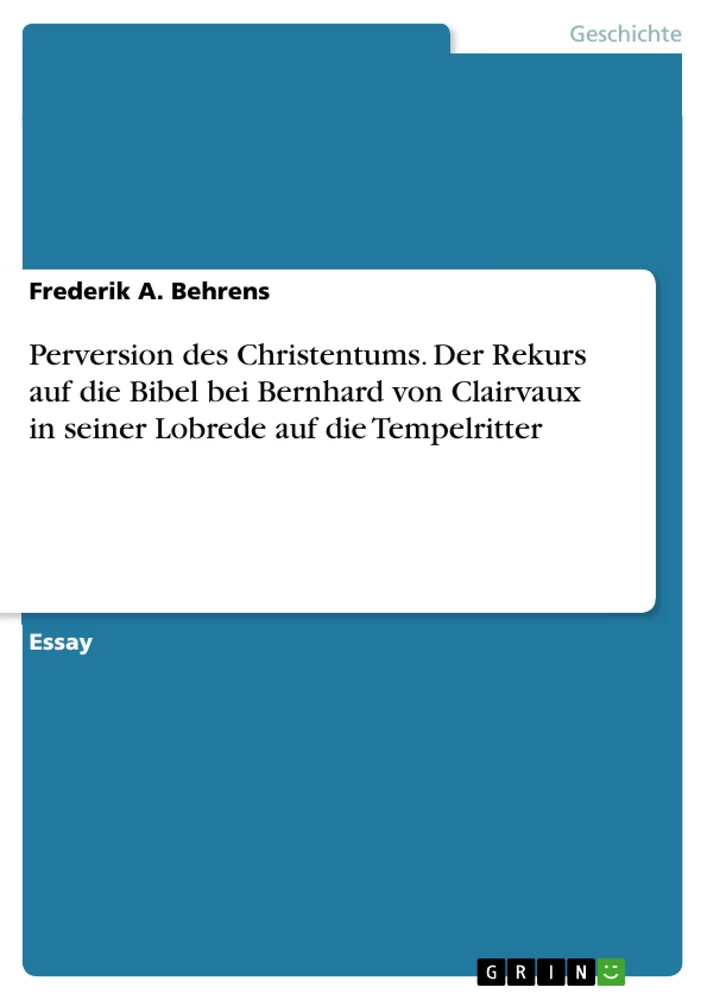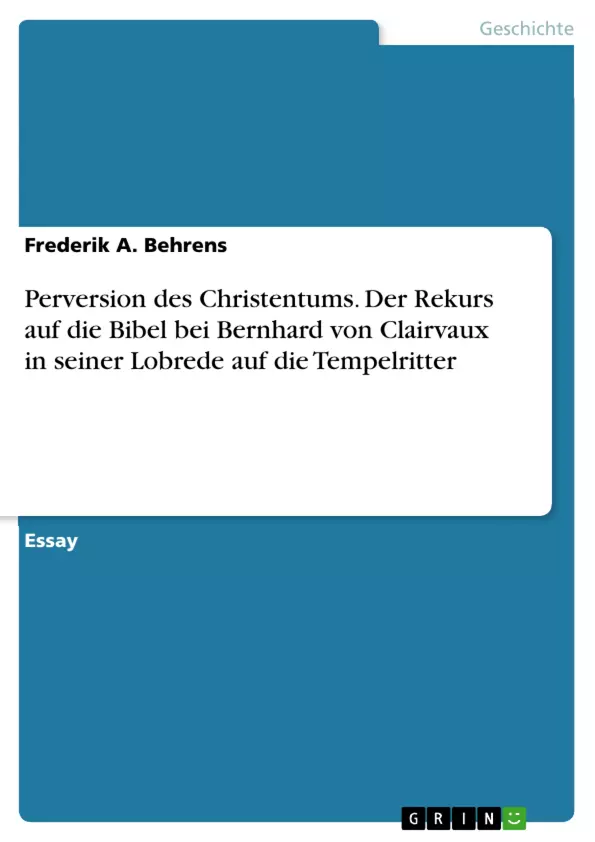Bernhard von Clairvaux präsentiert in seiner an die Tempelritter gerichteten Lobrede auf das neue Rittertum (De Laude Novae Militiae) eine sehr engagierte und rhetorisch geschickte theologische Fundierung und Rechtfertigung des Sterbens und vor allem des Tötens im Namen Christi.
Malcolm Barber bemerkt in dem entsprechenden Kapitel seines Buches über die Templer, dass die Repräsentation des Christentums, vermeintlich eine pazifistische Religion, durch einen militärischen Mönchsorden – zumindest auf den ersten Blick – "anomal" und schwer zu verstehen sei. Wie Barber im weiteren Verlauf seines Textes ausführt, wurde Bernhards Sichtweise (und generell der Orden der Templer) bereits von Zeitgenossen und theologischen Gegnern scharf kritisiert.
Aus diesem Grund untersucht dieses Essay den Rekurs Bernhards auf die Bibel, wobei es ausdrücklich nicht um eine theologische oder gar bibelexegetische Auseinandersetzung geht, sondern um die historisch bzw. kultur- und literaturwissenschaftlich interessante Frage, wie er es rhetorisch und argumentativ angestellt hat, einen Text wie das Neue Testament, das in Fragen der Gewalt in seinen Aussagen eindeutig ist und wenig Spielraum für kreative Interpretationen lässt, in einen Kontext zu stellen und zu instrumentalisieren, in dem das Töten nicht nur befürwortet, sondern sogar nachdrücklich glorifiziert und idealisiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Perversion des Christentums: Der Rekurs auf die Bibel bei Bernhard von Clairvaux
- Bernhard von Clairvaux und die Legitimation von Gewalt
- Das Neue Testament und die Frage der Gewalt
- Bernhards Rekurs auf das Neue Testament
- Die Umwertung des Wortes Märtyrer
- Bernhard von Clairvaux und die Kontroverse um den Einsatz von Gewalt
- Fazit: Bernhards bewusste Instrumentalisierung des Neuen Testaments
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die rhetorischen und argumentativen Strategien, die Bernhard von Clairvaux in seiner Lobrede auf das neue Rittertum (De Laude Novae Militiae) einsetzt, um das Töten im Namen Christi zu rechtfertigen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie er es schafft, das Neue Testament, das in Fragen der Gewalt eindeutig pazifistisch ist, in einen Kontext zu stellen, in dem das Töten glorifiziert und idealisiert wird.
- Bernhards Rekurs auf die Bibel als Mittel zur Legitimation von Gewalt
- Die Rhetorik und Argumentationsstruktur von Bernhards Lobrede
- Der Widerspruch zwischen Bernhards Thesen und den Aussagen des Neuen Testaments
- Die Rolle des Alten Testaments in Bernhards Argumentation
- Die Umdeutung des Begriffs „Märtyrer“ im Kontext des neuen Rittertums
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer kurzen Einführung in die Thematik und stellt die Frage nach der Legitimation von Gewalt im Kontext des Christentums. Anschließend wird die Argumentation von Bernhard von Clairvaux analysiert, die auf einer selektiven Interpretation des Neuen Testaments beruht. Dabei werden zwei zentrale Stellen aus dem Neuen Testament untersucht, die Bernhard als Beleg für seine These heranzieht. Der Essay beleuchtet den Widerspruch zwischen Bernhards Argumentation und den pazifistischen Aussagen des Neuen Testaments und zeigt auf, wie er die biblischen Texte für seine Zwecke instrumentalisiert. Schließlich wird die Umdeutung des Begriffs „Märtyrer“ durch Bernhard im Kontext des neuen Rittertums beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bernhard von Clairvaux, De Laude Novae Militiae, Rittertum, Gewalt, Christentum, Neues Testament, Altes Testament, Rhetorik, Argumentation, Märtyrer, Pazifismus, Instrumentalisierung
Häufig gestellte Fragen
Wie rechtfertigte Bernhard von Clairvaux Gewalt im Namen Christi?
In seiner Lobrede „De Laude Novae Militiae“ nutzte er rhetorische Strategien und selektive Bibelauslegungen, um das Töten von „Ungläubigen“ als Dienst für Gott darzustellen.
Widerspricht Bernhards Position nicht dem pazifistischen Kern des Neuen Testaments?
Ja, die Arbeit untersucht genau diesen Widerspruch und analysiert, wie Bernhard pazifistische Texte instrumentalisierte, um das neue Rittertum theologisch zu fundieren.
Was versteht Bernhard unter dem „neuen Rittertum“?
Er beschreibt damit die Tempelritter, die als militärischer Mönchsorden sowohl geistliche Gelübde ablegten als auch den bewaffneten Kampf führten.
Wie deutete Bernhard den Begriff „Märtyrer“ um?
Er erweiterte den Begriff auf Ritter, die im Kampf für den Glauben sterben oder töten, und glorifizierte diesen Einsatz als höchsten geistlichen Verdienst.
Welche Rolle spielt das Alte Testament in seiner Argumentation?
Bernhard griff verstärkt auf kriegerische Bilder und Konzepte des Alten Testaments zurück, um die eher pazifistischen Aussagen Jesu im Neuen Testament zu überlagern.
- Quote paper
- Frederik A. Behrens (Author), 2015, Perversion des Christentums. Der Rekurs auf die Bibel bei Bernhard von Clairvaux in seiner Lobrede auf die Tempelritter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305106