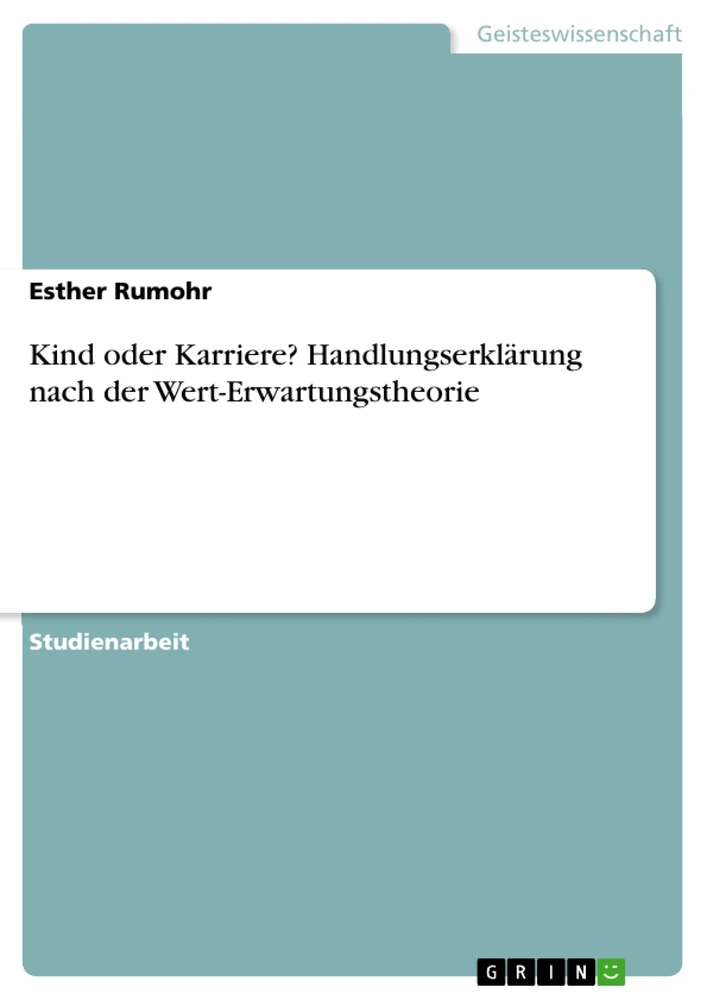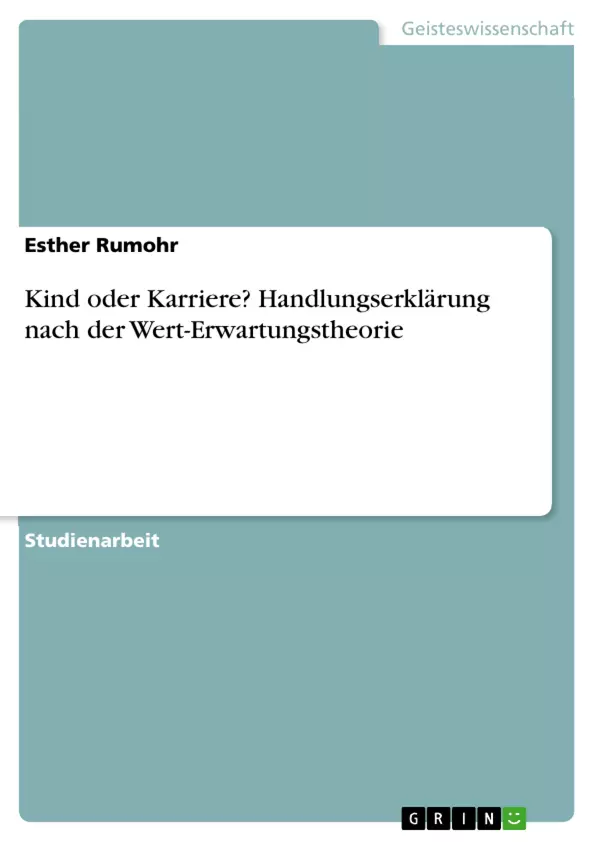Die Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen ist eine viel diskutierte Debatte sowohl in den Medien, wie auch in der Wissenschaft. Elternschaft scheint nicht mehr Teil der Normalbiografie zu sein und somit entscheiden sich viele Frauen dagegen, Nachwuchs zu zeugen.
In dieser Arbeit soll mit Hilfe der Wert-Erwartungstheorie von Esser der Frage nachgegangen werden, warum sich überdurchschnittlich viele Akademikerinnen gegen die Geburt eines Kindes entscheiden. Esser (1999a) hat mit seiner Theorie den Anspruch, Handlungen verstehend erklären zu können und damit Aussagen über die Mikroebene, also die individuellen Handlungen, zu treffen. Er löst damit das Erklärungsproblem, gesellschaftliche Phänomene verstehen zu können, indem die Selektion von Alternativen durch die Akteure untersucht wird.
Im ersten Kapitel wird zunächst das Wannenmodell sozialen Erklärens von Coleman und Esser veranschaulicht. Das Modell dient dazu, die einzelnen Schritte dieser Arbeit nachzuvollziehen. Im Anschluss an die Modellbeschreibung wird die Ausgangssituation des Phänomens der kinderlosen Akademikerinnen beschrieben (siehe Kapitel 3). Durch die Darstellung des Wandels in der Gesellschaft in Bezug auf die Familienstrukturen wird die Makroebene definiert. Das heißt, was kann den Anstieg der Kinderlosigkeit von Hochschulabsolventinnen beeinflusst haben. Ob jedoch überhaupt ein Anstieg zu beobachten ist, wird anhand des vierten Kapitels belegt. In diesem Abschnitt wird der soziale Tatbestand von überdurchschnittlich vielen kinderlosen Akademikerinnen mit aktuellen Daten empirisch überprüft. Ausgehend von dem Erklärungsproblem zwischen den beiden Makroebenen, der Ausgangssituation und dem sozialen Phänomen, wird in Kapitel 5 schrittweise die Logik der Selektion von Hochschulabsolventinnen mit Hilfe der Wert-Erwartungstheorie beschrieben. Im abschließenden Kapitel (siehe Kapitel 6) werden daraufhin noch einmal alle Ergebnisse zusammenfassend dargestellt um dann auf die Fragestellung einzugehen, warum sich überdurchschnittliche viele Akademikerinnen gegen die Geburt eines Kindes entscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Wannenmodell sozialen Erklärens
- Elternschaft im Wandel der Gesellschaft
- Kinderlose Akademikerinnen – Aktuelle empirische Befunde
- Kind oder Karriere? Handlungserklärung nach der WET
- Die Alternativen
- Die Folgen
- Die Bewertungen
- Die Erwartungen
- Die Evaluation der Alternativen
- Die Selektion
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen und untersucht die Gründe, warum sich überdurchschnittlich viele Akademikerinnen gegen die Geburt eines Kindes entscheiden. Sie verwendet die Wert-Erwartungstheorie von Esser, um die Handlungsentscheidungen der Akademikerinnen zu erklären.
- Analyse der Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen
- Anwendung des Wannenmodells sozialen Erklärens nach Coleman und Esser
- Interpretation der Handlungsentscheidungen von Akademikerinnen anhand der Wert-Erwartungstheorie
- Beurteilung der Folgen der Kinderlosigkeit für die Gesellschaft
- Bewertung der Rolle von Bildung und Gleichberechtigung für die Entscheidung zur Elternschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen dar und erläutert die Forschungsfrage, die in dieser Arbeit behandelt wird. Kapitel 2 beschreibt das Wannenmodell sozialen Erklärens von Coleman und Esser, welches als methodisches Framework für die Analyse der Handlungsentscheidungen dient. Kapitel 3 beleuchtet den Wandel der Gesellschaft im Bezug auf Elternschaft und Familienstrukturen und zeigt die Faktoren auf, die zu einer Veränderung der traditionellen Rollenbilder geführt haben.
Kapitel 4 präsentiert empirische Befunde, die den Anstieg der Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen belegen. Kapitel 5 untersucht die Logik der Selektion von Akademikerinnen in Bezug auf die Entscheidung für oder gegen die Geburt eines Kindes anhand der Wert-Erwartungstheorie. Es analysiert die Alternativen, Folgen, Bewertungen, Erwartungen und die Selektion von Akademikerinnen, die sich für oder gegen die Elternschaft entscheiden.
Schlüsselwörter
Kinderlosigkeit, Akademikerinnen, Wert-Erwartungstheorie, Handlungserklärung, Wannenmodell, Familienwandel, Gesellschaftliche Veränderungen, Individualisierung, Gleichberechtigung, Lebensentwürfe, Bildungsreform, Empirische Befunde, Mikro- und Makroebene, Selektion, Aggregation.
Häufig gestellte Fragen
Warum entscheiden sich viele Akademikerinnen gegen Kinder?
Die Arbeit nutzt die Wert-Erwartungstheorie, um zu zeigen, dass hohe Opportunitätskosten (Karriereverlust) und spezifische Erwartungen an die Lebensqualität oft gegen eine Elternschaft sprechen.
Was erklärt das „Wannenmodell“ nach Coleman und Esser?
Es beschreibt, wie gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Makroebene) die individuellen Entscheidungen (Mikroebene) beeinflussen und wie diese wiederum zu sozialen Phänomenen (Aggregation) führen.
Welche Rolle spielt die Individualisierung bei der Kinderlosigkeit?
Durch den gesellschaftlichen Wandel ist Elternschaft nicht mehr Teil der „Normalbiografie“; Frauen wählen heute zwischen verschiedenen Lebensentwürfen autonom aus.
Was sind die Folgen der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen für die Gesellschaft?
Die Arbeit diskutiert die demografischen Auswirkungen und die Frage, wie Bildung und Gleichberechtigung die Familienstrukturen langfristig verändern.
Wie funktioniert die Selektion nach der Wert-Erwartungstheorie?
Akteure bewerten Alternativen (Kind oder Karriere) nach deren Folgen und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese eintreten, und wählen die Option mit dem höchsten subjektiven Nutzen.
- Quote paper
- Esther Rumohr (Author), 2014, Kind oder Karriere? Handlungserklärung nach der Wert-Erwartungstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305233