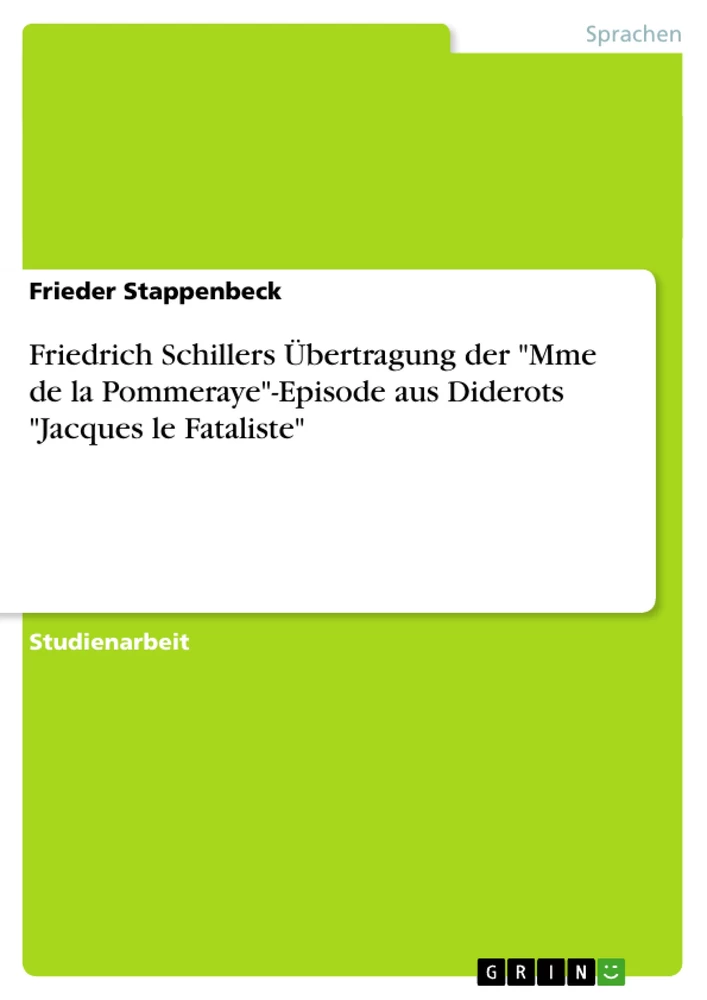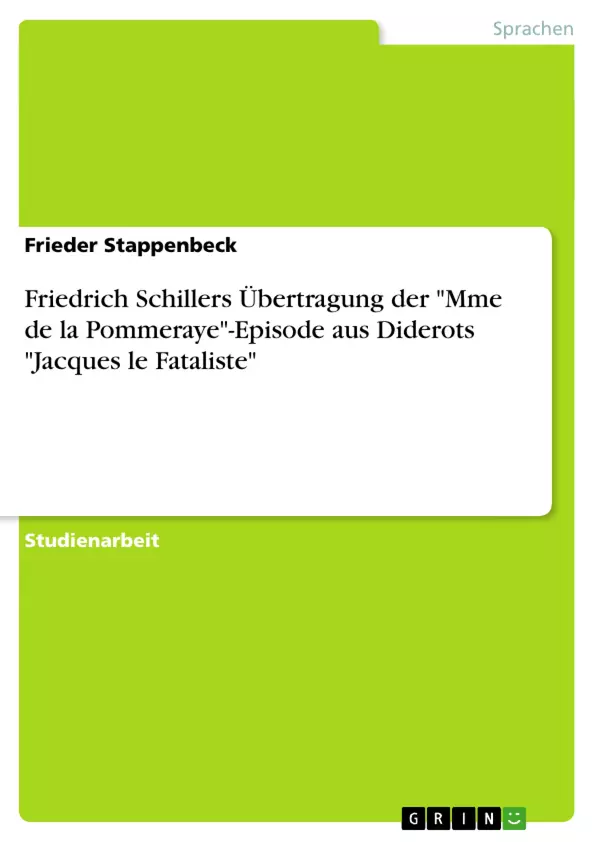Dieser Aufsatz vergleicht zwei deutsche Übersetzungen von Denis Diderots „Jacques le Fataliste“.
Genauer: Zwei Übersetzungen eines Auszugs aus diesem Werk werden einander gegenübergestellt; denn bei der ersten handelt es sich um einen Text von Friedrich von Schiller, der daraus nur eine einzelne Erzählung – die über die „Mme de La Pommeraye“ – übertragen hat. Diese Arbeit von Schiller stellt die erste Verdeutschung aus „Jacques le Fataliste“ dar, sie erschien 1785. Die erste vollständige Übersetzung wurde von W. Ch. S. Mylius angefertigt und erstmals 1792 veröffentlicht. Somit erschien die Endfassung dieses Werks in deutscher Version noch vor der französischen Originalfassung, die 1796 verlegt wurde (- eine erster Entwurf wurde in Feuilletonform in der „Correspondance littéraire“ von 1778 bis 1780 publiziert).
Der dem Schillerschen Text gegenübergestellte Übersetzungsauszug stammt von Jens Ihwe, dessen „Jacques der Fatalist und sein Herr“ zum ersten Mal 1967 gedruckt wurde (m.E.), also beinahe zwei Jahrhunderte jünger ist als das Original und Schillers Übertragung.
Da der enge Rahmen dieses Aufsatzes das Einkreisen auf bestimmte Aspekte der jeweiligen Übersetzungstendenzen erzwingt, wird es hauptsächlich um die Frage gehen, was geschieht, wenn man, wie Schiller es tat, eine einzelne Binnenerzählung aus ihrem Romanrahmen heraustrennt, oder wenn diese, wie bei Ihwe, im Gesamttext eingebettet bleibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jacques le Fataliste
- Diderot in Deutschland
- Zum Gesamt(anti)roman
- Die Mme de La Pommeraye-Episode
- Schillers Übertragung in der Rezeption
- Detailanalyse
- Zusammenfassung
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz befasst sich mit einem Vergleich zweier deutscher Übersetzungen von Denis Diderots Jacques le Fataliste. Der Fokus liegt auf der Analyse der Übersetzung eines Auszugs aus dem Buch, die Friedrich von Schiller und Jens Ihwe angefertigt haben. Durch die Gegenüberstellung dieser Übersetzungen wird untersucht, wie die Herauslösung einer Binnenerzählung aus dem Romanrahmen (Schiller) im Vergleich zur Einbettung im Gesamttext (Ihwe) die Rezeption und Interpretation beeinflusst.
- Diderots Jacques le Fataliste und seine Bedeutung für die deutsche Rezeption
- Die Übersetzungsphilosophie von Schiller und Ihwe im Kontext des Gesamtwerkes
- Die Herauslösung einer Binnenerzählung aus dem Romanrahmen und ihre Auswirkungen
- Die Rolle des Erzählers und die Konzeption des Antiromans
- Die Auseinandersetzung mit dem Thema der Willensfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden zu vergleichenden Übersetzungen von Jacques le Fataliste vor und skizziert den Rahmen der Untersuchung. Sie beleuchtet die Bedeutung des Werkes Diderots für die deutsche Literatur und die Rezeption seiner Werke.
- Jacques le Fataliste: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Roman Jacques le Fataliste von Diderot, der als Antiroman im Sinne der Moderne interpretiert wird. Er analysiert die Hauptthemen und -aspekte des Romans und beleuchtet die verschiedenen Ebenen der Erzählstruktur.
- Schillers Übertragung in der Rezeption: Hier wird auf die Rezeption von Schillers Übersetzung der Mme de La Pommeraye-Episode eingegangen und die Bedeutung seiner frühen Übertragung für die Verbreitung von Diderots Werk in Deutschland hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieses Aufsatzes umfassen: Diderot, Jacques le Fataliste, Antiroman, Übersetzung, Schiller, Ihwe, Mme de La Pommeraye-Episode, Binnenerzählung, Erzählstruktur, Willensfreiheit, Fatalismus, Rezeption, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum übersetzte Friedrich Schiller nur einen Teil von „Jacques le Fataliste“?
Schiller wählte 1785 gezielt die Episode der „Mme de La Pommeraye“ aus, um sie als eigenständige Erzählung im deutschen Sprachraum bekannt zu machen.
Was ist das Besondere an Diderots Roman „Jacques le Fataliste“?
Er gilt als „Antiroman“, der mit Erzählkonventionen bricht, den Leser direkt anspricht und die philosophische Frage nach der Willensfreiheit (Fatalismus) thematisiert.
Wie unterscheidet sich Schillers Übersetzung von der von Jens Ihwe?
Schiller löst die Binnenerzählung aus dem Rahmen heraus, während Ihwe sie 1967 im Kontext des Gesamtwerks belässt, was die Wirkung der Erzählstruktur verändert.
Wann erschien die erste vollständige deutsche Übersetzung des Romans?
Die erste vollständige Übersetzung wurde 1792 von W. Ch. S. Mylius angefertigt, noch vor der französischen Originalveröffentlichung von 1796.
Welche Rolle spielt die Mme de La Pommeraye in der Geschichte?
Sie ist die Protagonistin einer Racheerzählung, die exemplarisch für die komplexen zwischenmenschlichen Machtverhältnisse und moralischen Fragen im Werk Diderots steht.
- Quote paper
- Frieder Stappenbeck (Author), 2001, Friedrich Schillers Übertragung der "Mme de la Pommeraye"-Episode aus Diderots "Jacques le Fataliste", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30537