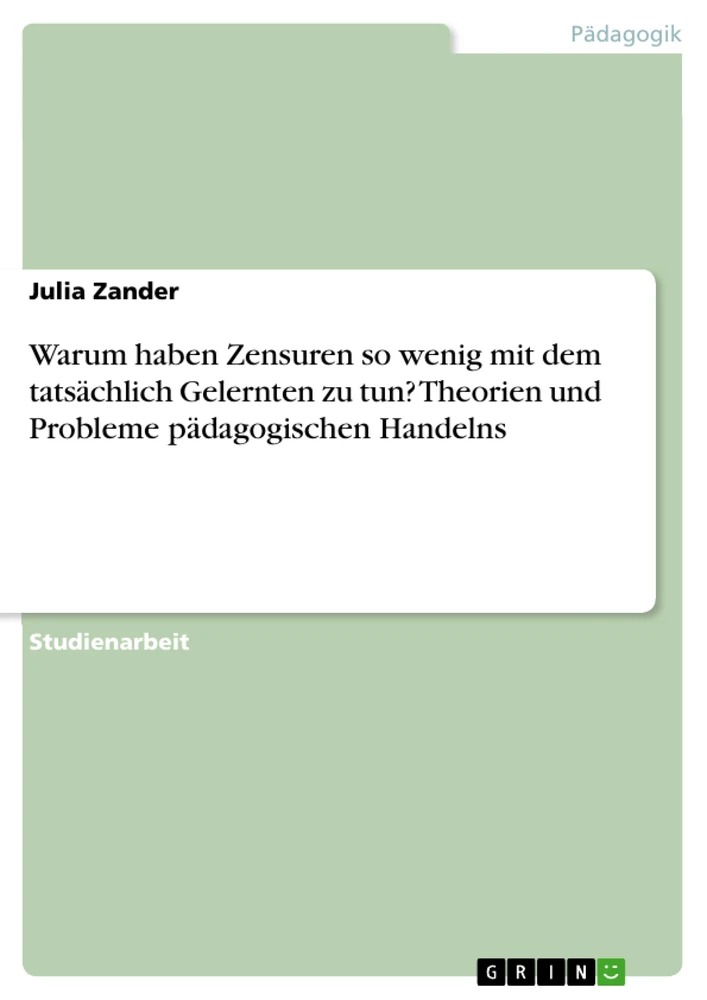Wer sich mit den Leistungen der Schüler und den damit verbundenen Zensuren gründlich und effektiv auseinandersetzen möchte, muss sich ebenso umfassend mit der Sinnhaftigkeit und den Funktionen der Notengebung beschäftigen. Die Zensur ist aus dem Schulsystem gar nicht mehr wegzudenken. Menschen haben das Verlangen, bewertet zu werden.
Die Schüler können durch Zensuren ihre Leistungen mit anderen Klassenkameraden vergleichen, sich dadurch besser motivieren und einen Anreiz bekommen leistungsstärker als andere zu werden. Lehrer erfahren durch ihre Zensurengebung eine berufliche Bestätigung, wie gut sie den Unterrichtsstoff vermitteln können. Auch die Eltern haben ein großes Interesse an den Zensuren ihrer Kinder, denn nicht der Elternabend ist das Hauptkommunikationsmittel zwischen den Eltern und der Schule, sondern die Notengebung.
Noten und vor allem Beurteilungen begleiten Menschen ihr Leben lang, dadurch lernen sie sich selbst und ihre Leistung besser kennen, einzuschätzen und zu bewerten. Außerdem dienen Bewertungen für den einen als unabdingbar sinnvolles Instrument der Kontrolle und für den anderen sind Zensuren nichts anderes als ein Druckmittel, welches leistungsschwache Schüler bestraft.
Doch inwieweit entsprechen Zensuren der tatsächlichen Leistung und wer garantiert, dass Noten nicht nur subjektiv vergeben werden? Mit diesen Problemen beschäftigten sich in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Pädagogen. In vielen wissenschaftlich-literarischen Texten wird die Unwahrheit über die erbrachten Schulleistungen, die die Zensurengebung mit sich bringt, aufgezeigt.
In der folgenden Arbeit wird die Zensur mit ihrer Entwicklung und ihren Funktionen sowie eine Gegenüberstellung von Zensuren und Wissen im Mittelpunkt stehen. Dies dient zur Klärung der Kernfrage: „Warum haben Zensuren so wenig mit tatsächlich Gelernten zu tun?“ Um dieses Problem zu vermeiden, wird längst nach leistungsfähigen Alternativen zu Noten gesucht, aber dies stellt sich als überaus schwierig heraus. Zusätzlich wird die Sichtweise bezüglich der Sinnhaftigkeit der Notengebung, die geprägt von Diskussionen über gerechte Noten ins Unendliche geht, von dem Pädagogen Hermann Giesecke reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zensuren
- Zensuren und ihre Entwicklung
- Wie entstehen Zensuren
- gute und schlechte Zensuren
- Funktionen der Noten
- Allokations- oder Selektionsfunktion
- Kontrollfunktion
- Rückmeldung
- Motivierung und Disziplinierung
- Beobachtung und Bewertung menschlichen Verhaltens
- Sympathie und Antipathie
- Beständigkeit und Kontinuität von Noten
- Noten vs. Wissen
- Didaktische Lernorte
- Zensuren? Zensuren! - Die Problematik der Notengebung
- Das tatsächliche Gelernte
- Bezug zu Hermann Giesecke
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum Zensuren so wenig mit dem tatsächlich Gelernten zu tun haben. Sie untersucht die Entwicklung der Zensur, ihre Funktionen und die subjektiven Beobachtungen und Bewertungen, die bei der Notenvergabe eine Rolle spielen. Darüber hinaus stellt die Arbeit Zensuren dem tatsächlichen Wissen gegenüber und analysiert die Problematik der Notengebung im Kontext der Bildung und der individuellen Lernprozesse.
- Entwicklung und Funktionen der Zensuren
- Subjektivität bei der Leistungsbewertung
- Zensuren und tatsächliches Wissen
- Die Problematik der Notengebung im Bildungssystem
- Die Rolle des Lehrers bei der Leistungsbeurteilung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz der Zensuren und ihrer Bedeutung im Bildungssystem dar. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die Notengebung und die kontroversen Diskussionen, die sie im Laufe der Zeit ausgelöst hat.
- Zensuren: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition der Zensur, ihrer Entwicklung und der Entstehung von Noten. Es werden verschiedene Aspekte wie die historische Entwicklung, die Bewertungssysteme und die vielfältigen Perspektiven auf die Benotung behandelt.
- Funktionen der Noten: Das Kapitel analysiert die verschiedenen Funktionen, die der Zensur zugeschrieben werden. Hierbei werden die wichtigsten Kategorien, nämlich der gesellschaftliche und der pädagogische Bereich, näher beleuchtet.
- Beobachtung und Bewertung menschlichen Verhaltens: Dieses Kapitel untersucht die subjektiven Aspekte der Leistungsbewertung und die Herausforderungen der objektiven Beurteilung menschlichen Verhaltens. Es werden Themen wie Sympathie, Antipathie und der «halo effect» behandelt.
- Noten vs. Wissen: In diesem Kapitel wird die Frage nach der Aussagekraft von Zensuren in Bezug auf das tatsächliche Wissen gestellt. Es werden verschiedene Lernorte und die unterschiedlichen Arten des Lernens beleuchtet.
- Bezug zu Hermann Giesecke: Dieses Kapitel präsentiert die Sichtweise von Hermann Giesecke auf die Zensuren und die Rolle der Schule in der Gesellschaft. Giesecke betont die Bedeutung individueller Begabungen und Lernprozesse, die durch die Notengebung oft nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Zensur, Notengebung, Leistungsbeurteilung, Subjektivität, Objektivität, Bildungssystem, Lernprozess, Didaktik, individuelle Entwicklung, Hermann Giesecke.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktionen erfüllen Schulnoten?
Noten dienen der Selektion (Allokation), der Kontrolle der Schülerleistung, der Rückmeldung an Eltern und Schüler sowie der Motivation und Disziplinierung.
Warum gelten Zensuren oft als subjektiv?
Die Notengebung kann durch Faktoren wie Sympathie, Antipathie oder den "Halo-Effekt" beeinflusst werden, was die Objektivität der Leistungsbewertung einschränkt.
Was sagt Hermann Giesecke zur Notengebung?
Giesecke kritisiert, dass individuelle Begabungen und Lernprozesse durch das starre Notensystem oft nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Spiegeln Noten das tatsächlich Gelernte wider?
Wissenschaftliche Texte zeigen oft eine Diskrepanz zwischen erbrachter Schulleistung laut Zensur und dem tatsächlichen Wissen bzw. individuellen Lernfortschritt auf.
Gibt es funktionierende Alternativen zu Schulnoten?
Es wird nach leistungsfähigen Alternativen gesucht, jedoch gestaltet sich die Umsetzung im bestehenden Bildungssystem aufgrund der Selektionsfunktion als schwierig.
- Quote paper
- Julia Zander (Author), 2013, Warum haben Zensuren so wenig mit dem tatsächlich Gelernten zu tun? Theorien und Probleme pädagogischen Handelns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305399