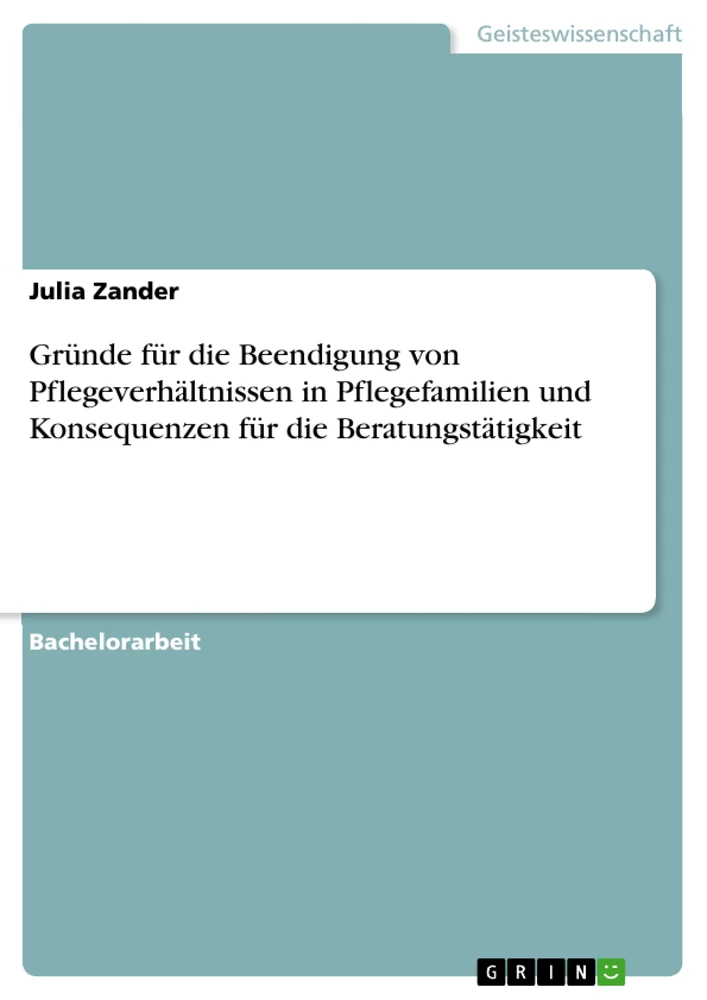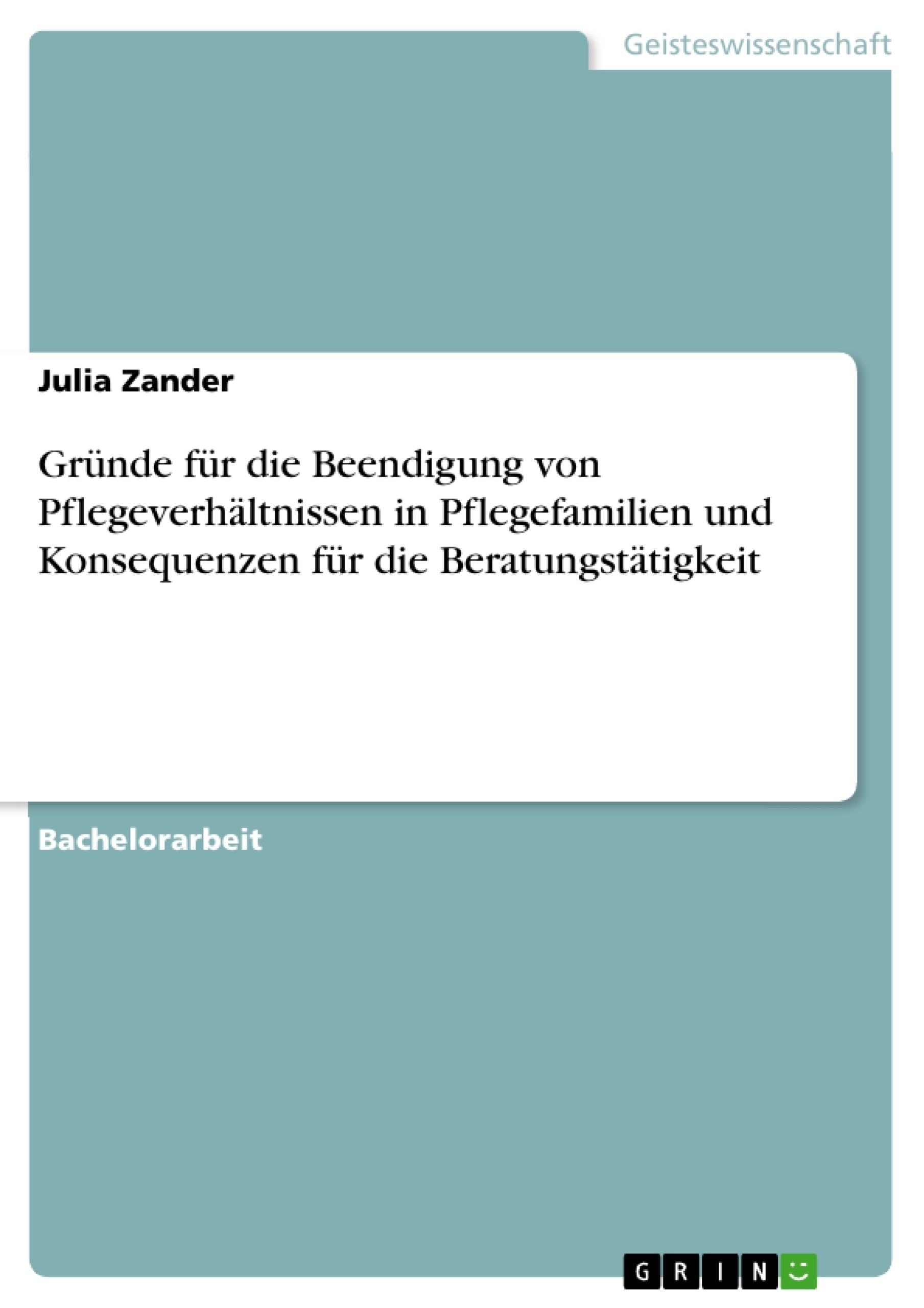In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren eine Beendigung von Pflegeverhältnissen in Pflegefamilien verursachen. Nach der einleitenden theoretischen Diskussion über die allgemeinen Entwicklungen im Pflegekinderwesen, wird das Sozialisationsfeld Pflegefamilie näher erläutert. „Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Förderung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ Demnach muss immer versucht werden, zugunsten des Kindes zu handeln und dabei sollen unnötige Übergangsunterbringungsmöglichkeiten vermieden werden. Bestenfalls soll das Kind nach der Perspektivklärung seine endgültige Unterbringung erhalten.
Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst obliegende Pflicht gemäß Artikel 6 GG i.V. mit § 1 SGB VIII. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Die Aufgabe des Jugendamtes ist es, den Schutz eines jeden Kindes sicherzustellen. Überdies muss es in diesem Zusammenhang seiner Kontrollfunktion nachgehen, denn nicht alle Eltern können ihren Kindern einen harmonischen und angemessenen Alltag sowie eine altersentsprechende Entwicklung und Förderung ermöglichen. Diesbezüglich wird zudem darauf eingegangen, was geschieht, wenn leibliche Eltern versagen und nicht mehr in der Lage sind, ihre eigenen Kinder zu versorgen.
Weiterhin soll die Frage geklärt werden, was Kinder und Jugendliche benötigen, deren Eltern nicht für sie sorgen können, da hierbei die Pflegefamilie eine entscheidende Rolle spielt. Anschließend werden der Prozess des Scheiterns sowie die Arten der Beendigung von Pflegeprozessen ausführlich vorgestellt. Das Thema scheint auf den ersten Blick einmal ein blinder Fleck zu sein. Es wird deutlich, dass Scheitern genau genommen als Frage der Vorstellung sowie Perspektive des Kindes zu verstehen ist und dementsprechend einen ambivalenten Sachverhalt aufzeigt.
Neben den negativen Auswirkungen, welche dieser Begriff zum Ausdruck bringt, kann er zugleich auch die Chance auf einen andersartigen, womöglich auch aussichtsreicheren biographischen Entwicklungsverlauf sein. Nachfolgend sind die geplanten als auch ungeplanten Abbrüche Thema dieser Arbeit. Neben der Rückkehr in die Herkunftsfamilie, sind es häufig auch andere Gründe, die zu einem beendigten Pflegeverhältnis führen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeine Entwicklungen
- 3 Sozialisationsfeld Pflegefamilie
- 3.1 Das Pflegekind - eine kurze Personenbeschreibung
- 3.2 Pflegefamilie als Leistungserbringer und private Familie
- 3.3 Weshalb werden Pflegefamilien benötigt?
- 3.4 Pflegefamilien als geeignete Unterbringung für Kinder
- 4 Prozesse des Scheiterns
- 4.1 Der Begriff des Scheiterns
- 4.2 Abbrüche als Herausnahme oder Rückgabe eines Pflegekindes
- 4.3 Beendigung des Pflegeverhältnisses
- 5 Arten der Beendigung von Pflegeprozessen
- 5.1 Geplante Abbrüche
- 5.1.1 Verselbstständigung und Volljährigkeit
- 5.1.2 Adoption
- 5.1.3 Rückführung
- 5.1.4 Wunsch auf Beendigung
- 5.2 Ungeplante Abbrüche
- 5.3 Kriterien an und für weiterführende Hilfen
- 5.1 Geplante Abbrüche
- 6 Kriterien, die das Scheitern begünstigen
- 6.1 Das Pflegekind
- 6.2 Die Pflegefamilie
- 6.3 Das Jugendamt
- 7 Vorzeitige Beendigungen von Pflegeverhältnissen nach § 33 SGB VIII
- 8 Forschungsmethodik
- 8.1 Die Methode
- 8.1.1 Begriffsbestimmung und Erläuterung der Analyseformen
- 8.1.2 Dokumenten- und Aktenanalyse
- 8.1.3 Vorgehensweise
- 8.2 Ablauf der Untersuchung
- 8.2.1 Vorbereitung der Dokumenten- und Aktenanalyse
- 8.2.2 Ausführung der Dokumenten- und Aktenanalyse
- 8.2.3 Ursprüngliche Vorgehensweise
- 8.3 Auswertung der Ergebnisse
- 8.3.1 Beschreiben des Vorgehens
- 8.3.2 Darstellung und Auswertung
- 8.1 Die Methode
- 9 Auswirkungen auf die Betroffenen
- 10 Beratungstätigkeit und ihre Konsequenzen
- 10.1 Definition Beratung
- 10.1.1 Begleitende Supervision
- 10.1.2 Supervisionen in der Pflegekinderhilfe
- 10.2 Pflegekinderhilfe – mögliche Perspektiven der Weiterentwicklung
- 10.3 Beratung und Begleitung in der Pflegekinderhilfe
- 10.4 Welche pädagogische Unterstützung brauchen Pflegeeltern?
- 10.4.1 Rahmenbedingung für die Beratung, Begleitung und Unterstützung der Pflegefamilie
- 10.4.2 Themen der Beratungsinhalte
- 10.4.3 Ziele der Beratungstätigkeit
- 10.5 Entwicklung von Qualitätsstandards für die Pflegekinderhilfe
- 10.1 Definition Beratung
- 11 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Gründe für die Beendigung von Pflegeverhältnissen und deren Auswirkungen auf die Beratungstätigkeit. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, die zum Scheitern von Pflegeverhältnissen beitragen, und daraus Konsequenzen für die professionelle Beratung abzuleiten.
- Faktoren, die zu einer Beendigung von Pflegeverhältnissen führen
- Arten von Beendigungen (geplant vs. ungeplant)
- Rolle des Jugendamtes im Prozess des Scheiterns
- Auswirkungen auf Pflegekinder und Pflegefamilien
- Konsequenzen für die Beratungspraxis und notwendige Weiterentwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die Gründe für die Beendigung von Pflegeverhältnissen und deren Konsequenzen für die Beratungstätigkeit. Sie legt den Fokus auf die Perspektiven des Kindes und die vielfältigen Faktoren, die zum Abbruch führen können, einschließlich der Rolle des Jugendamtes und der Herausforderungen für die Beratung von betroffenen Parteien.
2 Allgemeine Entwicklungen: Dieses Kapitel dürfte einen Überblick über die allgemeinen Entwicklungen im Pflegekinderwesen geben, möglicherweise einschließlich statistischer Daten und gesetzlicher Rahmenbedingungen. Es legt den Grundstein für das Verständnis des Kontextes, in dem Pflegeverhältnisse stattfinden und enden.
3 Sozialisationsfeld Pflegefamilie: Dieses Kapitel beschreibt das Sozialisationsfeld Pflegefamilie aus verschiedenen Perspektiven: die Situation des Pflegekindes, die Rolle der Pflegefamilie als Leistungserbringer und private Familie, die Notwendigkeit von Pflegefamilien und deren Eignung als Unterbringungsmöglichkeit für Kinder. Es analysiert die komplexen Beziehungen und Interaktionen innerhalb dieses Systems.
4 Prozesse des Scheiterns: Der vierte Abschnitt definiert den Begriff des "Scheiterns" im Kontext von Pflegeverhältnissen und untersucht die Prozesse, die zu Abbrüchen führen. Es werden sowohl die Herausnahme als auch die Rückgabe von Pflegekindern analysiert, und die verschiedenen Perspektiven (Kind, Pflegeeltern, Jugendamt) werden beleuchtet.
5 Arten der Beendigung von Pflegeprozessen: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen geplanten und ungeplanten Abbrüchen. Geplante Abbrüche umfassen beispielsweise Verselbstständigung, Adoption oder Rückführung. Ungeplante Abbrüche werden detailliert untersucht und mit möglichen Ursachen und Folgen analysiert. Es werden auch Kriterien für weiterführende Hilfen diskutiert.
6 Kriterien, die das Scheitern begünstigen: Hier werden die Faktoren aus der Sicht des Pflegekindes, der Pflegefamilie und des Jugendamtes betrachtet, die das Scheitern eines Pflegeverhältnisses begünstigen können. Die Kapitel analysiert individuelle Herausforderungen und systemische Probleme.
7 Vorzeitige Beendigungen von Pflegeverhältnissen nach § 33 SGB VIII: Dieses Kapitel dürfte die gesetzlichen Rahmenbedingungen für vorzeitige Beendigungen von Pflegeverhältnissen im Detail untersuchen. Es wird analysiert, welche Kriterien für eine vorzeitige Beendigung relevant sind und wie diese im Kontext des § 33 SGB VIII gehandhabt werden.
8 Forschungsmethodik: Das Kapitel beschreibt die angewandte Forschungsmethodik, insbesondere die Dokumenten- und Aktenanalyse, und legt die Vorgehensweise der Untersuchung dar. Es wird die Auswahl der Daten und der Auswertungsprozess detailliert erläutert.
9 Auswirkungen auf die Betroffenen: Hier wird die Perspektive der Betroffenen (Kinder, Pflegeeltern) nach der Beendigung eines Pflegeverhältnisses betrachtet. Es wird auf die emotionalen, psychischen und sozialen Auswirkungen eingegangen.
10 Beratungstätigkeit und ihre Konsequenzen: Das zehnte Kapitel untersucht die Beratungstätigkeit in der Pflegekinderhilfe und deren Konsequenzen im Zusammenhang mit der Beendigung von Pflegeverhältnissen. Es definiert Beratung, beschreibt Supervision und legt Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Beratungspraxis dar. Der Fokus liegt auf der notwendigen pädagogischen Unterstützung der Pflegeeltern und der Entwicklung von Qualitätsstandards.
Schlüsselwörter
Pflegeverhältnisse, Pflegefamilien, Pflegekinder, Jugendamt, SGB VIII, Beendigung von Pflegeverhältnissen, Beratungstätigkeit, Scheitern, geplante und ungeplante Abbrüche, Supervision, Qualitätsstandards, Sozialisation, Hilfeplanung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Beendigung von Pflegeverhältnissen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Gründe für die Beendigung von Pflegeverhältnissen und deren Auswirkungen auf die Beratungstätigkeit. Im Fokus stehen die Faktoren, die zum Scheitern von Pflegeverhältnissen beitragen, und die daraus resultierenden Konsequenzen für die professionelle Beratung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Beendigung von Pflegeverhältnissen, darunter die Faktoren, die zu einer Beendigung führen (sowohl geplante als auch ungeplante Abbrüche), die Rolle des Jugendamtes, die Auswirkungen auf Pflegekinder und Pflegefamilien, und die Konsequenzen für die Beratungspraxis und notwendige Weiterentwicklungen. Es werden auch gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. § 33 SGB VIII) betrachtet.
Welche Arten von Beendigungen von Pflegeverhältnissen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen geplanten und ungeplanten Abbrüchen. Geplante Abbrüche umfassen Verselbstständigung, Adoption oder Rückführung des Kindes. Ungeplante Abbrüche werden detailliert untersucht, inklusive möglicher Ursachen und Folgen.
Welche Rolle spielt das Jugendamt bei der Beendigung von Pflegeverhältnissen?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Jugendamtes im Prozess des Scheiterns von Pflegeverhältnissen und untersucht dessen Einfluss auf die verschiedenen beteiligten Parteien (Pflegekind, Pflegefamilie).
Welche Auswirkungen haben beendete Pflegeverhältnisse auf die Betroffenen?
Die Arbeit beleuchtet die emotionalen, psychischen und sozialen Auswirkungen beendeter Pflegeverhältnisse auf Pflegekinder und Pflegefamilien.
Wie sieht die Forschungsmethodik der Arbeit aus?
Die Arbeit verwendet eine Dokumenten- und Aktenanalyse als Forschungsmethode. Die Vorgehensweise bei der Auswahl der Daten und der Auswertungsprozess werden detailliert beschrieben.
Welche Konsequenzen werden für die Beratungspraxis abgeleitet?
Die Arbeit leitet aus den Untersuchungsergebnissen Konsequenzen für die Beratungspraxis ab und schlägt Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Beratung in der Pflegekinderhilfe vor, einschließlich der notwendigen pädagogischen Unterstützung der Pflegeeltern und der Entwicklung von Qualitätsstandards.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, die von einer Einleitung über die Beschreibung des Sozialisationsfeldes Pflegefamilie, die Prozesse des Scheiterns und die Arten der Beendigung von Pflegeverhältnissen bis hin zur Forschungsmethodik, den Auswirkungen auf die Betroffenen, der Beratungstätigkeit und ihren Konsequenzen sowie einer Zusammenfassung reichen. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgelistet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pflegeverhältnisse, Pflegefamilien, Pflegekinder, Jugendamt, SGB VIII, Beendigung von Pflegeverhältnissen, Beratungstätigkeit, Scheitern, geplante und ungeplante Abbrüche, Supervision, Qualitätsstandards, Sozialisation, Hilfeplanung.
- Quote paper
- Julia Zander (Author), 2014, Gründe für die Beendigung von Pflegeverhältnissen in Pflegefamilien und Konsequenzen für die Beratungstätigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305402