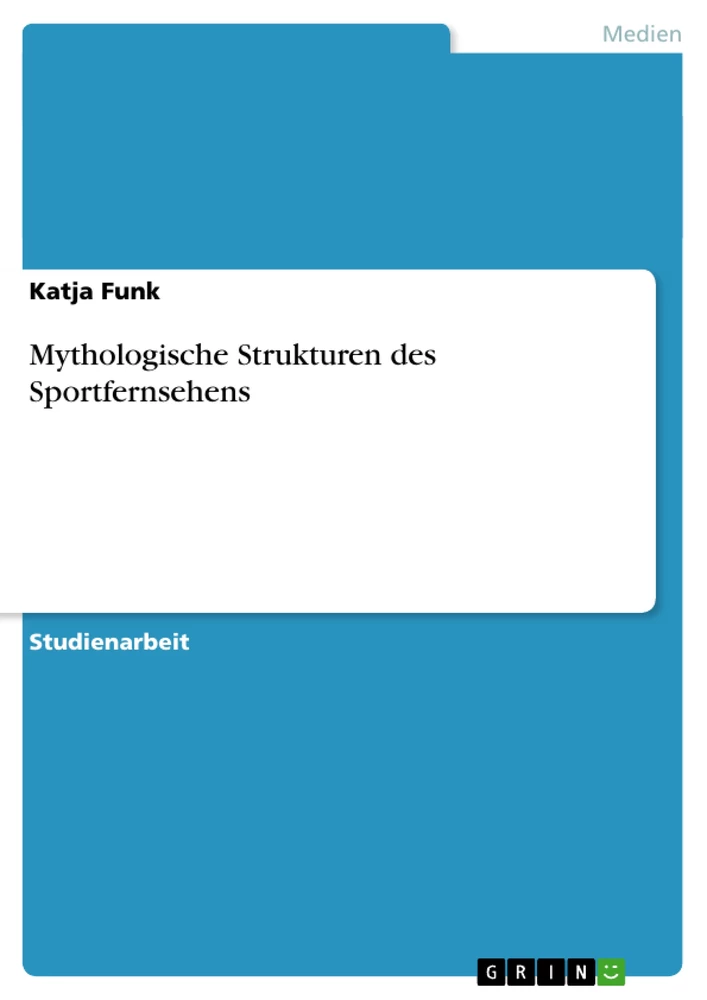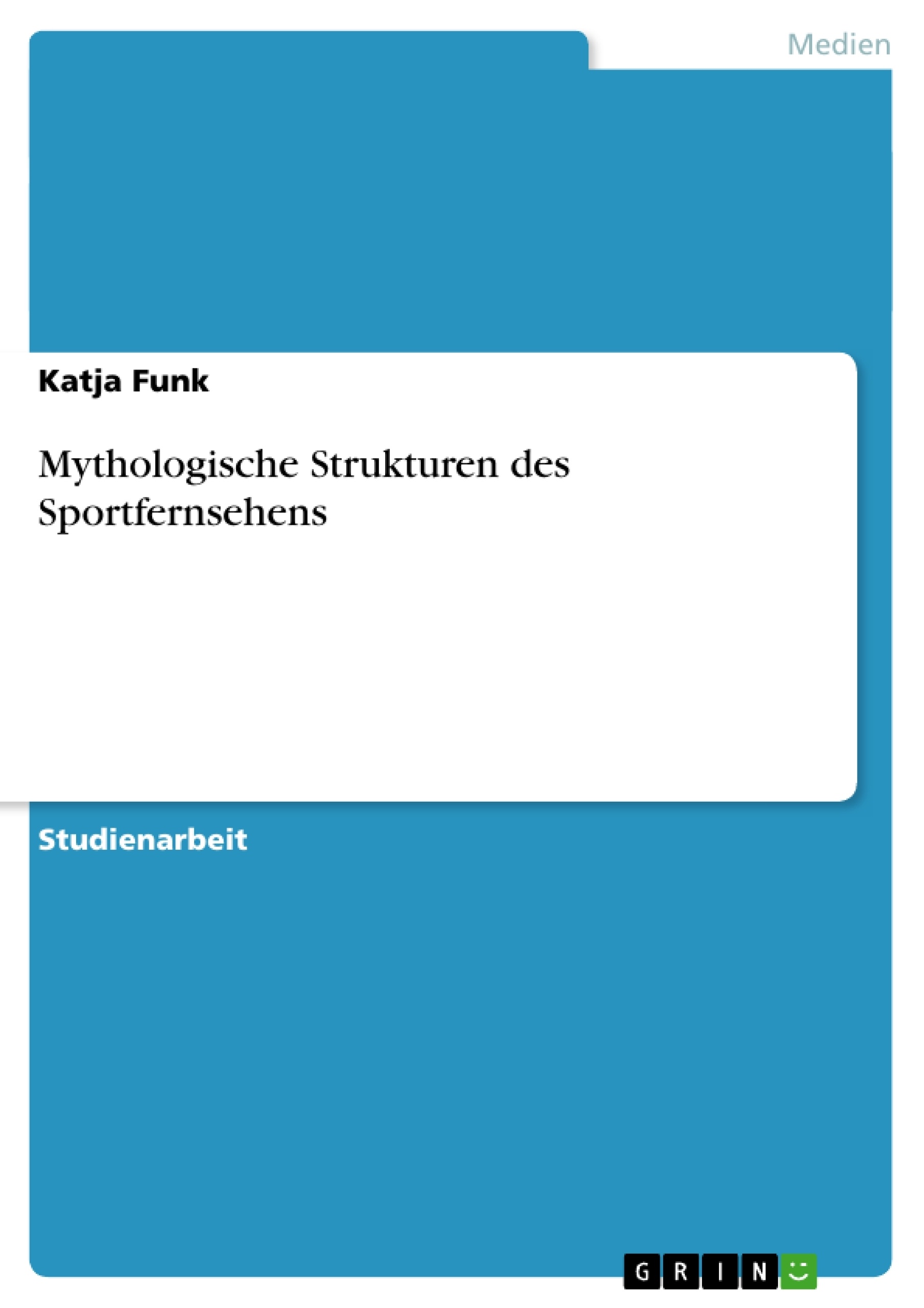Bereits zu Zeiten der griechischen Antike erklärte man die Welt anhand einer Vielzahl symbolischer Erzählungen – den Mythen. Diese weit verbreiteten Mythologien boten den Menschen auch, anders als die Religion, irdische Erklärungen für „die Welt“ an.
„Mythen sind […] Deutungen und Darstellungen lebensweltlicher, natürlicher und kosmischer Zusammenhänge […]. Sie geben Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Es sind aber in der Regel Antworten, die den Menschen nicht in seiner Vereinzelung, sondern als Gemeinschaftswesen ansprechen. Mythen haben eine praktische Funktion: Sie wirken mit an der Herausbildung und Festigung eines gesellschaftlichen Ethos.“
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat nun das Massenmedium Fernsehen jenen Platz eingenommen, den in der Antike der Mythos innehatte. Dieser beinhaltet unter anderem eine zentrale Rolle als Vermittler kultureller, aber auch gesellschaftlicher Werte. Das Fernsehen, mit seiner stets präsenten Angebotsstruktur, erzählt wie der Mythos rund um die Uhr endlose Variationen von Geschichten. Fügt man diese einzelnen Erzählungen zusammen, so ist es möglich, die Welt in ihrer gesamten Komplexität wahrzunehmen und zu verstehen.
In dieser Arbeit soll am Beispiel des Sportfernsehens und den Mythologien der griechischen Antike gezeigt werden, dass Mythos und Fernsehen aber nicht nur inhaltliche Analogien aufweisen. Es soll herausgestellt werden, dass unsere eigentlich nicht mythologische Gesellschaft noch wesentlich mehr von den Eigenschaften und der Erzählstruktur des antiken Mythos übernommen hat.
Zunächst wird versucht, dem Mythos aus Sicht des französischen Strukturalisten Roland Barthes auf die Spur zu kommen. Er erklärt mit Hilfe der Semiotik, was Mythos ist und wie sich jener definiert. Danach werden Mythos und Fernsehen in ihrer kollektiven Bedeutung analysiert, um später das mythische Potential des Mediums Sportfernsehen herauszustellen.
Im nächsten Kapitel folgt dann eine Betrachtung des Sportfernsehens als Narrationssystem, welches im Vergleich mit dem Erzählsystem Mythos dargestellt wird. Der letzte Abschnitt widmet seine Aufmerksamkeit schließlich den eigentlichen Helden von Mythos und Fernsehen, in dem die Personengebundenheit der einzelnen Narrationen näher analysiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Mythos nach Roland Barthes
- 2.1 Eine erste Definition
- 2.2 Der Mythos ist eine Aussage
- 3. Die Groß Erzähler Mythos und Fernsehen
- 3.1 Kollektive Bedeutung von Mythos und Fernsehen
- 3.1.1 Der Mythos in der griechischen Antike
- 3.1.2 Mythos und Fernsehen als Weltvermittler
- 3.1.3 Vermittlung von Werten und Verhaltensanweisungen
- 3.2 Die Medien und ihr mythisches Potential
- 3.3 Sport im Fernsehen – Fernsehsport
- 3.3.1 Kult, Information und Unterhaltung
- 3.3.2 Inszenierung und Dramatisierung
- 3.3.3 Ritual und Mythos im Sportfernsehen
- 4. Zur mythologischen Struktur des Sportfernsehens
- 4.1 Das Narrationssystem Mythos
- 4.1.1 Die Vermittlungsstrukturen des Mythos
- 4.1.2 Symbole und ihre Verweisfunktionen
- 4.2 Analogien zwischen Mythos und Fernsehen auf formaler Ebene
- 4.2.1 Die additive Struktur der Narrationen
- 4.2.2 Die doppelte Vermittlungsstruktur
- 4.2.3 Zur mythischen Zeitstruktur
- 4.2.4 Das Programm als Narrationstruktur des Fernsehens
- 4.2.5 Programmformen
- 4.3 Narrative Grundelemente des Sportfernsehens
- 4.3.1 Formen des Zeigens
- 4.3.1.1 Die Live- Übertragung
- 4.3.1.2 Die Live- Reportage
- 4.3.2 Formen des Berichtens
- 4.3.2.1 Sportnachrichten
- 4.3.2.2 Das Sportmagazin
- 4.3.3 Formen des Spiels
- 4.4 Die Personengebundenheit im Sportfernsehen
- 4.4.1 Götter des Sports
- 4.4.2 Zur Heldenstruktur sportiver Informationssendungen
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Analogien zwischen Mythos und Fernsehen, insbesondere im Bereich des Sportfernsehens, aufzuzeigen. Dabei wird die semiologische Definition des Mythos nach Roland Barthes als Grundlage für die Analyse des Sportfernsehens als Narrationssystem verwendet.
- Kollektive Bedeutung von Mythos und Fernsehen als Weltvermittler
- Mythisches Potential des Mediums Fernsehen
- Sportfernsehen als Narrationssystem
- Analogien zwischen Mythos und Sportfernsehen auf formaler Ebene
- Personengebundenheit im Sportfernsehen und die Rolle von Heldenfiguren
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Einleitung gegeben und der Ausgangspunkt der Arbeit, die Verbindung von Mythos und Fernsehen, erläutert. Im zweiten Kapitel wird der Begriff des Mythos nach Roland Barthes definiert und in seinen semiologischen Kontext eingeordnet. Im dritten Kapitel werden Mythos und Fernsehen in ihrer kollektiven Bedeutung analysiert und das mythische Potential des Mediums Fernsehen herausgestellt. Das vierte Kapitel widmet sich der Analyse des Sportfernsehens als Narrationssystem und stellt Vergleiche mit dem Erzählsystem des Mythos an. Das fünfte Kapitel behandelt die Personengebundenheit im Sportfernsehen und die Rolle von Heldenfiguren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenbereichen Mythos, Fernsehen, Sportfernsehen, Narrationssystem, Semiotik, Roland Barthes, kollektive Bedeutung, Vermittlung von Werten, Heldenstruktur und Personengebundenheit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Verbindung besteht zwischen Mythos und Fernsehen?
Das Fernsehen hat heute die Rolle übernommen, die früher der Mythos innehatte: Es vermittelt kulturelle Werte und erklärt die Welt durch endlose Erzählungen.
Wie definiert Roland Barthes den Mythos?
Barthes sieht den Mythos als ein semiologisches System, in dem eine Aussage eine zusätzliche, kulturell geprägte Bedeutung erhält.
Warum ist Sportfernsehen besonders mythisch?
Sportfernsehen nutzt Rituale, Inszenierungen und Heroisierungen, die stark an die antiken Götter- und Heldengeschichten erinnern.
Was sind die narrativen Grundelemente des Sportfernsehens?
Dazu gehören Formen des Zeigens (Live-Übertragungen), des Berichtens (Sportnachrichten) und des Spiels.
Wer sind die "Helden" im Sportfernsehen?
Sportler werden oft als "Götter des Sports" inszeniert, wobei ihre Leistungen in eine klassische Heldenstruktur eingebettet werden.
- Arbeit zitieren
- Katja Funk (Autor:in), 2004, Mythologische Strukturen des Sportfernsehens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30571