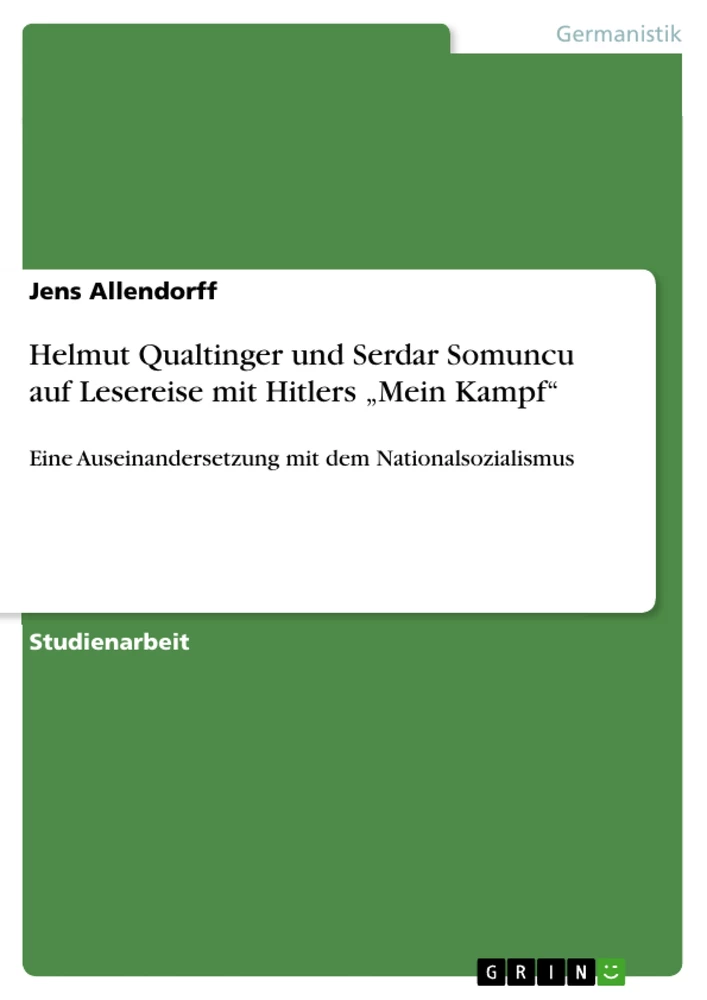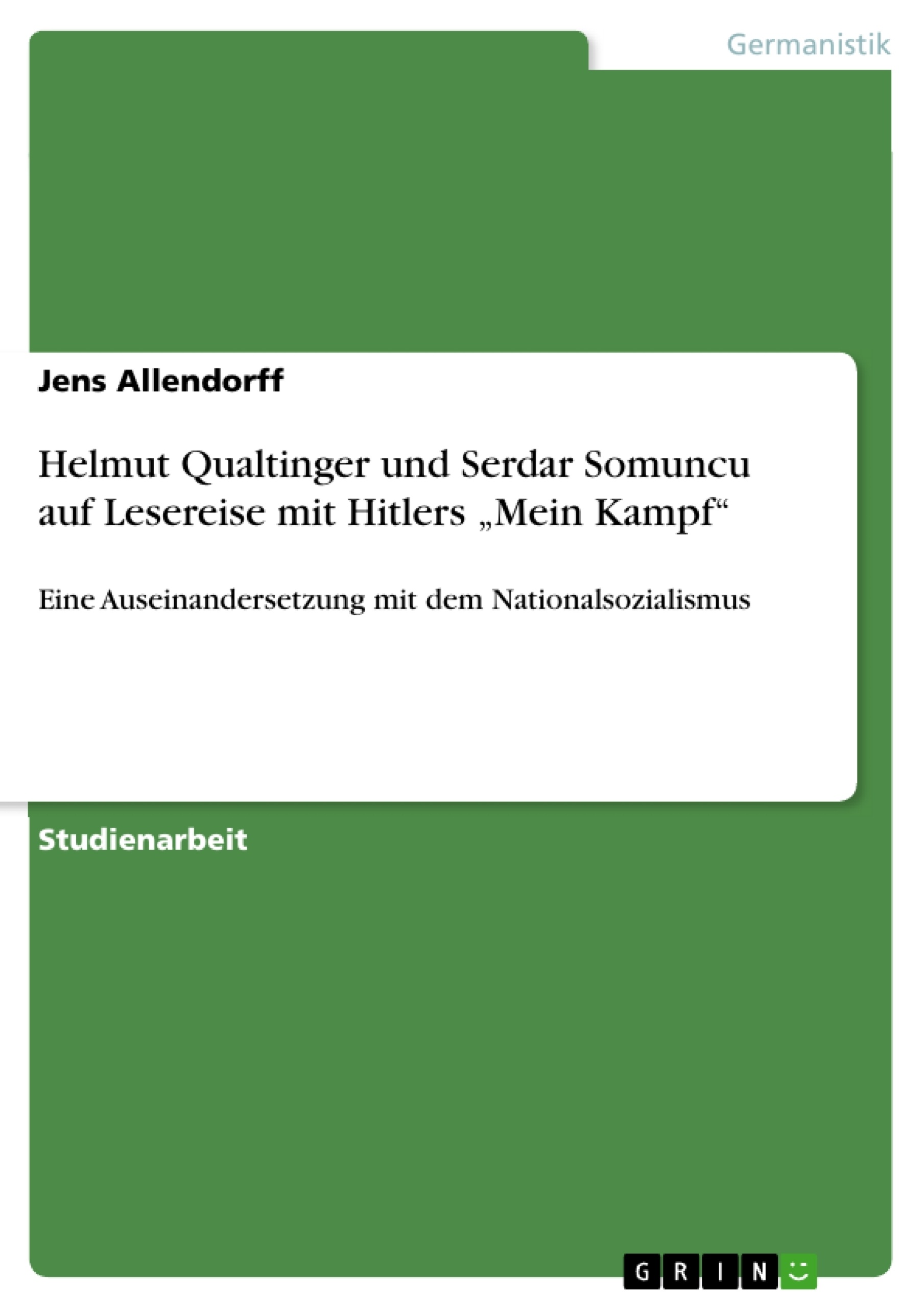Helmut Qualtinger, der österreichische Menschenimitator, und Serdar Somuncu, ein deutscher Schauspieler und Kabarettist türkischer Herkunft, haben sich in ihrer ganz eigenen Weise mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt und ließen die deutsche Öffentlichkeit daran teilhaben. Beide begaben sich mit Hitlers Autobiographie „Mein Kampf“ auf Lesereise durch Deutschland und Europa. Qualtinger wohl aus einem inneren Bedürfnis heraus, Somuncu eher durch Zufall. Beachtenswert erscheint in diesem Zusammenhang auch der persönliche und historische Kontext der Künstler zu sein.
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Künstler im Umgang mit diesem brisanten Thema aufzuzeigen und deren Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu untersuchen.
- Quote paper
- Jens Allendorff (Author), 2008, Helmut Qualtinger und Serdar Somuncu auf Lesereise mit Hitlers „Mein Kampf“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305814