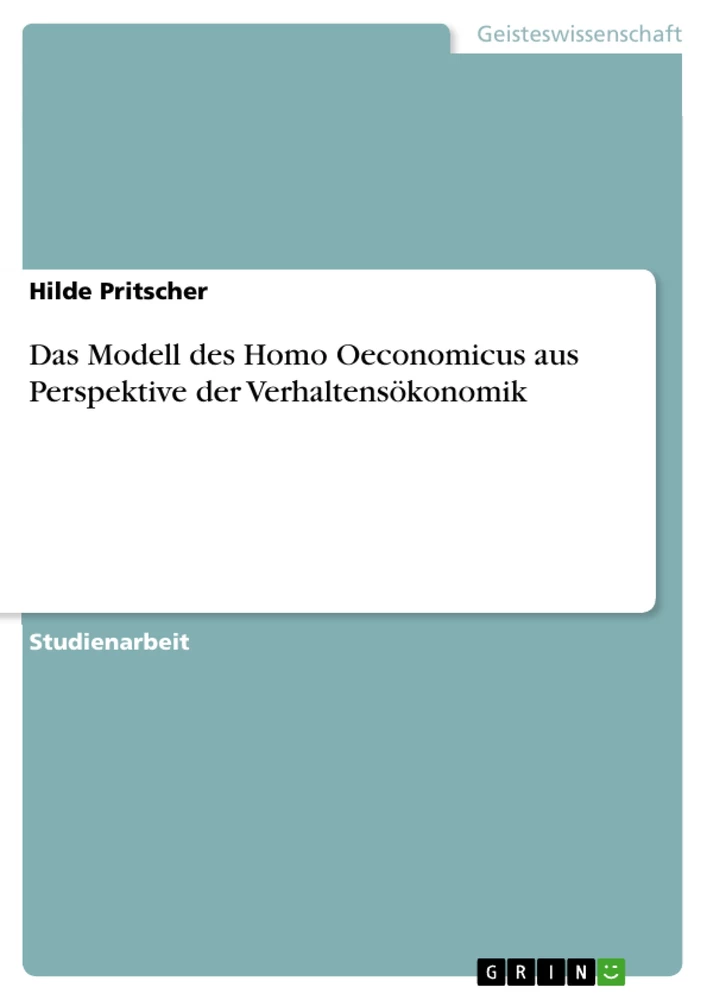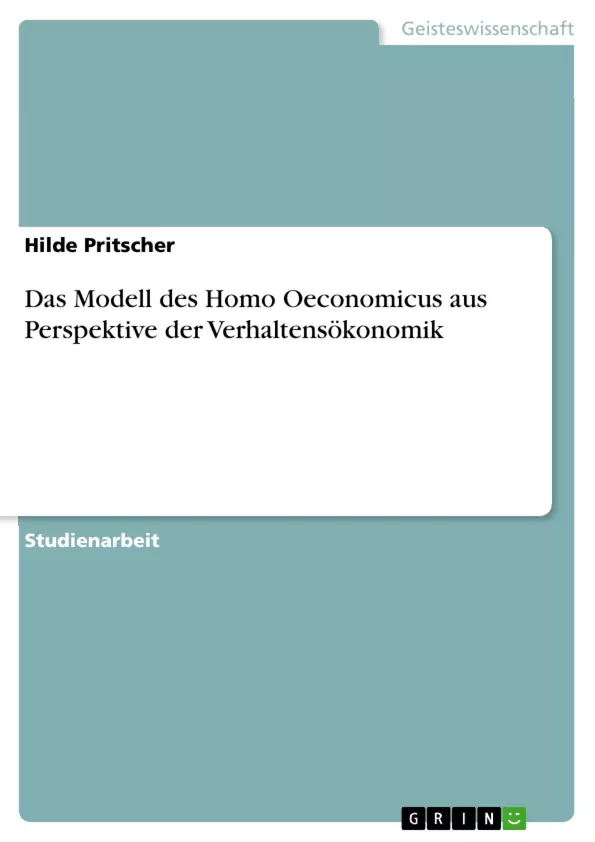Zeitungsartikel zum Thema dieser Arbeit tragen Titel wie „Der Homo oeconomicus lebt“, „Der Homo oeconomicus ist tot“ oder „Totgesagte leben länger“. Solche Überschriften lassen darauf schließen, dass es unterschiedliche und sich gegenseitig ausschließende Positionen zu diesem Thema gibt, die anscheinend sehr vehement vertreten werden.
In Bezug darauf beschäftigt sich das Folgende mit der Position der Verhaltensökonomik zum Homo oeconomicus. Dazu wird zunächst eine Definition von Verhaltensökonomik vorgenommen und der „Homo oeconomicus“ im Rahmen der traditionellen Ökonomik vorgestellt.
Darauf baut anschließend die Kritik am homo oeconomicus aus verhaltensökonomischer Sicht auf, hauptsächlich in Bezug auf einzelne Aspekte der vorgenommenen Definition des Homo oeconomicus. In diesem Rahmen werden zahlreiche Experimente genannt, um die Kritik zu veranschaulichen. Da der Umfang aller Versuche in Bezug auf die einzelnen Kritikpunkte den Rahmen der Arbeit sprengen würde, ist hier jeweils lediglich ein Beispiel genannt.
In der abschließenden Bewertung werden allgemeine Konsequenzen aus der Zusammenschau von klassischer Ökonomik und Verhaltensökonomik gezogen und schließlich eingeschätzt, welcher der eingangs genannten Titel aus Sicht der Verhaltensökonomik am ehesten vertreten werden könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Verhaltensökonomik
- Definition von Homo Oeconomicus
- Völlige Markttransparenz
- Wirtschaftliche Rationalität
- Unmittelbares Erreichen zeitstabiler Ziele
- Verhaltensökonomische Kritik am Homo oeconomicus
- Völlige Markttransparenz
- Wirtschaftliche Rationalität
- Heuristiken
- Framing-Effekt
- Fairness und Reziprozität
- Unmittelbares Erreichen zeitstabiler Ziele
- Abschließende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Menschenbild des Homo Oeconomicus aus der Perspektive der Verhaltensökonomik. Der Fokus liegt auf der Analyse der traditionellen Definition des Homo Oeconomicus und der Kritik, die die Verhaltensökonomik an diesem Modell übt. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die drei zentralen Merkmale des Homo Oeconomicus - Markttransparenz, wirtschaftliche Rationalität und das unmittelbare Erreichen zeitstabiler Ziele - und untersucht, inwiefern verhaltensökonomische Forschungsergebnisse diese Annahmen in Frage stellen.
- Die Definition von Verhaltensökonomik und die Abgrenzung zur traditionellen Ökonomik
- Die Kritik an den Annahmen über die vollständige Markttransparenz des Homo Oeconomicus
- Die Widerlegung der Rationalitätsannahme und die Rolle von Heuristiken und Framing-Effekten
- Die Frage nach der Fairness und Reziprozität im menschlichen Verhalten im Vergleich zur egoistischen Natur des Homo Oeconomicus
- Die empirische Evidenz für zeitinkonsistente Ziele und die Kritik am Konzept der zeitstabilen Präferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die unterschiedlichen Positionen zum Homo Oeconomicus dar. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit, sich mit der Verhaltensökonomik zu befassen und legt den Schwerpunkt auf die Kritik am Homo Oeconomicus aus verhaltensökonomischer Sicht. Die Arbeit verspricht zudem, verschiedene Experimente zur Veranschaulichung der Kritik zu nennen.
Definition von Verhaltensökonomik
Dieses Kapitel definiert Verhaltensökonomik als ein Feld der Wirtschaftswissenschaften, das sich mit der Einbeziehung von psychologischen, soziologischen und neurobiologischen Erkenntnissen in die Analyse wirtschaftlicher Beziehungen beschäftigt. Der Fokus liegt auf der Infragestellung des Homo Oeconomicus-Modells und der Suche nach einer umfassenderen Betrachtungsweise des menschlichen Verhaltens in wirtschaftlichen Kontexten.
Definition von Homo Oeconomicus
Dieses Kapitel stellt das traditionelle Menschenbild der Wirtschaftswissenschaft, den Homo Oeconomicus, vor. Es beschreibt seine Kernmerkmale: die Annahme der vollständigen Markttransparenz, die wirtschaftliche Rationalität und die unmittelbare Verfolgung zeitstabiler Ziele. Es werden zudem die historischen Wurzeln des Modells im 19. Jahrhundert und die Einflussnahme von John Stuart Mill, Leon Walras und Adam Smith erläutert.
Völlige Markttransparenz
Dieses Kapitel diskutiert das Merkmal der Markttransparenz des Homo Oeconomicus und stellt die Kritik der Verhaltensökonomik an dieser Annahme vor. Es werden Argumente von Simon und V. Smith herangezogen, die behaupten, dass Menschen nur begrenzte Ausschnitte der Wirklichkeit wahrnehmen können. Es werden zudem verschiedene Beispiele für Urteilsverzerrungen (Biases) vorgestellt, die die Annahme der Markttransparenz infrage stellen, wie z. B. die Verfügbarkeitsheuristik und die Überschätzung der eigenen Kontrolle. Der Herdeneffekt und die Bestätigungsneigung werden ebenfalls als weitere Beispiele für die begrenzte Markttransparenz diskutiert.
Wirtschaftliche Rationalität
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Kritik am Konzept der wirtschaftlichen Rationalität des Homo Oeconomicus. Es wird erläutert, dass Menschen häufig nicht rational handeln, sondern sich auf einfache Daumenregeln, sogenannte Heuristiken, verlassen. Das Kapitel führt verschiedene Beispiele für Heuristiken auf, wie z. B. die Verankerungs- und Anpassungsheuristik und die Prospect Theorie von Kahneman und Tversky. Weiterhin wird der Framing-Effekt als ein Phänomen behandelt, das die Annahme der Rationalität in Frage stellt. Es wird betont, dass Entscheidungen stark davon abhängen, wie Informationen präsentiert werden und wie Entscheidungsalternativen aufgezeigt werden. Auch der Ausstattungs- oder Besitztumseffekt wird als Beleg für die begrenzte Rationalität des Menschen betrachtet.
Fairness und Reziprozität
Dieses Kapitel beleuchtet die Kritik am Egoismus des Homo Oeconomicus. Es wird das Ultimatumspiel als ein Experiment vorgestellt, das zeigt, dass Menschen ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl besitzen und bereit sind, auf eigene finanzielle Vorteile zu verzichten, um Ungleichheit zu reduzieren. Es wird zudem das Prinzip der Reziprozität als ein weiterer Beleg für die Existenz von prosozialen Motiven im menschlichen Verhalten betrachtet. Reziprozität beschreibt die Tendenz von Menschen, kooperatives Verhalten zu belohnen und unfaires Verhalten zu bestrafen, selbst wenn dies finanzielle Nachteile mit sich bringt.
Unmittelbares Erreichen zeitstabiler Ziele
Dieses Kapitel hinterfragt die Annahme des Homo Oeconomicus, seine Ziele unmittelbar und ohne Zögern zu verfolgen. Es wird gezeigt, dass Menschen häufig zu Zeitinkonsistenz neigen, d. h. dass sie ihre Präferenzen über die Zeit hinweg ändern. Als Beweis dafür wird ein Experiment vorgestellt, das zeigt, dass Menschen unangenehme Aufgaben lieber in die Zukunft verschieben, aber gleichzeitig auch den Zeitaufwand für diese Aufgaben in der Zukunft gering halten möchten. Dieses Phänomen wird mit der mangelnden Selbstkontrolle und den zeitinkonsistenten Zielen erklärt.
Abschließende Bewertung
Die abschließende Bewertung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht allgemeine Konsequenzen aus der Auseinandersetzung zwischen klassischer Ökonomik und Verhaltensökonomik. Es wird betont, dass der Homo Oeconomicus als Modell unzureichend ist, um menschliches Verhalten in wirtschaftlichen Kontexten realistisch abzubilden. Die Arbeit plädiert für einen Dialog zwischen den beiden Disziplinen und die Integration der Stärken beider Ansätze in einem gemeinsamen Modell. Es wird angemerkt, dass die Erweiterungen des Homo Oeconomicus-Modells, wie z. B. der REMM, die begrenzte Markttransparenz und die Berücksichtigung von Transaktionskosten, wichtige Schritte in die richtige Richtung darstellen. Abschließend wird die Meinung vertreten, dass der Homo Oeconomicus aus Sicht der Verhaltensökonomik zwar "tot" ist, aber dass es dennoch notwendig ist, nach einem neuen, realistischeren Menschenbild zu suchen, das die Erkenntnisse beider Disziplinen integriert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokus-Themen der Arbeit sind: Verhaltensökonomik, Homo Oeconomicus, Markttransparenz, wirtschaftliche Rationalität, Urteilsverzerrungen (Biases), Heuristiken, Framing-Effekte, Fairness, Reziprozität, Zeitinkonsistenz, Zeitpräferenzen, Experimente, Modellkritik, Menschenbild, Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernmerkmale des Homo Oeconomicus?
Der Homo Oeconomicus zeichnet sich durch vollständige Markttransparenz, wirtschaftliche Rationalität und das unmittelbare Erreichen zeitstabiler Ziele aus.
Wie kritisiert die Verhaltensökonomik dieses Modell?
Sie argumentiert, dass Menschen nur begrenzt rational handeln, Heuristiken nutzen und durch Framing-Effekte beeinflussbar sind.
Welche Rolle spielen Fairness und Reziprozität?
Im Gegensatz zum egoistischen Homo Oeconomicus zeigen Experimente wie das Ultimatumspiel, dass Menschen einen Sinn für Gerechtigkeit haben und unfaires Verhalten bestrafen.
Was bedeutet „Zeitinkonsistenz“ in diesem Zusammenhang?
Es beschreibt das Phänomen, dass Menschen ihre Präferenzen über die Zeit ändern und oft kurzfristige Belohnungen langfristigen Zielen vorziehen.
Ist der Homo Oeconomicus heute noch aktuell?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das klassische Modell „tot“ ist, aber als theoretischer Bezugspunkt für realistischere Menschenbilder (wie den REMM) weiterhin dient.
- Quote paper
- Hilde Pritscher (Author), 2014, Das Modell des Homo Oeconomicus aus Perspektive der Verhaltensökonomik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305830