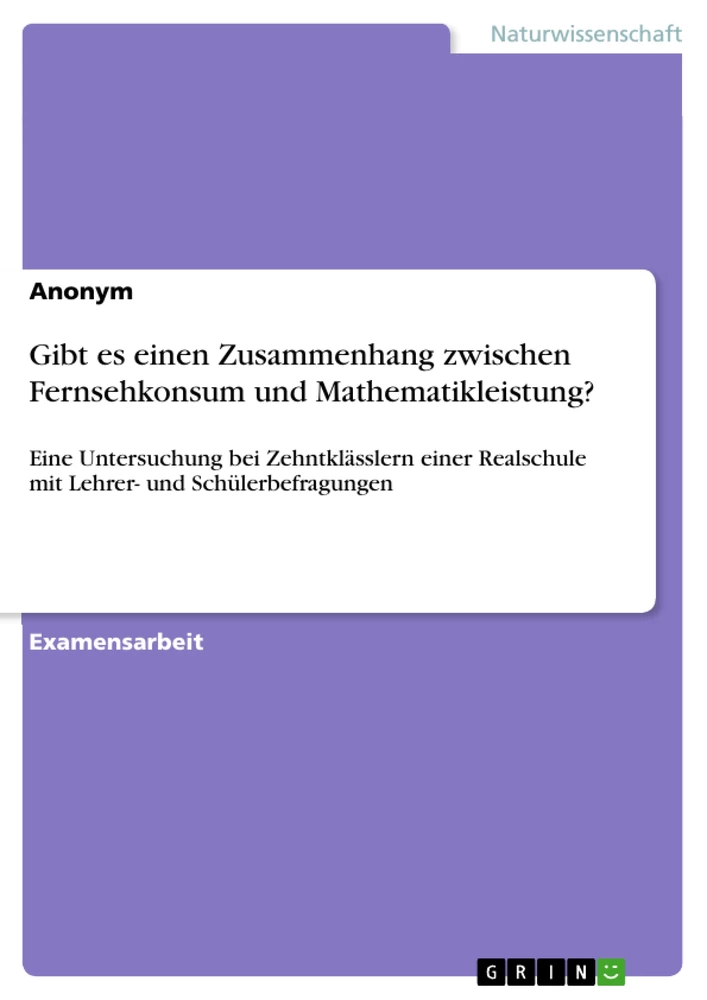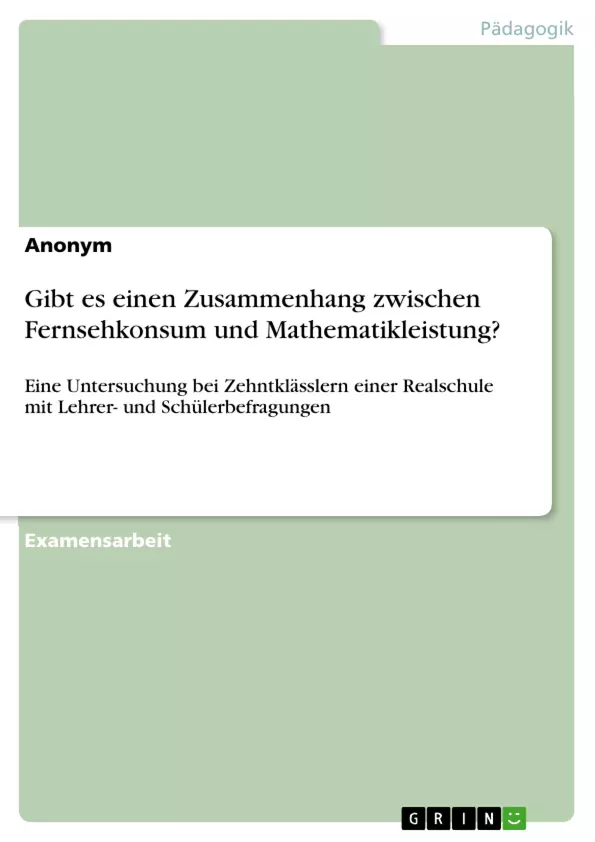„58,2 % der Jungen und 55,5 % der Mädchen sehen mehr fern als empfohlen (also täglich mehr als zwei Stunden)“ (Health Behaviour in School-Aged Children, 2011, S. 2). Durch diese Befunde ergibt sich, dass das Fernsehen einen entscheidenden Teil des Alltags der Schülerinnen und Schüler bestimmt. Kritiker unterstellen dem Fernsehen einen negativen Einfluss auf den schulischen Erfolg. Der deutsche Psychologe Manfred Spitzer geht mit dieser Hypothese noch weiter und unterstellt dem Fernsehen, die Jugendlichen dick, kriminell, einsam und früher sterblich zu machen. Um zu untersuchen, in welcher Beziehung diese Hypothesen mit dem schulischen Erfolg stehen, beschäftigt sich diese Arbeit mit einer Analyse des Zusammenhangs zwischen Fernsehkonsum und Mathematikleistung bei Zehntklässlern einer Realschule. Als Grundlage dieser Diskussion dient eine an der 10. Klasse einer Realschule durchgeführte Studie.
Diese Arbeit setzt sich zunächst mit dem Gebiet der Rechenstörungen auseinander, da Rechnen neben Lesen und Schreiben zu den allgemeinen Kulturtechniken gehört. Es wird ein kurzer Einblick in dieses Themengebiet gegeben und anhand der Diskrepanzdefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) reflektiert. Anhand dreier Fallbeispiele sollen Erkrankungsbilder und Ursachenfelder exemplarisch betrachtet werden. Der zweite Teil dieser Arbeit stellt den eigentlichen Kern dar: das Thema „Medien und Bildung“.
Zunächst wird der Medienbegriff kurz eingeordnet, um exemplarisch die extremen Positionen Manfred Spitzers und Steven Johnsons darzustellen und zu diskutieren. Durch die Vorstellung empirischer Untersuchungen wie der „Kinder und Medien“ (KIM)-Studie, Sesamstraßen-Studie, der Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest und weiteren soll der aktuelle Forschungsstand im Bereich Medienkonsum aufgezeigt und heraus-gearbeitet werden, dass Fernsehen Kinder und Jugendliche signifikant beeinflusst. Studien im Bereich Mediennutzung und Fernsehkonsum beschäftigen sich überwiegend mit den Einflüssen auf sprachliche und verbale Faktoren wie Lese- und Rechtschreibfähigkeit. Die numerischen bzw. mathematischen Auswirkungen werden dabei weitgehend vernachlässigt. [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Zielsetzung und Relevanz der Untersuchung
- Hypothesen
- Theoretischer Hintergrund
- Fernsehkonsum und kognitive Entwicklung
- Fernsehkonsum und Schulleistung
- Die Rolle der Medienkompetenz
- Das Konzept der Rechenstörung (Dyskalkulie)
- Methodik
- Stichprobe
- Erhebungsinstrumente
- Datenanalyse
- Ergebnisse
- Deskriptive Ergebnisse
- Fernsehkonsum der Schüler
- Lehrerbewertung der Schüler
- Mathematische Leistungen der Schüler
- Freizeitverhalten der Schüler
- Zusammenhangsanalysen
- Fernsehkonsum und Lehrerbewertung
- Fernsehkonsum und mathematische Leistungen
- Fernsehkonsum, Freizeitverhalten und Lehrerbewertung
- Diskussion
- Zusammenfassende Interpretation der Ergebnisse
- Bedeutung für die Praxis
- Limitationen der Studie
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Fernsehkonsum auf die mathematischen Leistungen von Grundschulkindern. Dabei werden nicht nur die Dauer des Fernsehkonsums, sondern auch die Art des konsumierten Programms und die sonstigen Freizeitaktivitäten der Schüler berücksichtigt. Ziel ist es, Zusammenhänge zwischen dem Fernsehkonsum und den mathematischen Leistungen der Schüler zu identifizieren und zu analysieren.
- Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Lehrerbewertung
- Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und mathematischen Leistungen
- Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Freizeitverhalten
- Rolle der Medienkompetenz
- Auswirkungen von Fernsehkonsum auf die kognitive Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und Relevanz der Untersuchung vor und erläutert die zugrundeliegenden Hypothesen. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund und beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Fernsehkonsum und kognitiver Entwicklung, Fernsehkonsum und Schulleistung, die Rolle der Medienkompetenz und das Konzept der Rechenstörung (Dyskalkulie). Das dritte Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung, einschließlich der Stichprobe, der Erhebungsinstrumente und der Datenanalyse. Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, einschließlich der deskriptiven Ergebnisse und der Zusammenhangsanalysen. Die Diskussion fasst die Ergebnisse zusammen und interpretiert sie im Hinblick auf die Forschungsfragen. Dabei werden auch die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis, die Limitationen der Studie und der Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Fernsehkonsum, Schulleistung, Mathematik, Lehrerbewertung, Freizeitverhalten, Medienkompetenz, Rechenstörung, Dyskalkulie.
Häufig gestellte Fragen
Beeinflusst Fernsehkonsum die Mathematikleistung von Schülern?
Die Arbeit untersucht diesen Zusammenhang und analysiert, ob hoher Fernsehkonsum negative Auswirkungen auf die schulischen Leistungen in Mathematik hat.
Wie viel Fernsehen wird für Kinder empfohlen?
Laut zitierten Studien sehen über 50 % der Jungen und Mädchen mehr als die empfohlenen zwei Stunden täglich fern.
Was sagen Kritiker wie Manfred Spitzer zum Fernsehen?
Spitzer vertritt die radikale These, dass Fernsehen Kinder „dick, kriminell und einsam“ macht und die kognitive Entwicklung schädigt.
Was ist eine Rechenstörung (Dyskalkulie)?
Dyskalkulie ist eine Beeinträchtigung der Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch Intelligenzminderung oder unangemessene Beschulung erklärt werden kann.
Welche Rolle spielt die Medienkompetenz?
Die Arbeit beleuchtet, dass nicht nur die Dauer, sondern auch die Art des Konsums und die Fähigkeit zur kritischen Mediennutzung entscheidend sind.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Gibt es einen Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Mathematikleistung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306031