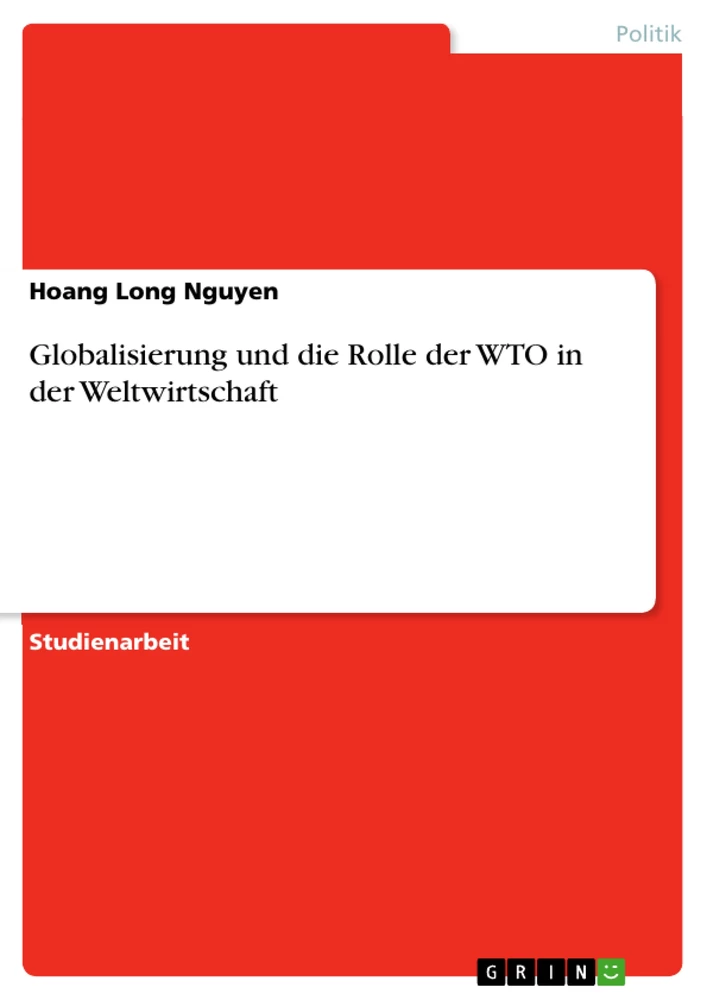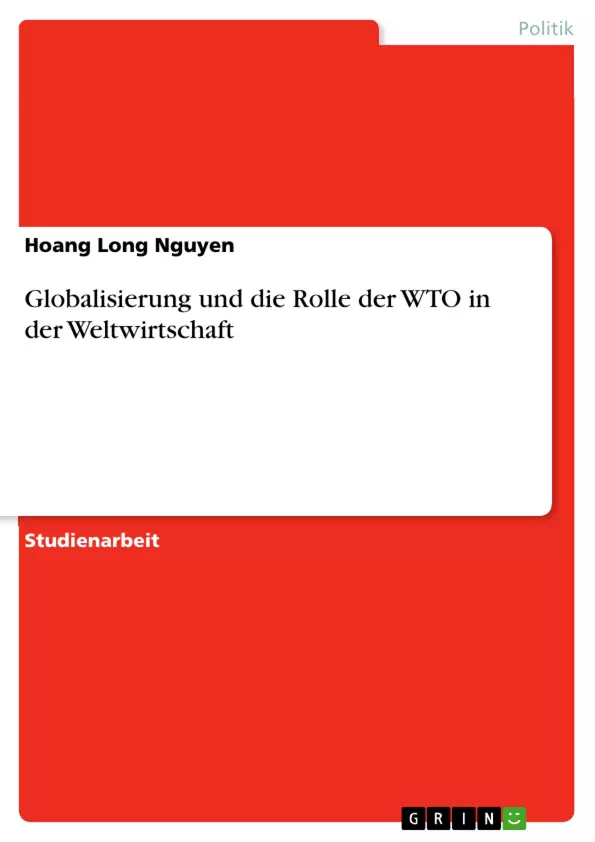Globalisierung ist ein Wort, das immer wieder in der Wirtschaft, Politik, Öffentlichkeit sowie in den Medien fällt und benutzt wird. Viele wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Debatten der Gegenwart sind geprägt von diesem Begriff. Besonders die Auswirkungen dieses Phänomens sind es, die die Meinung der Öffentlichkeit teilt. Die Begriffsdefiniton von Globalisierung wird jedoch stets unterschiedlich ausfallen, je nachdem in welchem Zusammenhang und Fachgebiet das Wort fällt.
Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Vernetzung von Kontinenten und Ländern steigen ebenfalls die Risiken für die Weltwirtschaft immens. Finanzkrisen, wie die von der US-Investmentbank Lehman Brothers ausgelöst, haben einen erheblichen Einfluss auf die globalen Märkte. In Europa bangt man um die Existenz der europäischen Währungsunion. Der aktuelle Umbruch in der Ukraine und das Bestreben nach Aufnahme in die EU der überschuldeten, prowestlichen Regierung des Landes, spaltet die Meinungen der EU-Bürger. Verständlich, wenn man sich die aktuellen, negativen Entwicklungen in den Staaten wie Griechenland, trotz Euro-Rettungsschirms, betrachtet. Der Mensch muss mit diesem Phänomen sowohl jetzt, als auch in Zukunft damit leben, denn Fakt ist, dass sich der Prozess der Globalisierung nicht mehr aufhalten lässt. Tatsache ist auch, dass es immer Gegner und Befürworter zu dieser Entwicklung geben wird.
Das Thema Globalisierung ist komplex und vielseitig. In der öffentlichen Debatte werden hauptsächlich kulturelle, politische und wirtschaftliche Aspekte angesprochen. In dieser Arbeit beschränkt man sich im Kernbereich nur auf letzteren beiden.
Folgende Fragestellungen stehen in dieser Hausarbeit im Mittelpunkt:
Wie beeinflusst die Globalisierung den Welthandel?
Welche Funktion übernimmt dabei die internationale Organisation WTO?
Zunächst einmal wird in der Einleitung, der facettenreiche Begriff der Globalisierung definiert. Daraufhin wird die Geschichte und Ursache dieses Phänomens erläutert. Aufbauend darauf, werden die Chancen und Risiken gegenübergestellt. Im Hauptteil werden die zuvor genannten Leitfragen behandelt. Schließlich werden die Ergebnisse aus den verschiedenen Teilen der Hausarbeit im Fazit zusammengefasst und subjektiv bewertet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung
- 1. Was ist Globalisierung?
- 1.1 Geschichte der Globalisierung
- 1.2 Ursachen
- 1.2.1 Wirtschaftlicher Aspekt
- 1.2.2 Politischer Aspekt
- 1.3 Chancen und Risiken
- 2. Globalisierung und Welthandel
- 2.1 Welthandelsorganisation
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Globalisierung auf den Welthandel und die Rolle der Welthandelsorganisation (WTO) in diesem Prozess. Ziel ist es, die komplexen Zusammenhänge zwischen diesen beiden Phänomenen aufzuzeigen und die Herausforderungen der Globalisierung für die Weltwirtschaft zu beleuchten.
- Definition und Geschichte der Globalisierung
- Ursachen der Globalisierung (wirtschaftliche und politische Aspekte)
- Chancen und Risiken der Globalisierung
- Die Rolle der WTO im globalen Handel
- Herausforderungen der Globalisierung für die Weltwirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung definiert den Begriff der Globalisierung und stellt fest, dass er in vielen Bereichen relevant ist, von der Wirtschaft bis hin zur Politik und den Medien. Die Arbeit konzentriert sich auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte der Globalisierung und deren Einfluss auf den Welthandel.
Kapitel 1 beleuchtet die Geschichte und Ursachen der Globalisierung. Es werden verschiedene Definitionen von Globalisierung vorgestellt und die Entwicklung des Begriffs von den 1960er Jahren bis heute nachgezeichnet. Der Fokus liegt auf den wirtschaftlichen und politischen Ursachen der Globalisierung.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Rolle der WTO im globalen Handel. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Funktionsweise der WTO sowie deren Einfluss auf die Gestaltung des internationalen Handels.
Schlüsselwörter (Keywords)
Globalisierung, Welthandel, Welthandelsorganisation (WTO), Wirtschaft, Politik, Chancen, Risiken, Weltwirtschaft, Finanzkrisen, Entwicklung, Internationalisierung, Märkte, Handelsschranken, Kapitalmobilität, Produktionsstandorte, Industriegesellschaft, Informationsgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen der Globalisierung?
Wesentliche Ursachen sind der technologische Fortschritt in der Kommunikation, sinkende Transportkosten und die politische Öffnung der Märkte.
Welche Funktion hat die Welthandelsorganisation (WTO)?
Die WTO regelt internationale Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und dient als Plattform für Verhandlungen zur Senkung von Handelsschranken.
Was sind die Chancen der Globalisierung?
Dazu gehören Wirtschaftswachstum durch freien Handel, technischer Austausch und ein breiteres Warenangebot für Konsumenten.
Welche Risiken birgt die weltweite Vernetzung?
Risiken sind die schnelle Ausbreitung von Finanzkrisen, wachsender Wettbewerbsdruck auf nationale Industrien und soziale Ungleichheit.
Wie beeinflusst Globalisierung den Welthandel?
Sie führt zu einer immensen Zunahme des grenzüberschreitenden Austauschs von Waren, Dienstleistungen und Kapital sowie zur Entstehung globaler Wertschöpfungsketten.
- Quote paper
- Hoang Long Nguyen (Author), 2013, Globalisierung und die Rolle der WTO in der Weltwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306062