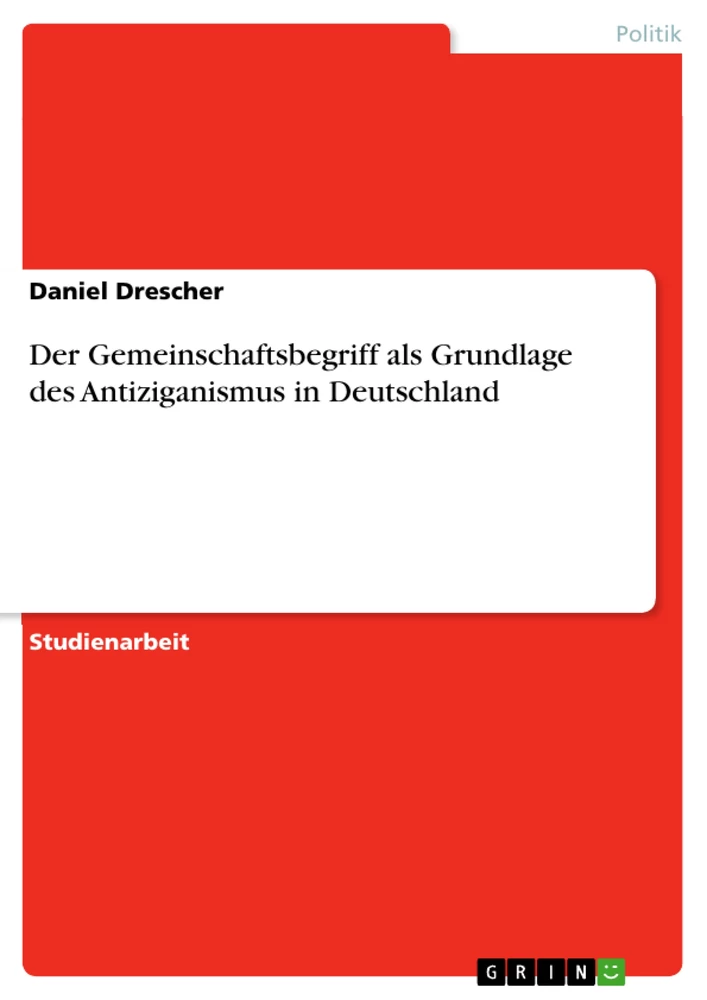Der Antiziganismus ist eine vor allem im europäischen Raum weit verbreitete Ideologie, die trotz der schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen kaum öffentliche Aufmerksamkeit in Deutschland gewinnt. Besonders im osteuropäischen Raum findet die Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung von als „Zigeunern“ stigmatisierten Menschen ein höheres Maß als in westeuropäischen Ländern: Viele Sinti und Roma leben in Arbeitslosigkeit, da sie wegen der großen Zahl an Vorurteilen gegen sie starke Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Ebenso beherrschen die schlechte Bildungs- und Gesundheitssituation das Leben dieser Menschen im östlichen Europa. Oft wird ihnen auch hier das Recht zur Niederlassung verweigert.
Pogrome, Mordanschläge und körperliche Angriffe auf Angehörige der Roma sind in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Slowakei und Tschechien keine Seltenheit. Während der Zeit des zweiten Weltkrieges waren die Umstände für die Sinti und Roma im Europäischen Raum am fatalsten. Während des nationalsozialistischen Herrschaft kamen in Europa um die 500.000 Sinti und Roma zu Tode. Doch wie konnte es gerade in Deutschland zu einem solchen Massenmord an Sinti und Roma kommen?
Das Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie“ von Ferdinand Tönnies bot bereits 1887 eine klare wissenschaftliche Abgrenzung der Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft, welche in einem Dualismus zueinander stehen. Mit der zunehmenden Politisierung beider Begriffe zusammen mit der Entstehung des Mythos von 1914 nahm auch immer mehr die Annahme unter der deutschen Bevölkerung zu, dass zu einer Formierung der erwünschten „Volksgemeinschaft“ die Exklusion des Volksfremden notwendig sei. Als volksfremd zählten damals unter anderem auch die Sinti und Roma. Da ebenfalls fast alle zugeschriebenen Stereotypen gegenüber diesen Gruppen als klares Gegenbild zur Zivilisation und modernen Gesellschaft erscheinen, lässt sich folgende Fragen aufstellen: Wird beim Antiziganismus in Verbindung mit dem Gemeinschaftsideal das eigene anstrebte Modell des sozialen Zusammenlebens als fremd gedeutet? Haben deshalb die suggerierte Höherwertigkeit der Gemeinschaft bei Tönnies und die darauffolgende Politisierung des Begriffs die Grundlagen für den heutigen Antiziganismus in Deutschland gelegt?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau
- Vom soziologischen Begriff zur politischen Formel
- Gemeinschaft und Gesellschaft bei Ferdinand Tönnies
- Theorie der Gemeinschaft
- Theorie der Gesellschaft
- Politisierung des Gemeinschaftsbegriffes
- Antiziganistische Ideologie
- Historischer Einblick in die Diskriminierung von Sinti und Roma in Europa
- Begriff des Antiziganismus
- „Zigeuner“ als Symbol der Gemeinschaft?
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit analysiert, inwieweit der Gemeinschaftsbegriff, insbesondere in der Form, wie er von Ferdinand Tönnies in seinem Werk "Gemeinschaft und Gesellschaft" dargestellt wurde, die Grundlage für den heutigen Antiziganismus in Deutschland gelegt hat. Sie untersucht, wie die Politisierung des Gemeinschaftsbegriffes im Kontext der Weimarer Republik und die damit verbundene Suche nach nationaler Einheit, die Entstehung und Perpetuierung antiziganistischer Ideologien begünstigte.
- Die Definition von Gemeinschaft und Gesellschaft nach Ferdinand Tönnies
- Die Politisierung des Gemeinschaftsbegriffes im Kontext der Weimarer Republik
- Die Entstehung und Entwicklung antiziganistischer Ideologien
- Die Rolle von Stereotypen und Ressentiments im Antiziganismus
- Die Bedeutung von „Zigeunern“ als Symbol der Gemeinschaft und des Andersartigen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Problemstellung des Antiziganismus in Deutschland dar und erläutert die Bedeutung des Gemeinschaftsbegriffes in diesem Kontext. Die Kapitel 2 und 3 untersuchen die soziologische und politische Dimension des Gemeinschaftsbegriffes sowie die Geschichte der antiziganistischen Diskriminierung. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Definition des Antiziganismus und den gängigen Stereotypen, die mit dieser Ideologie verbunden sind. Im Fokus steht dabei die Frage, inwieweit „Zigeuner“ als Symbol der Gemeinschaft und des Andersartigen dienen. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Antiziganismus, Gemeinschaft, Gesellschaft, Ferdinand Tönnies, Weimarer Republik, Sinti und Roma, Stereotype, Ressentiments, nationale Einheit, „Zigeuner“
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Antiziganismus?
Antiziganismus ist eine spezifische Ideologie der Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung von Sinti und Roma, die auf jahrhundertealten Vorurteilen und Stereotypen basiert.
Welche Rolle spielt Ferdinand Tönnies' Werk für diese Thematik?
Tönnies' Unterscheidung zwischen "Gemeinschaft" und "Gesellschaft" (1887) lieferte soziologische Grundbegriffe, deren spätere Politisierung zur Ausgrenzung des "Volksfremden" beitrug.
Wie hängen das Gemeinschaftsideal und die Exklusion von Sinti und Roma zusammen?
Durch die Politisierung des Begriffs der "Volksgemeinschaft" entstand die Annahme, dass nationale Einheit nur durch die Ausgrenzung derer möglich sei, die als "fremd" oder "nicht gemeinschaftsfähig" stigmatisiert wurden.
Wie viele Sinti und Roma fielen dem Nationalsozialismus zum Opfer?
Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurden in Europa schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma ermordet.
Was ist der "Mythos von 1914"?
Es bezeichnet die Verklärung des Kriegsbeginns 1914 als Moment der nationalen Verbrüderung und Einheit, der das Ideal einer geschlossenen Gemeinschaft politisch auflud.
Warum werden Sinti und Roma oft als Gegenbild zur Moderne dargestellt?
Antiziganistische Stereotypen schreiben diesen Gruppen oft Eigenschaften zu, die als primitiv oder zivilisationsfern gelten, um das eigene Modell des sozialen Zusammenlebens abzugrenzen.
- Citar trabajo
- Daniel Drescher (Autor), 2012, Der Gemeinschaftsbegriff als Grundlage des Antiziganismus in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306110