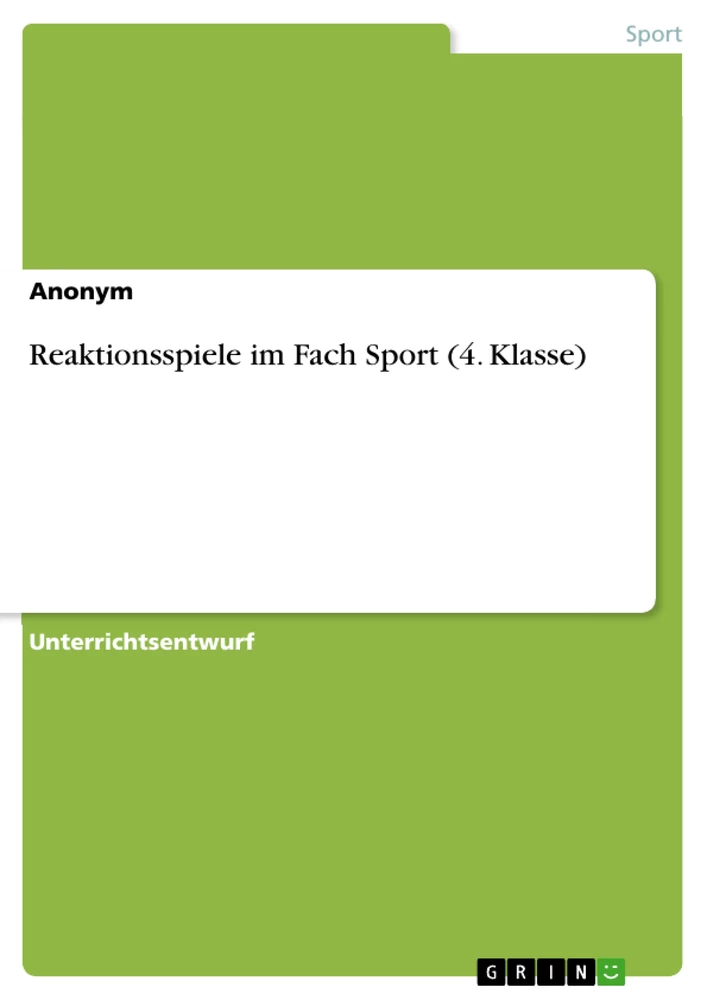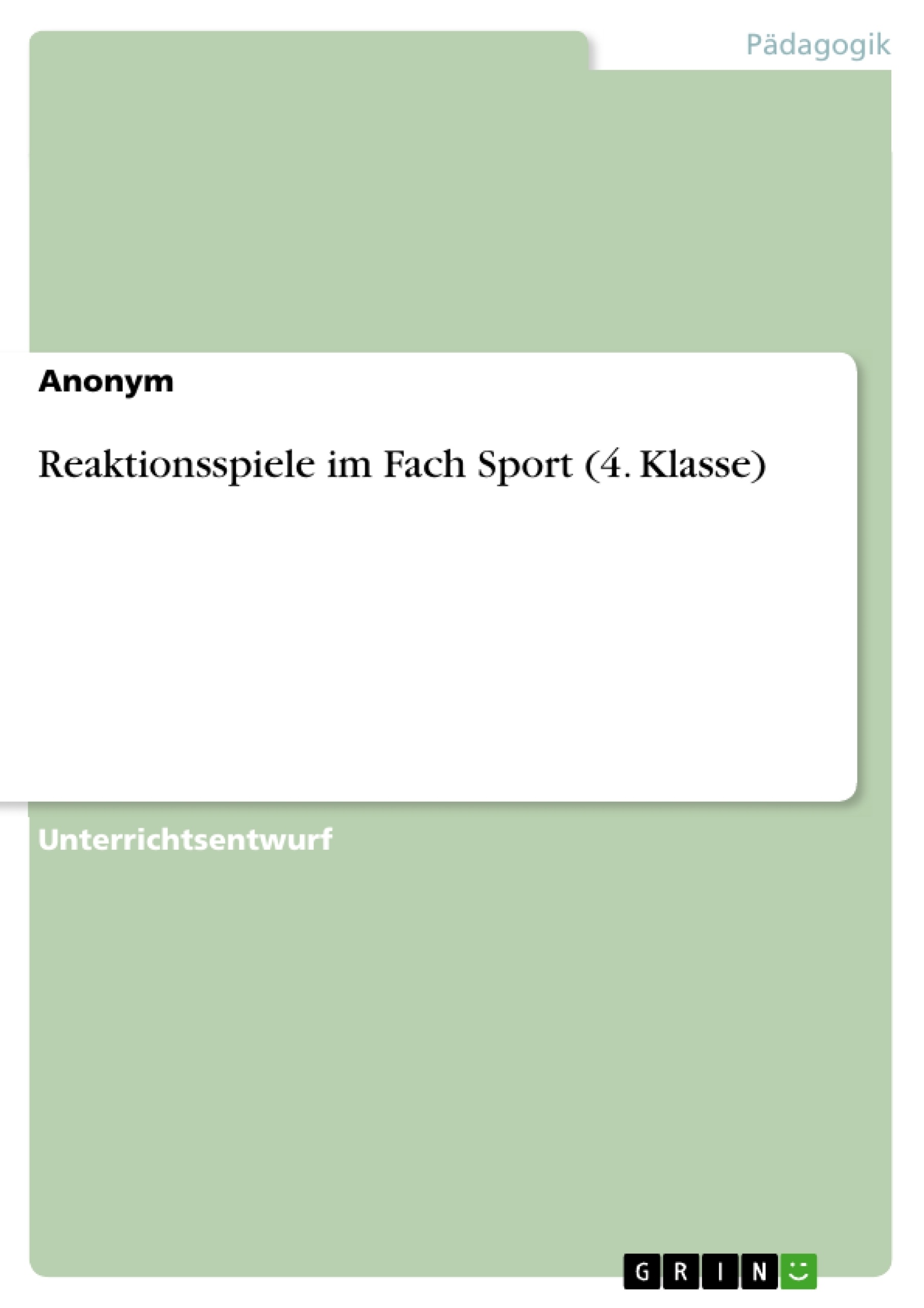Die Kinder der vierten Klasse können ihren Körper bereits gut koordinieren und sind motorisch schon sehr fit. Die Spiele im Sportunterricht begeistern sie meistens sehr, da sie sich hier bewegen können und eine Abwechslung vom Alltag erlangen. Motiviert wirken die Schüler bei den Spielen mit, wodurch gerade die Motorik gut geschult werden kann. Die Reaktionsfähigkeit soll in dieser Stunde durch abwechslungsreiche Einheiten und verschiedene Signale geübt werden, wodurch die Schülerinnen und Schüler zugleich mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert werden.
Täglich werden die Kinder mit Situationen, welche die Reaktion fordert, konfrontiert, wodurch sie bereits Vorerfahrungen mitbringen. Durch spannende Spiele können die Kinder lernen, wie sie selbst ihre Reaktion trainieren können und schneller auf etwas reagieren können. Somit wird in dieser Stunde sehr viel Wert auf die Reaktionszeit der Kinder, wie auch die Gesamtmotorik gelegt. Es wurde bereits in vorhergehenden Stunden einfache Spiele zur Reaktion durchgeführt, wodurch die Reaktionszeit schon verbessert wurde und die Kinder bereits mit dem Thema vertraut sind.
In der vorliegenden Stunde geht es darum, noch einmal gezielt an schwierigeren Aufgaben die Reaktionsfähigkeit zu trainieren, worauf abschließend eine Abschlussstunde folgt. Dadurch können die Kinder eigenständig ihre Reaktion einüben, da sie bereits viele Möglichkeiten zu Signalen kennen. Auch in den Spielen vor den Stationen werden noch einmal die wichtigsten Signale wiederholt.
Mit dem Aufbauen von Stationen, wie auch mit dem Gerätetransport sind die Kinder vertraut. Auch in sozialer Hinsicht können die Schülerinnen und Schüler gut in Gruppen zusammen arbeiten. Um bereits bestehende Gruppen aus der Klasse zu vermeiden, werden sie nach Farbkarten eingeteilt, um Streitigkeiten und Leerlauf während der Stunde zu vermeiden.
Um in der ganzen Stunde das Thema Reaktion präsent zu haben, wird dies auch in den Auf- und Abwärmspielen deutlich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Planung
- 1.1. Bedingungsanalyse
- 1.1.2. Sachanalyse
- a) Die Reaktionsfähigkeit
- b) Schulung der Reaktionsfähigkeit
- 1.3. Didaktisch-methodische Analyse
- 1.4. Tabellarischer Stundenverlaufsplan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung des vorliegenden Unterrichtsversuchs besteht darin, die Reaktionsfähigkeit von Grundschulkindern der vierten Klasse zu fördern und zu schulen. Der Versuch findet im Rahmen eines Seminars statt, in dem Studenten die Rolle der Schüler einnehmen. Die Stunde soll den Studenten Einblicke in die Anwendung von Reaktionsspielen im Sportunterricht geben.
- Förderung der Reaktionsfähigkeit auf visuelle und akustische Signale
- Schulung der Reaktionsfähigkeit durch verschiedene Spielformen und Schwierigkeitsgrade
- Verbesserung der motorischen Koordination und des Gemeinschaftsgefühls
- Anwendung verschiedener didaktisch-methodischer Ansätze
- Übertragung der im Sportunterricht trainierten Reaktionsfähigkeit auf den Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
1. Planung: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext des Unterrichtsversuchs, die Voraussetzungen der Schüler (vierte Klasse mit guten motorischen Fähigkeiten), die Lernziele (Verbesserung der Reaktionsfähigkeit) und die methodische Herangehensweise. Es wird auf die Bedeutung von Motivation und Spaß im Sportunterricht hingewiesen und die Organisation der Stunde (Einteilung in Gruppen nach Farbkarten) erläutert. Die bereits vorhandenen Vorerfahrungen der Schüler mit Reaktionsspielen werden berücksichtigt, und die Stunde wird als Teil einer Reihe von Unterrichtseinheiten zur Reaktionsfähigkeit positioniert. Der Fokus liegt auf der gezielten Übung der Reaktionsfähigkeit durch anspruchsvollere Aufgaben.
1.1. Bedingungsanalyse: Dieser Abschnitt der Planung analysiert die Rahmenbedingungen des Unterrichtsversuchs. Es werden die motorischen Fähigkeiten der Schüler (vierte Klasse), ihre Vorerfahrungen mit Reaktionsspielen und ihre soziale Kompetenz im Gruppenarbeiten beschrieben. Es wird betont, wie die Stunde die bereits vorhandenen Fähigkeiten aufbaut und die Motivation der Schüler durch abwechslungsreiche Methoden und Materialien erhalten werden soll. Die Vermeidung von bestehenden Gruppenkonstellationen durch die Farbkarten-Einteilung zur Optimierung des Ablaufs wird detailliert erklärt.
1.1.2. Sachanalyse: Dieser Teil befasst sich mit der Definition und den verschiedenen Facetten der Reaktionsfähigkeit. Es werden die drei Stufen der Reaktionsfähigkeit nach Loosch (einfache, komplexe und Wahlreaktion) erläutert und mit Beispielen aus dem Sportunterricht illustriert. Die Bedeutung der Reaktionsfähigkeit im Sport wird hervorgehoben, und es werden verschiedene Methoden zu ihrer Schulung vorgestellt, darunter Lauf- und Fangspiele sowie Spiele mit Kleingeräten. Der Abschnitt liefert eine fundierte wissenschaftliche Grundlage für die didaktische Gestaltung der Unterrichtseinheit.
1.3. Didaktisch-methodische Analyse: Dieser Abschnitt erläutert den didaktischen Ansatz der Stunde. Es wird die Relevanz der Reaktionsfähigkeit im Alltag der Schüler betont und der Bezug zu ihren Vorerfahrungen hergestellt. Die methodische Gestaltung der Stunde, beginnend mit Aufwärmspielen ("Feuer, Wasser, Blitz"), über das Hauptteil mit Stationenarbeit (Stabfangen, Ballwerfen, Medizinball-Catchen) bis zum Ausklang ("Zwinkerspiel") wird detailliert dargestellt. Die einzelnen Spiele und Übungen werden hinsichtlich ihrer didaktischen Funktion zur Schulung der visuellen und akustischen Reaktionsfähigkeit beschrieben und ihre didaktische Begründung wird gegeben. Der Schwerpunkt liegt auf der didaktischen Begründung der gewählten Methoden und der systematischen Progression der Übungen.
Schlüsselwörter
Reaktionsfähigkeit, Sportunterricht, Grundschule, visuelle Signale, akustische Signale, motorische Kompetenz, Gruppenarbeit, didaktische Methoden, Stationenarbeit, Reaktionsspiele, Bewegung, Koordination.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsversuch: Reaktionsfähigkeitsschulung in der Grundschule
Was ist der Gegenstand des Unterrichtsversuchs?
Der Unterrichtsversuch konzentriert sich auf die Förderung und Schulung der Reaktionsfähigkeit von Grundschulkindern der vierten Klasse. Studenten nehmen dabei die Rolle der Schüler ein, um Einblicke in die Anwendung von Reaktionsspielen im Sportunterricht zu erhalten.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Ziele umfassen die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf visuelle und akustische Signale, die Schulung der Reaktionsfähigkeit durch verschiedene Spielformen, die Verbesserung der motorischen Koordination und des Gemeinschaftsgefühls, die Anwendung verschiedener didaktisch-methodischer Ansätze und die Übertragung der im Sportunterricht trainierten Reaktionsfähigkeit auf den Alltag.
Wie ist der Versuch aufgebaut?
Der Versuch ist in verschiedene Kapitel unterteilt: Planung (einschließlich Bedingungsanalyse, Sachanalyse, didaktisch-methodische Analyse und Stundenverlaufsplan), Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel. Die Planung umfasst die Analyse der Rahmenbedingungen, der Schülerfähigkeiten und der methodischen Herangehensweise. Die Sachanalyse beschreibt die Reaktionsfähigkeit und ihre Facetten. Die didaktisch-methodische Analyse erläutert den didaktischen Ansatz und die methodische Gestaltung der Stunde.
Welche Methoden werden eingesetzt?
Die Stunde beinhaltet Aufwärmspiele (z.B. "Feuer, Wasser, Blitz"), Stationenarbeit mit verschiedenen Reaktionsspielen (Stabfangen, Ballwerfen, Medizinball-Catchen) und ein Ausklangspiel ("Zwinkerspiel"). Die Auswahl der Spiele und Übungen basiert auf einer didaktischen Begründung und zielt auf die Schulung der visuellen und akustischen Reaktionsfähigkeit ab.
Wie ist die Stunde strukturiert?
Die Stunde gliedert sich in einen Aufwärmteil, einen Hauptteil mit Stationenarbeit und einen Ausklang. Die Schüler werden anhand von Farbkarten in Gruppen eingeteilt, um bereits bestehende Gruppenkonstellationen zu vermeiden und den Ablauf zu optimieren.
Welche Vorerfahrungen der Schüler werden berücksichtigt?
Die Stunde baut auf den bereits vorhandenen motorischen Fähigkeiten und Vorerfahrungen der Schüler mit Reaktionsspielen auf. Die Motivation der Schüler soll durch abwechslungsreiche Methoden und Materialien erhalten werden.
Welche wissenschaftlichen Grundlagen liegen dem Versuch zugrunde?
Die Sachanalyse stützt sich auf die drei Stufen der Reaktionsfähigkeit nach Loosch (einfache, komplexe und Wahlreaktion) und beleuchtet die Bedeutung der Reaktionsfähigkeit im Sport und im Alltag.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Unterrichtsversuch?
Schlüsselwörter sind: Reaktionsfähigkeit, Sportunterricht, Grundschule, visuelle Signale, akustische Signale, motorische Kompetenz, Gruppenarbeit, didaktische Methoden, Stationenarbeit, Reaktionsspiele, Bewegung, Koordination.
Für wen ist dieser Unterrichtsversuch relevant?
Dieser Unterrichtsversuch ist relevant für Lehramtsstudierende, Sportlehrer und alle, die sich für die Förderung der Reaktionsfähigkeit bei Grundschulkindern interessieren.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2014, Reaktionsspiele im Fach Sport (4. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306184