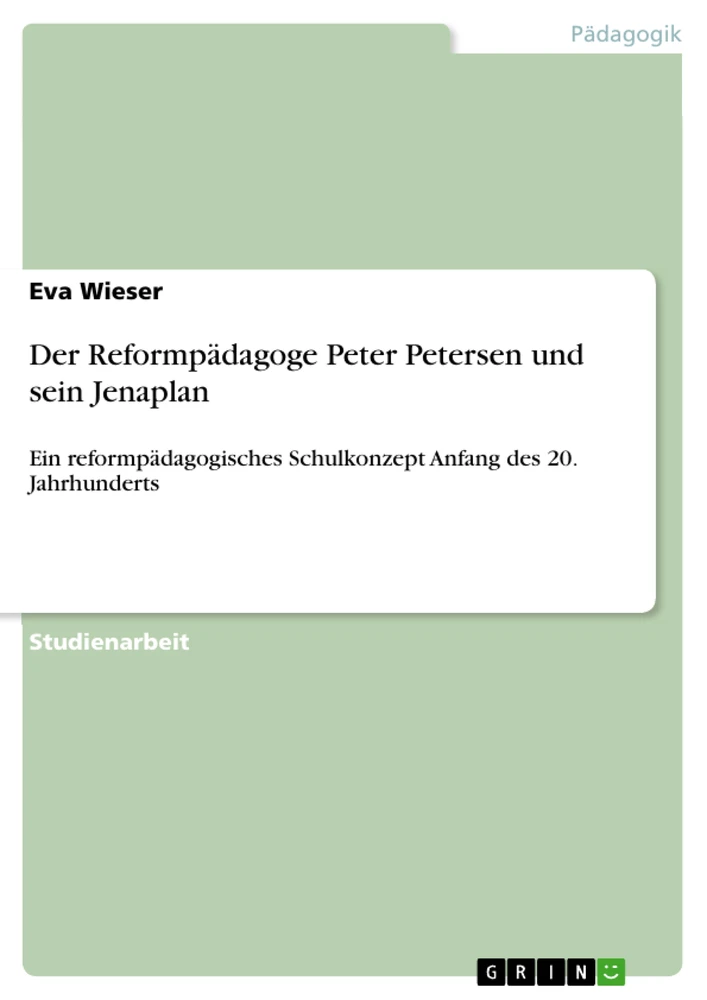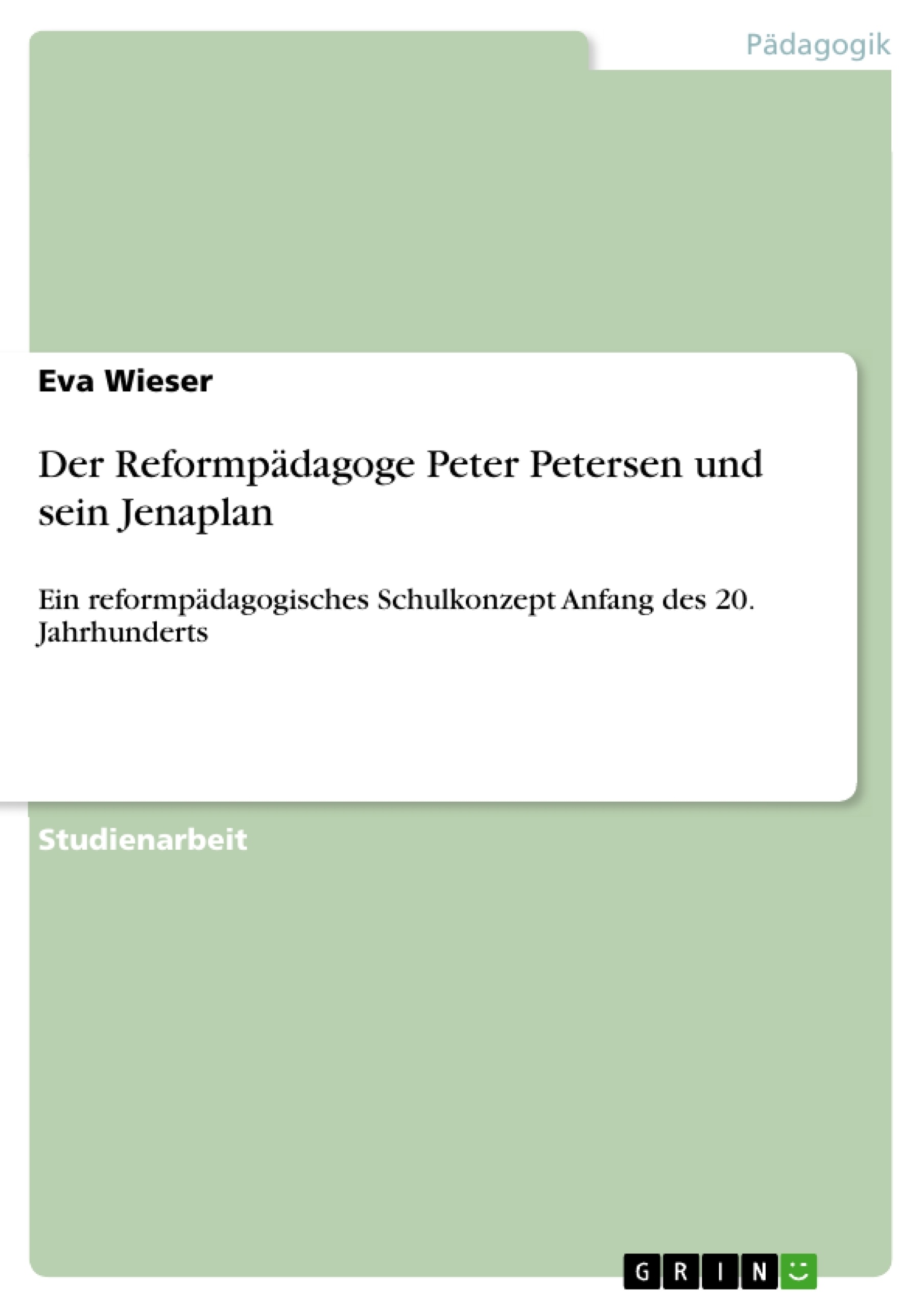Die Kinder von heute erleben die Schule oft nur noch als notwendiges Übel, damit sie eines Tages etwas erreichen können. Denn ihre Arbeitsfreude wird gebremst durch Noten und Auseinandersetzungen mit unzufriedenen Eltern und Lehrern. Daraufhin folgen u.a. neurotische Störungen und Schulangst. Aus diesem Grund stellen sich immer mehr Eltern die Frage, welche Alternativen es zur staatlichen Schule gibt. Es gibt zahlreiche Alternativen, die im Gegensatz zur staatlichen Schule andere pädagogische Strukturen und Konzepte vertreten und umsetzen. Durch diese aktuelle Situation, bietet es sich an, sich mit einem der führenden Reformpädagogen zu beschäftigen.
Peter Petersen behauptet, dass die Schulen auch anders sein können, indem man den Kindern und Jugendlichen ausreichend Freiräume bietet, sodass sie zur Eigentätigkeit, sowie zu Unternehmungen in der Gemeinschaft gebracht werden. Bei der Schulreform ist es wichtig, dass die Schule bzw. die Institution aufgelockert wird bis diese zur freien Lebens- und Aufenthaltsstätte der Jugendlichen und Kindern wird.
Der Jenaplan kann als reformpädagogisches Schulkonzept bezeichnet werden, das Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Reformpädagogen Peter Petersen gegründet wurde. Dieser sog. Plan ist eine Synthese aus diversen Entwicklungslinien der Zeit der Reformpädagogik und sieht eine „freie, allgemeine Volksschule“ vor, „getragen von der Elternschaft und den Erziehern“ in der Jungen und Mädchen unabhängig von ihrem sozialen Stand, ihrer Religion oder ihrer Begabung gleichermaßen miteinander lernen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Einordnung
- Biographie Peter Petersens
- Schulische Ausgangssituation
- Entwicklung des Jenaplans
- Grundlagen der Jenaplan-Pädagogik
- Peter Petersens Kritik an die „alte Schule“
- Definition der Jenaplan-Pädagogik
- Kernpunkte des Jena-Plans
- Stammgruppen statt Jahresklassen
- Wochenarbeitsplan statt „Fetzenstundenplan“
- Gruppenunterrichtliches Verfahren im Dienste der freien Arbeit und persönlichen Bildung
- Kurse zur Sicherung des „Mindestwissens“
- Feiern im Dienst der Gemeinschaftsbildung
- Arbeits-und Leistungsberichte statt Zensuren
- „Schulwohnstube“ als Raum für „soziale und sittliche Erfahrung“
- „Schulgemeinde“ als „Lebensstätte der Jugend“
- Fazit/ Meinungen
- Gegenüberstellung der Vor-und Nachteile
- Meinungen von öffentlichen Persönlichkeiten
- Eigene Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Pädagogik von Peter Petersen und den Jenaplan, ein reformpädagogisches Schulkonzept. Die Zielsetzung ist es, die Entwicklung des Jenaplans nachzuvollziehen, seine Kernpunkte zu erklären und seine Umsetzung zu betrachten. Der Fokus liegt auf der historischen Einordnung des Jenaplans innerhalb der Reformpädagogik und der Analyse seiner zentralen Prinzipien.
- Historische Einordnung des Jenaplans in der Reformpädagogik
- Zentrale Prinzipien der Jenaplan-Pädagogik
- Kritik an traditionellen Schulsystemen durch Petersen
- Umsetzung des Jenaplan-Konzepts in der Praxis
- Bewertung des Jenaplan-Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die aktuelle Problematik der staatlichen Schule, die bei vielen Kindern und Jugendlichen zu Schulangst und neurotischen Störungen führt. Sie präsentiert den Jenaplan als eine reformpädagogische Alternative und kündigt den Fokus der Arbeit auf die Pädagogik Peter Petersens an. Es wird die Notwendigkeit alternativer pädagogischer Ansätze herausgestellt und der Jenaplan als ein solches Konzept vorgestellt. Die Einleitung dient als Hinführung zum Hauptteil, in dem die einzelnen Aspekte des Jenaplan detailliert behandelt werden.
Geschichtliche Einordnung: Dieses Kapitel ordnet die Reformpädagogik historisch ein und beschreibt die Kritik an der autoritären, lehrerzentrierten Schule des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Es werden die Ziele der Reformer genannt, wie die kindzentrierte Pädagogik, die Förderung der Selbsttätigkeit und das Lernen aus praktischer und sozialer Erfahrung. Verschiedene reformpädagogische Modelle wie die Montessori-Pädagogik und die Waldorfpädagogik werden kurz vorgestellt und im Vergleich zum Jenaplan betrachtet, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervorgehoben werden. Die Einordnung des Jenaplans in den Kontext anderer Reformpädagogik-Ansätze wird hier geleistet, und die Sonderstellung Petersens aufgrund seines zeitlichen Kontextes wird deutlich gemacht.
Schlüsselwörter
Jenaplan, Peter Petersen, Reformpädagogik, kindzentrierte Pädagogik, Selbsttätigkeit, Gemeinschaft, Stammgruppen, Wochenarbeitsplan, Kritik an der traditionellen Schule, alternative Schulmodelle, reformpädagogische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Jenaplan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Pädagogik von Peter Petersen und dem Jenaplan, einem reformpädagogischen Schulkonzept. Sie untersucht die Entwicklung des Jenaplans, erklärt seine Kernpunkte und betrachtet seine praktische Umsetzung. Ein besonderer Fokus liegt auf der historischen Einordnung des Jenaplans innerhalb der Reformpädagogik und der Analyse seiner zentralen Prinzipien.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Einleitung, eine geschichtliche Einordnung des Jenaplans, eine Biographie Peter Petersens, die schulische Ausgangssituation, die Entwicklung des Jenaplans, die Grundlagen der Jenaplan-Pädagogik (inkl. Petersens Kritik an der „alten Schule“, Definition der Jenaplan-Pädagogik und Kernpunkte wie Stammgruppen, Wochenarbeitsplan, Gruppenunterricht, Kurse, Feiern, Arbeits- und Leistungsberichte, „Schulwohnstube“ und „Schulgemeinde“), sowie ein Fazit mit Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen, Meinungen öffentlicher Persönlichkeiten und einer persönlichen Meinung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt die Zielsetzung, die Entwicklung des Jenaplans nachzuvollziehen, seine Kernpunkte zu erklären und seine Umsetzung zu betrachten. Der Fokus liegt auf der historischen Einordnung des Jenaplans innerhalb der Reformpädagogik und der Analyse seiner zentralen Prinzipien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte sind die historische Einordnung des Jenaplans in der Reformpädagogik, die zentralen Prinzipien der Jenaplan-Pädagogik, Petersens Kritik an traditionellen Schulsystemen, die Umsetzung des Jenaplan-Konzepts in der Praxis und eine Bewertung des Jenaplan-Konzepts.
Wie wird die Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die Problematik der staatlichen Schule (Schulangst, neurotische Störungen), präsentiert den Jenaplan als Alternative und kündigt den Fokus auf Petersens Pädagogik an. Sie hebt die Notwendigkeit alternativer Ansätze hervor und dient als Hinführung zum Hauptteil.
Was beinhaltet das Kapitel zur geschichtlichen Einordnung?
Dieses Kapitel ordnet die Reformpädagogik historisch ein, beschreibt die Kritik an der autoritären Schule und die Ziele der Reformer (kindzentrierte Pädagogik, Selbsttätigkeit, Lernen aus Erfahrung). Es werden verschiedene reformpädagogische Modelle (Montessori, Waldorf) vorgestellt und im Vergleich zum Jenaplan betrachtet. Die Einordnung des Jenaplans und die Sonderstellung Petersens werden deutlich gemacht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Jenaplan, Peter Petersen, Reformpädagogik, kindzentrierte Pädagogik, Selbsttätigkeit, Gemeinschaft, Stammgruppen, Wochenarbeitsplan, Kritik an der traditionellen Schule, alternative Schulmodelle, reformpädagogische Ansätze.
Welche Kernpunkte der Jenaplan-Pädagogik werden hervorgehoben?
Die Kernpunkte der Jenaplan-Pädagogik, die in der Arbeit detailliert erläutert werden, umfassen unter anderem: Stammgruppen statt Jahresklassen, Wochenarbeitsplan statt „Fetzenstundenplan“, gruppenunterrichtliches Verfahren, Kurse zur Sicherung des „Mindestwissens“, Feiern zur Gemeinschaftsbildung, Arbeits- und Leistungsberichte statt Zensuren, „Schulwohnstube“ und „Schulgemeinde“.
- Citar trabajo
- Eva Wieser (Autor), 2015, Der Reformpädagoge Peter Petersen und sein Jenaplan, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306205