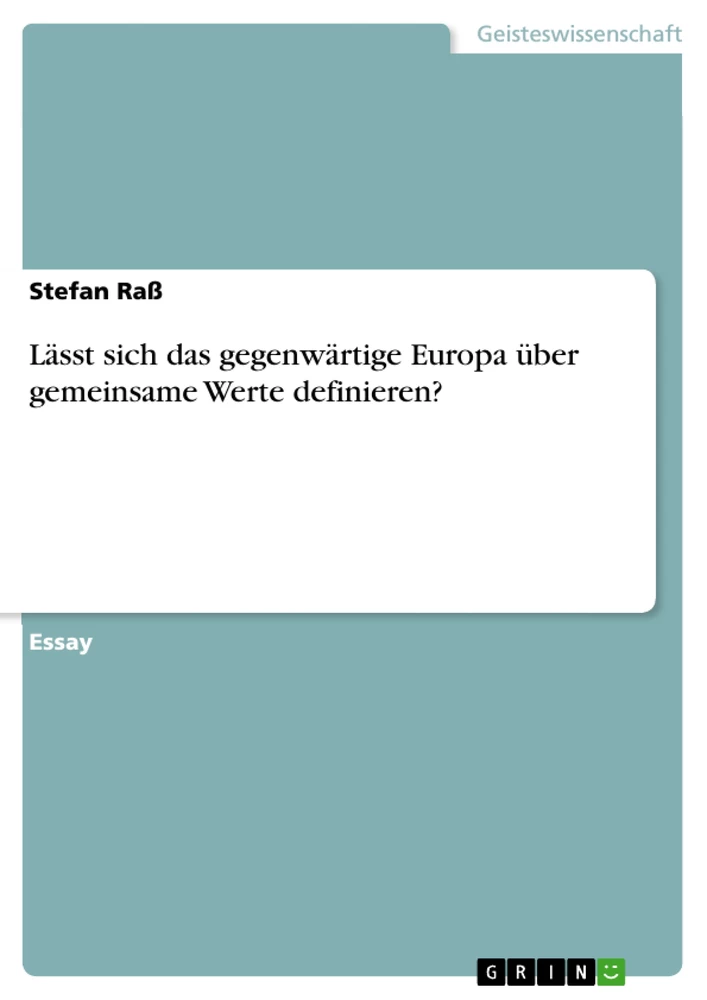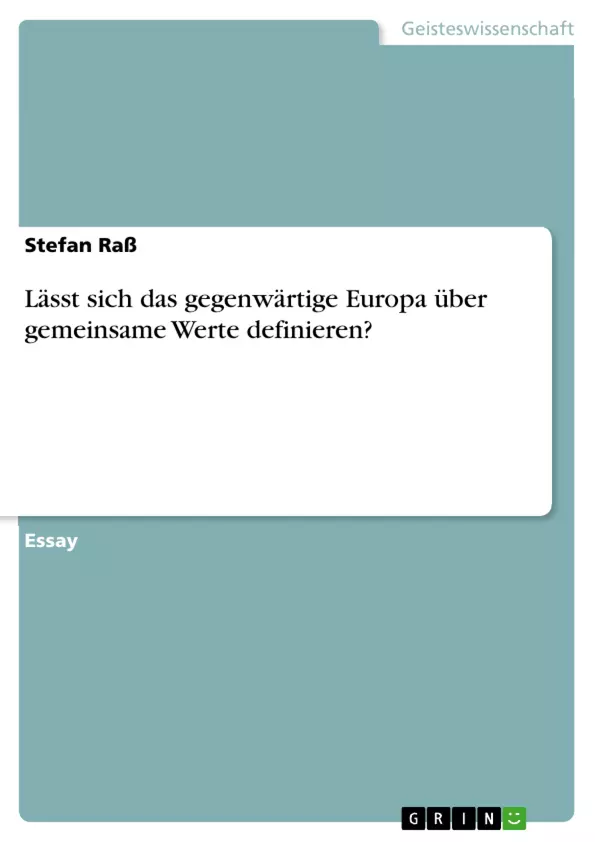Die weltweite Finanzkrise stellt die Währungs- und Wirtschaftsunion Europa seit mehr als einem halben Jahrzehnt vor eine Zerreißprobe. Diskussionen über das Ausscheiden einzelner Staaten aus wirtschaftlichen Gründen begleiten den Prozess der europäischen Integration im neuen Jahrtausend. Die Europäische Union brachte eine Vielzahl sozialer und ökonomischer Gewinne mit sich, doch eben jene Krise wirft die Frage auf, ob man die Einheit Europas nicht durch sozioökonomische Vorteile, sondern durch gemeinsame Werte begründen sollte. In Politik und Medien wird hier von der Wertegemeinschaft Europas gesprochen (vgl. Haller 2009: 335). Der Kontinent ist durch eine Vielzahl kultureller Strömungen und durch eine stürmische Geschichte gekennzeichnet. Viele der technologischen Innovationen und heutigen Lebensweisen, zumindest der westlichen Nationen, haben im Okzident das Licht der Welt erblickt. Nach vielen, von Kriegen gezeichneten Epochen, hat sich Europa zu einem politischen Gebilde zusammengeschlossen. Dieses Konstrukt ist jedoch keineswegs unerschütterlich. Auf der Suche nach einem festeren Kitt, der das Gebilde Europa zusammenhält, stellt sich die Frage, ob sich das gegenwärtige Europa über gemeinsame Werte definieren lässt? Wie lassen sich solche Werte wissenschaftlich begreifen?
Um diese Fragen zu beantworten, soll zunächst der Anspruch der EU, eine Wertegemeinschaft darzustellen, näher beleuchtet werden. Es soll untersucht werden, ob es jüdisch-christlich oder griechisch-römische Werte gibt, die ganz Europa in sich trägt. Darauf folgend wird die Frage untersucht, ob es darüber hinaus auch andere kulturelle Eigenarten gibt, durch welche sich Europa definieren kann? Schlussendlich soll auf den Begriff selbst eingegangen werden, insbesondere darauf, welche Probleme sich aus wissenschaftlicher Perspektive bei der Diskussion gemeinsamer Werte im heutigen Europa stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Anspruch auf eine Wertegemeinschaft
- Das jüdisch-christliche Erbe
- Das griechisch-römische Erbe
- Europa die sozial-politische Wertegemeinschaft?
- Das Problem der Werte und die Einheit in Vielfalt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob die Europäische Union über gemeinsame Werte definiert werden kann. Er untersucht, ob es jüdisch-christliche oder griechisch-römische Werte gibt, die ganz Europa in sich tragen, und ob es darüber hinaus auch andere kulturelle Eigenarten gibt, durch welche sich Europa definieren kann.
- Der Anspruch der EU, eine Wertegemeinschaft darzustellen
- Die Rolle des jüdisch-christlichen Erbes in der europäischen Identität
- Die Bedeutung des griechisch-römischen Erbes für die europäische Kultur
- Die Herausforderungen der kulturellen Vielfalt und der religiösen Pluralität in Europa
- Die Problematik der Definition gemeinsamer Werte in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Der Anspruch auf eine Wertegemeinschaft
Dieses Kapitel untersucht den Anspruch der Europäischen Union, eine Wertegemeinschaft zu sein. Es analysiert die Präambel der Grundrechtecharta der Europäischen Union und den Vertrag von Lissabon, um die explizite Berufung auf gemeinsame Werte zu beleuchten.
Das jüdisch-christliche Erbe
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des jüdisch-christlichen Erbes in der europäischen Identität. Es analysiert die Argumente für und gegen die Einbeziehung des christlichen Erbes in die Europäische Verfassung und diskutiert die Bedeutung des Säkularismus und des Multikulturalismus in Europa.
Das griechisch-römische Erbe
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des griechisch-römischen Erbes für die europäische Kultur. Es betrachtet die Rolle der Antike für das neuzeitliche Abendland, insbesondere die Entwicklung der Demokratie und den Einfluss der griechischen Philosophie und des römischen Rechts.
Häufig gestellte Fragen
Definiert sich die EU als Wertegemeinschaft?
Ja, die EU beruft sich in Verträgen (wie dem Vertrag von Lissabon) und der Grundrechtecharta explizit auf gemeinsame Werte wie Menschenwürde, Freiheit und Demokratie.
Welche Rolle spielt das religiöse Erbe für Europa?
Das jüdisch-christliche Erbe wird oft als Fundament europäischer Identität genannt, wobei die Diskussion über dessen Einbeziehung in Verfassungen aufgrund von Säkularismus und Multikulturalismus kontrovers ist.
Wie beeinflusst die Antike die heutigen europäischen Werte?
Das griechisch-römische Erbe prägte Europa maßgeblich durch die Entwicklung der Demokratie, die griechische Philosophie und das römische Rechtssystem.
Was bedeutet "Einheit in Vielfalt" in Bezug auf Werte?
Es beschreibt die Herausforderung, trotz unterschiedlicher kultureller und nationaler Identitäten einen gemeinsamen Wertekonsens zu finden, der den Zusammenhalt stärkt.
Können ökonomische Vorteile die Einheit Europas allein begründen?
Die Arbeit hinterfragt dies kritisch und legt nahe, dass sozioökonomische Gewinne allein nicht ausreichen, um Europa in Krisenzeiten zusammenzuhalten; dafür bedarf es tieferliegender gemeinsamer Werte.
- Arbeit zitieren
- Stefan Raß (Autor:in), 2015, Lässt sich das gegenwärtige Europa über gemeinsame Werte definieren?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306340