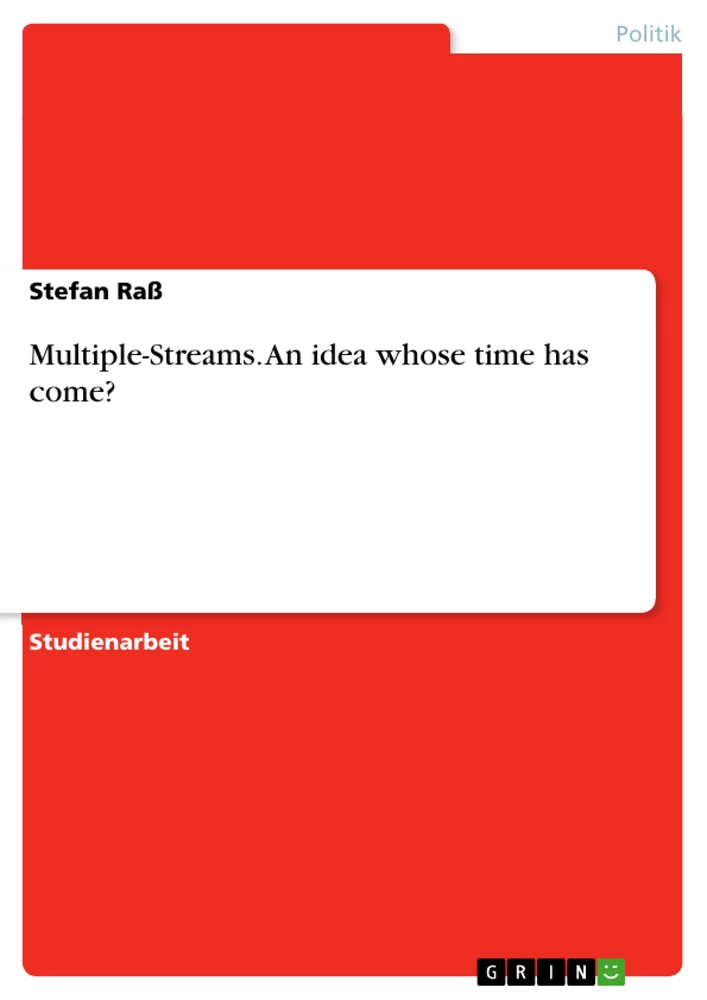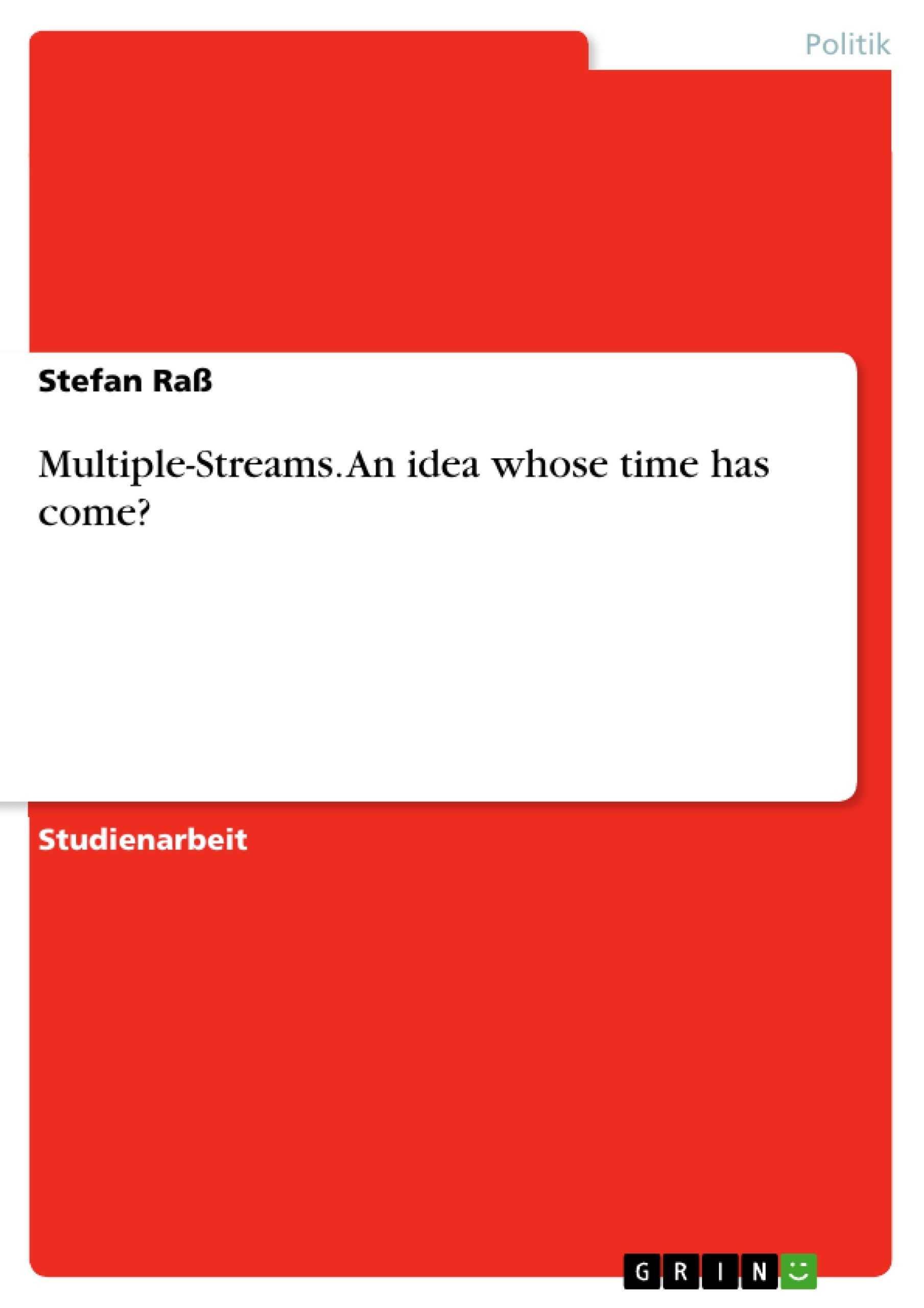Der Multiple-Streams-Ansatz wurde 1984 erstmals von John Kingdon ausgearbeitet und ist seit den Neunzigern von großer Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs. Der MSA wird in der Literatur als vielversprechendes Werkzeug zur Untersuchung von politischen Zeitfenstern (vgl. Böcher, Töller 2012: 180ff.; Nill 2002: 10ff; Zahariadis 2007: 65ff.; Herweg 2013: 322ff.) beschrieben. Auch verschiedene Indices der Zitierhäufigkeit (SSCI, SCI) zeigen die große Relevanz der Theorie von Kingdons, welche seit 1990 durchgehend höhere Werte aufweist, als andere relevante Autoren wie Sabatier und Baumgartner, die mit dem Advocacy Coalition Framework oder dem Punctuated-Equilibrium-Ansatzes ebenfalls von großer Bedeutung sind (vgl. Herweg 2013: 323).
Diese Arbeit hat als Ziel, den Ansatz Kingdons näher zu beleuchten, Kritikpunkte aufzugreifen und Weiterentwicklungen des Ansatzes zu untersuchen, um schließlich ein Bild dieses theoretischen Rahmens zu zeichnen, welches es ermöglicht den potentiellen Erkenntnismehrwert des Ansatzes besser einschätzen zu können. Hierfür soll zunächst der ursprüngliche Multiple-Streams-Ansatz dargestellt und und auf Weiterentwicklungen eingegangen werden um den aktuellen Stand der Theorie zu begreifen. Insbesondere Zahariadis leistete substantielle Beiträge um die Theorie auf europäische Regierungssysteme anzupassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Multiple-Streams-Ansatz
- 2.1 Policy-Cycle und Garbage-Can als Basis des Multiple-Streams-Ansatzes
- 2.2 Der Multiple-Streams-Ansatz
- 3. Kritik und Anwendungsmöglichkeiten
- 4. Multiple-Streams - An idea whose time has come
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Multiple-Streams-Ansatz (MSA) von John Kingdon. Ziel ist es, den Ansatz zu erläutern, Kritikpunkte zu beleuchten und Weiterentwicklungen zu analysieren, um den Erkenntnismehrwert des MSA besser einschätzen zu können. Der Fokus liegt auf der Darstellung des ursprünglichen Ansatzes und seiner Adaption, insbesondere durch Zahariadis für europäische Regierungssysteme.
- Darstellung des Multiple-Streams-Ansatzes
- Analyse des Policy-Cycles und des Garbage-Can-Modells als Grundlage des MSA
- Bewertung von Kritikpunkten und Weiterentwicklungen des Ansatzes
- Erläuterung der Anwendungsmöglichkeiten des MSA
- Abschätzung des Erkenntnismehrwerts des Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt den Multiple-Streams-Ansatz (MSA) von John Kingdon ein und hebt seine Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs seit den 1990er Jahren hervor. Es wird auf die hohe Zitierhäufigkeit des Ansatzes verwiesen und die Zielsetzung der Arbeit erläutert: nähere Beleuchtung des Ansatzes, Aufgreifen von Kritikpunkten, Untersuchung von Weiterentwicklungen und Abschätzung des potentiellen Erkenntnismehrwerts. Die Arbeit plant, den ursprünglichen MSA darzustellen, Weiterentwicklungen zu berücksichtigen und den aktuellen Stand der Theorie zu erfassen, insbesondere Zahariadis' Beiträge zur Anpassung des Ansatzes an europäische Regierungssysteme.
2. Der Multiple-Streams-Ansatz: Dieses Kapitel beschreibt den Multiple-Streams-Ansatz im Detail. Es beginnt mit der Erläuterung des Policy-Cycles als einflussreichstem Orientierungsrahmen in der Politikfeldanalyse und diskutiert dessen Phasen (Problemdefinition, Agenda-Setting, Politikformulierung, Implementierung, Politikevaluierung). Der Fokus liegt auf den Phasen Problemdefinition, Agenda-Setting und Politikformulierung, die im Zentrum der MSA-Analyse stehen. Das Kapitel integriert das Garbage-Can-Modell von Cohen, March und Olsen, welches Entscheidungsverhalten in Organisationen erklärt und die Konzeptualisierung des politischen Systems als „organisierte Anarchie“ hervorhebt. Es unterstreicht, dass im MSA nicht die Einflussfaktoren auf den Agenda-Status eines Themas im Vordergrund stehen, sondern die Prozesse, die zu einer Agendaänderung führen. Die drei zentralen Merkmale des MSA – problematische Präferenzen, unklare Technologien und wechselnde Teilnehmer – werden erläutert, wobei Beispiele aus der Arbeit von Zahariadis zur Veranschaulichung verwendet werden.
Schlüsselwörter
Multiple-Streams-Ansatz, Policy-Cycle, Garbage-Can-Modell, Agenda-Setting, Politikformulierung, Policy-Entrepreneur, organisierte Anarchie, politische Entscheidungsprozesse, Zeitfenster, europäische Regierungssysteme.
Häufig gestellte Fragen zum Multiple-Streams-Ansatz
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über den Multiple-Streams-Ansatz (MSA) von John Kingdon. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Darstellung des ursprünglichen Ansatzes und seiner Adaption, insbesondere durch Zahariadis für europäische Regierungssysteme.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt den Multiple-Streams-Ansatz (MSA), seine theoretischen Grundlagen im Policy-Cycle und Garbage-Can-Modell, seine Kritikpunkte und Weiterentwicklungen, sowie seine Anwendungsmöglichkeiten. Besondere Aufmerksamkeit wird der Adaption des MSA auf europäische Regierungssysteme gewidmet.
Was ist der Multiple-Streams-Ansatz (MSA)?
Der MSA ist ein Modell der Politikfeldanalyse, das politische Entscheidungsprozesse erklärt. Im Gegensatz zu linearen Modellen, betont der MSA die Interaktion von drei unabhängigen Streams (Problemstrom, Politikstrom, Politikstrom), die sich erst zufällig treffen und somit eine politische Entscheidung ermöglichen. Es werden problematische Präferenzen, unklare Technologien und wechselnde Teilnehmer als zentrale Merkmale hervorgehoben.
Welche Rolle spielen der Policy-Cycle und das Garbage-Can-Modell?
Der Policy-Cycle dient als Orientierungsrahmen und beschreibt Phasen politischer Prozesse (Problemdefinition, Agenda-Setting, Politikformulierung etc.). Das Garbage-Can-Modell erklärt Entscheidungsverhalten in Organisationen als „organisierte Anarchie“ und liefert somit ein Verständnis für die unsystematischen Aspekte politischer Entscheidungen im MSA.
Welche Kritikpunkte am MSA werden angesprochen?
Der Text erwähnt, dass Kritikpunkte am MSA im Detail behandelt werden, geht aber in der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit darauf ein. Die genauen Kritikpunkte lassen sich daher aus dem Gesamttext entnehmen.
Wie wird der MSA auf europäische Regierungssysteme angewendet?
Der Text hebt die Bedeutung der Adaption des MSA durch Zahariadis für europäische Regierungssysteme hervor. Die konkreten Anpassungen und Beispiele werden im Detail im Haupttext erläutert.
Was ist das Ziel des Textes?
Ziel des Textes ist es, den MSA zu erläutern, Kritikpunkte zu beleuchten, Weiterentwicklungen zu analysieren und den Erkenntnismehrwert des MSA besser einzuschätzen. Es soll ein umfassendes Verständnis des Ansatzes und seines aktuellen Stands vermittelt werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den MSA?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Multiple-Streams-Ansatz, Policy-Cycle, Garbage-Can-Modell, Agenda-Setting, Politikformulierung, Policy-Entrepreneur, organisierte Anarchie, politische Entscheidungsprozesse, Zeitfenster, europäische Regierungssysteme.
Wie sind die Kapitel des Textes aufgebaut?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung des MSA, einer Analyse der Kritikpunkte und Anwendungsmöglichkeiten und einer abschließenden Bewertung des Erkenntnismehrwerts. Jedes Kapitel wird im Text kurz zusammengefasst.
- Quote paper
- Stefan Raß (Author), 2015, Multiple-Streams. An idea whose time has come?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306342