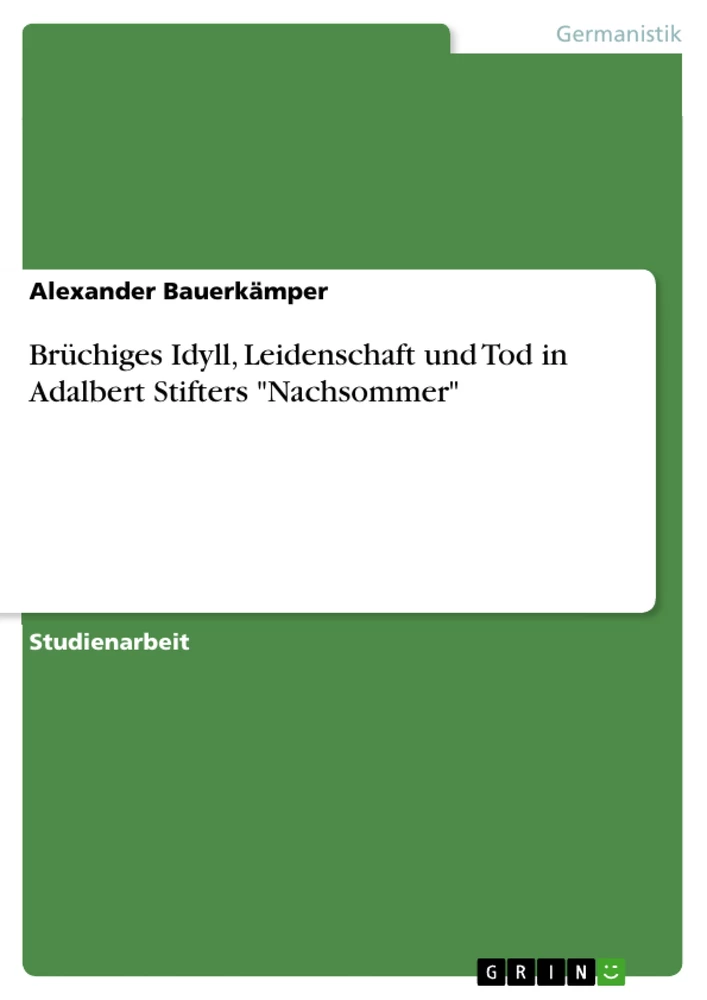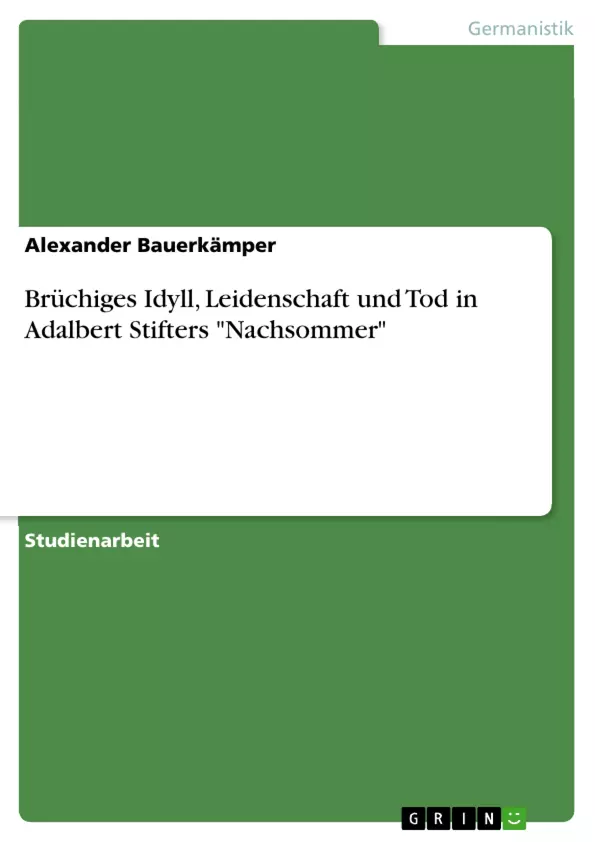Es sollen in dieser Arbeit Brüche, Risse, Irritationen, also ‚Leerstellen’ in Adalbert Stifters Nachsommer untersucht werden, welche die erzählte Welt durchziehen. Sie geben Aufschluss darüber, was im Sumpf von Leidenschaft und Tod, über welchem die Nachsommer-Welt ihre wackeligen Pfähle baut, versenkt worden ist.
Adalbert Stifters Nachsommer ist todlangweilig. Das, was gemeinhin als langweilige Erzählweise empfunden wird – Armut an konfliktreicher Handlung, spröde Dialoge, ‚aufgesetzte’ Sprache, endlose Landschaftsbeschreibungen – das findet sich im Nachsommer wieder und wird hier bewusst eingesetzt, um etwas zu schaffen, das vielleicht nicht als langweilig, wohl aber als spannungsarm und ‚kurzweilig’ intendiert ist. Es sind die analysierten Leerstellen, die dem Werk seine anhaltende Aktualität verleihen und sie sind es auch, die uns für die Langeweile ‚entschädigen’.
Ich möchte also zunächst versuchen, im Folgenden eine Sammlung und Analyse dieser Leerstellen zu unternehmen. Von dort ausgehend wird kurz auf den Lebensrückblick Risachs und dessen außerordentliche Rolle innerhalb der Erzählung einzugehen sein, um dann zum Schluss die Frage zu stellen, was von der idyllischen Konstruktion eigentlich bleibt am Ende der Erzählung, oder: Was kommt nach dem Nachsommer?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung...
- Der Tod steckt im Detail: Irritationen und, Leerstellen' im Nachsommer-Idyll...
- Die äußere Welt: Gesellschaft und Natur
- Die Kunst und die innere Welt der Leidenschaft..
- Tote Handlung, tote Sprache – Harmonisierungsstrategien
- Gegenentwurf zum Gegenentwurf: Risachs Leben
- Zum Schluss: Was bleibt am Ende des Nachsommers..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit Adalbert Stifters Roman „Der Nachsommer“ und analysiert die darin enthaltenen Irritationen und „Leerstellen“, die das scheinbar idyllische Bild der Rosenhaus-Welt durchziehen. Ziel ist es, diese Brüche und Risse zu untersuchen, um zu verstehen, was in der Welt des Nachsommers „versenkt“ worden ist. Die Arbeit beleuchtet die Konstruktion des „reinen Familienlebens“ und die damit verbundenen Harmonisierungsstrategien. Sie untersucht, wie Stifter die „Dekadenz“ seiner Zeit in „Der Nachsommer“ thematisiert und die Rolle des Todes in der Erzählung analysiert.
- Das scheinbare Idyll des Nachsommers und seine „Leerstellen“
- Die Konstruktion der Rosenhaus-Welt als „sterile, abgeschlossene Welt“
- Die Rolle des Todes und der Angst vor ihm in der Erzählung
- Stifters Kritik an der „Dekadenz“ seiner Zeit
- Der Gegenentwurf zum Gegenentwurf: Risachs Lebensgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die scheinbare Langweiligkeit des Nachsommers und die bewusste Verwendung dieser „Spannungsarmut“ durch Stifter. Sie stellt die „Leerstellen“ in den Vordergrund, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden.
Kapitel 2 analysiert die Irritationen und „Leerstellen“ im Nachsommer-Idyll. Es werden die „sterile, abgeschlossene Welt“ und die Harmonisierungsstrategien der Rosenhaus-Welt beleuchtet. Dabei werden die „negativen Affekte“ des menschlichen Zusammenlebens, die im Nachsommer ausgeblendet werden, beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit Risachs Leben und dessen Rolle als Gegenentwurf zum Gegenentwurf. Es wird die Bedeutung seiner Lebenserfahrungen für das Verständnis der „Leerstellen“ im Nachsommer-Idyll herausgestellt.
Schlüsselwörter
Der Nachsommer, Adalbert Stifter, Idyll, Leerstellen, Irritationen, Familienleben, Harmonie, Dekadenz, Tod, Angst, Risach, Gegenentwurf.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Adalbert Stifters „Nachsommer“ oft als langweilig empfunden?
Die Langeweile ist intendiert; sie resultiert aus einer extrem spannungsarmen Handlung, spröden Dialogen und endlosen Landschaftsbeschreibungen.
Was sind die „Leerstellen“ im Roman?
Es sind Brüche und Risse im scheinbaren Idyll, die auf unterdrückte Leidenschaften, Ängste und den Tod hindeuten.
Welche Rolle spielt das Rosenhaus?
Das Rosenhaus ist eine sterile, abgeschlossene Welt, die durch strenge Harmonisierungsstrategien versucht, alles Negative und Dekadente auszublenden.
Wer ist Risach und was ist seine Bedeutung?
Risach ist der Mentor des Protagonisten. Sein Lebensrückblick zeigt die gescheiterte Leidenschaft der Vergangenheit, die das Fundament für das jetzige Idyll bildet.
Was thematisiert Stifter mit der „Dekadenz“?
Stifter reagiert auf den kulturellen Verfall seiner Zeit, indem er eine Welt konstruiert, die durch Ordnung und Entsagung dem Chaos trotzt.
- Arbeit zitieren
- Alexander Bauerkämper (Autor:in), 2012, Brüchiges Idyll, Leidenschaft und Tod in Adalbert Stifters "Nachsommer", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306372