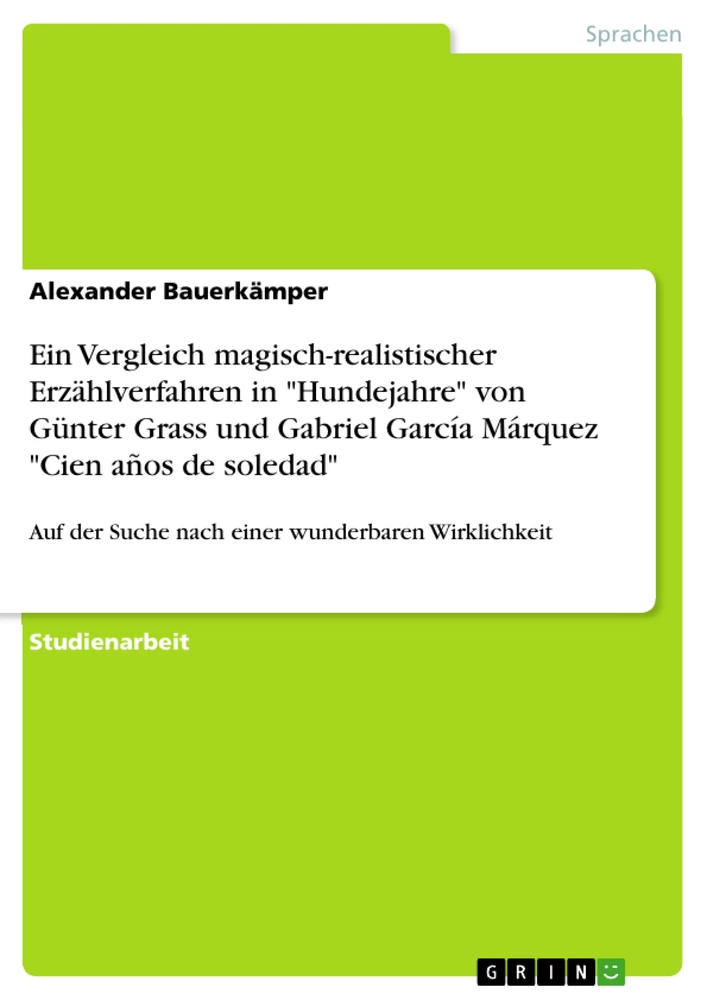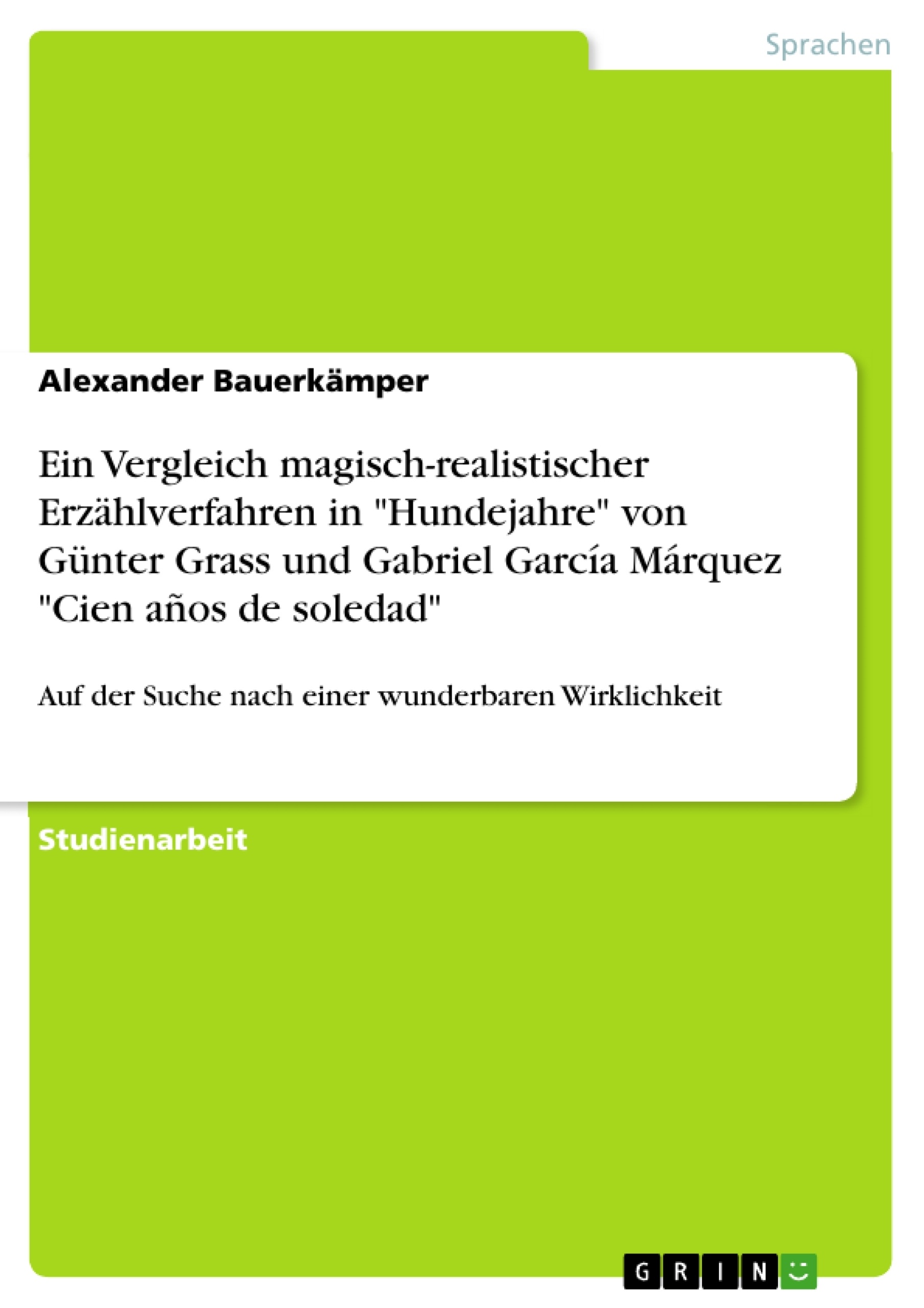Im Fokus dieser Arbeit steht die Schreibweise des sogenannten ‚magischen Realismus‘, die sich in Lateinamerika entwickelte und für den ‚Boom‘ der dortigen Literatur von maßgeblicher Bedeutung war. Zu einer der zentralsten Persönlichkeiten unter den zahlreichen lateinamerikanischen Erfolgsautoren wurde der Kolumbianer Gabriel García Márquez, der mit seinem ‚Opus magnum‘ "Cien años de soledad" (1967) den lateinamerikanischen magisch-realistischen Roman perfektionierte. Autoren in anderen Ländern adaptierten diese Form des Erzählens und so wird auch Günter Grass immer wieder als magisch-realistischer Autor bezeichnet, wobei sich die Forschung dabei hauptsächlich dessen Hauptwerk "Die Blechtrommel" (1959) widmete.
Günter Grass und Gabriel García Márquez verbindet eine lange Bekanntschaft und ihre gegenseitige Verehrung, beide sind sie Literaturnobelpreisträger, beide widmeten sich in oder neben ihrer Literatur auch der Politik. In der vorliegenden Arbeite möchten wir versuchen, "Cien años de soledad" und Günter Grass Roman "Hundejahre" (1963) einem Vergleich zu unterziehen, um dabei eventuelle Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Konzeption der Werke herauszuarbeiten. Im Zentrum unseres Interesses steht dabei die Frage nach ihrer jeweiligen magisch-realistischen Prägungsform. Was also macht "Cien años" zu einem magisch-realistischen Roman und inwiefern kann man dieses Etikett auf die "Hundejahre" anwenden? Ist dies überhaupt möglich?
Hieraus ergibt sich für uns folgende Vorgehensweise: Zunächst wollen wir zeigen, was genau unter ‚magischem Realismus‘ verstanden werden kann. Dabei ist es wichtig, den Terminus von dem ihm verwandten Konzept des ‚real maravilloso‘ abzugrenzen und für uns inmitten verschiedenster Diskurse zu fixieren. Anschließend sollen jene Elemente des magisch-realistischen Erzählens in Cien años de soledad, die für unseren Vergleich produktiv sind, analysiert und systematisiert werden. In einem letzten Schritt wollen wir die Hundejahre auf ähnlich scheinende Aspekte einer magischen Wirklichkeit hin untersuchen, um am Ende die Frage beantworten zu können: Hat Günter Grass mit seinen Hundejahren einen magisch-realistischen Roman geschaffen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der,magische Realismus' und,lo real maravilloso americano'
- Zum magisch-realistischen Erzählen in Cien años de soledad
- Zeit und Geschichte: Weltkonzeptionen in Macondo
- Magischer Alltag und alltägliche Magie
- Zwischenwelt Macondo: ein Fazit
- Die Hundejahre von Günter Grass: ein magisch-realistischer Roman?
- Individuum und Kollektiv im Zeichen der, historischen Wahrheit'
- Phantastik, Mythologie und Märchen in Hundejahre
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz magisch-realistischer Erzählverfahren in Gabriel García Márquez' *Cien años de soledad* und Günter Grass' *Hundejahre*. Ziel ist es, die jeweiligen Konzeptionen der Werke im Hinblick auf ihre magisch-realistische Prägungsform zu vergleichen und Unterschiede aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet, welche Elemente *Cien años de soledad* zu einem magisch-realistischen Roman machen und inwiefern sich diese auf *Hundejahre* übertragen lassen.
- Das Konzept des magischen Realismus und seine Abgrenzung zu verwandten Begriffen wie dem real maravilloso americano.
- Die Analyse magisch-realistischer Elemente in *Cien años de soledad* mit Fokus auf Zeit, Geschichte und Alltagsmagie.
- Die Untersuchung von Aspekten der magischen Wirklichkeit in *Hundejahre* im Vergleich zu *Cien años de soledad*.
- Die Beantwortung der Frage, ob *Hundejahre* als magisch-realistischer Roman bezeichnet werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des magischen Realismus ein und stellt die beiden Werke *Cien años de soledad* und *Hundejahre* im Kontext der literarischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts vor. Sie erläutert die Relevanz des magisch-realistischen Erzählens und die Forschungsfrage der Arbeit.
- Der,magische Realismus' und,lo real maravilloso americano': Dieses Kapitel definiert den Begriff des magischen Realismus und grenzt ihn von verwandten Konzepten, insbesondere dem real maravilloso americano, ab. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und diskutiert verschiedene Definitionen.
- Zum magisch-realistischen Erzählen in Cien años de soledad: Dieses Kapitel analysiert die Elemente des magisch-realistischen Erzählens in *Cien años de soledad*. Es untersucht die Konstruktion von Zeit und Geschichte in Macondo sowie die Darstellung von Magie im Alltag und die Verschmelzung von Realität und Irrealität.
- Die Hundejahre von Günter Grass: ein magisch-realistischer Roman?: Dieses Kapitel untersucht *Hundejahre* auf Aspekte der magischen Wirklichkeit. Es betrachtet die Rolle des Individuums und des Kollektivs im Kontext der historischen Wahrheit sowie die Verwendung von Phantastik, Mythologie und Märchen.
Schlüsselwörter
Magischer Realismus, real maravilloso americano, Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, Hundejahre, Günter Grass, Zeit, Geschichte, Alltagsmagie, Phantastik, Mythologie, Märchen, Realität, Irrealität, Literatur, Lateinamerika, Europa.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet den Magischen Realismus aus?
Er ist eine Erzählweise, bei der magische oder phantastische Elemente als ganz alltäglicher Bestandteil einer realistisch dargestellten Welt erscheinen.
Wie setzt Gabriel García Márquez Magie in Macondo ein?
In "Cien años de soledad" verschmelzen Zeit, Geschichte und übernatürliche Ereignisse zu einem magischen Alltag, in dem das Unmögliche als normal wahrgenommen wird.
Kann man Günter Grass als magisch-realistischen Autor bezeichnen?
Die Arbeit untersucht diese Frage am Beispiel von "Hundejahre" und vergleicht die dortige Verwendung von Mythologie und Märchen mit dem lateinamerikanischen Vorbild.
Was ist der Unterschied zu 'lo real maravilloso americano'?
Während der Magische Realismus eher ein technisches Erzählverfahren ist, beschreibt 'lo real maravilloso' die lateinamerikanische Realität selbst als innewohnend magisch.
Welche Gemeinsamkeiten haben Grass und Márquez?
Beide sind Nobelpreisträger, politisch engagiert und nutzen phantastische Elemente, um komplexe historische Wahrheiten ihrer jeweiligen Heimatländer zu verarbeiten.
- Quote paper
- Alexander Bauerkämper (Author), 2010, Ein Vergleich magisch-realistischer Erzählverfahren in "Hundejahre" von Günter Grass und Gabriel García Márquez "Cien años de soledad", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306374