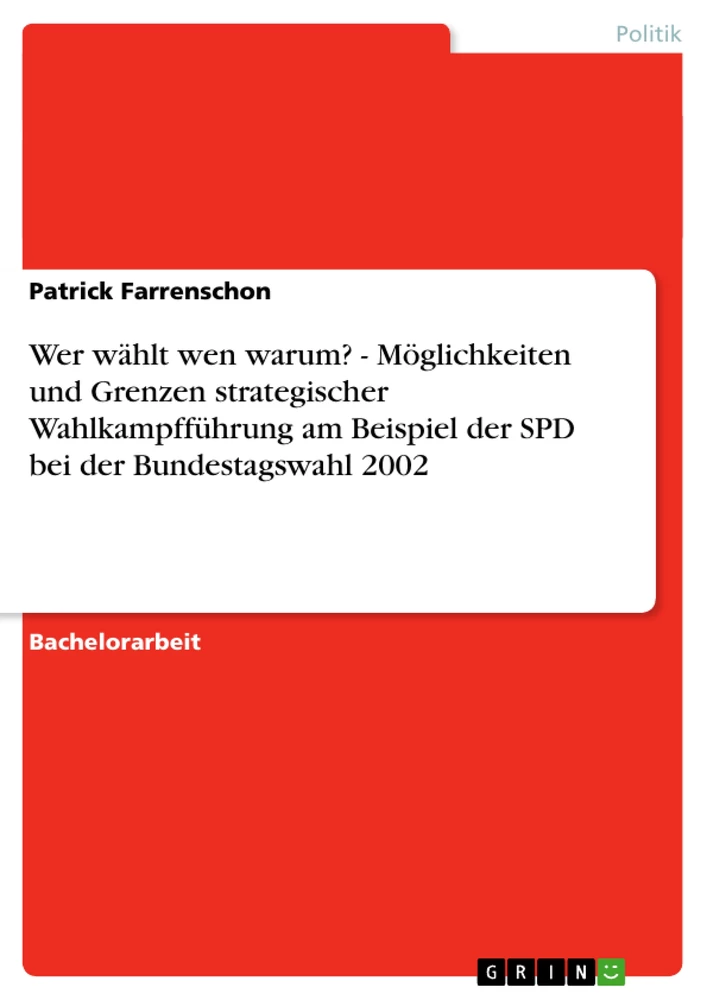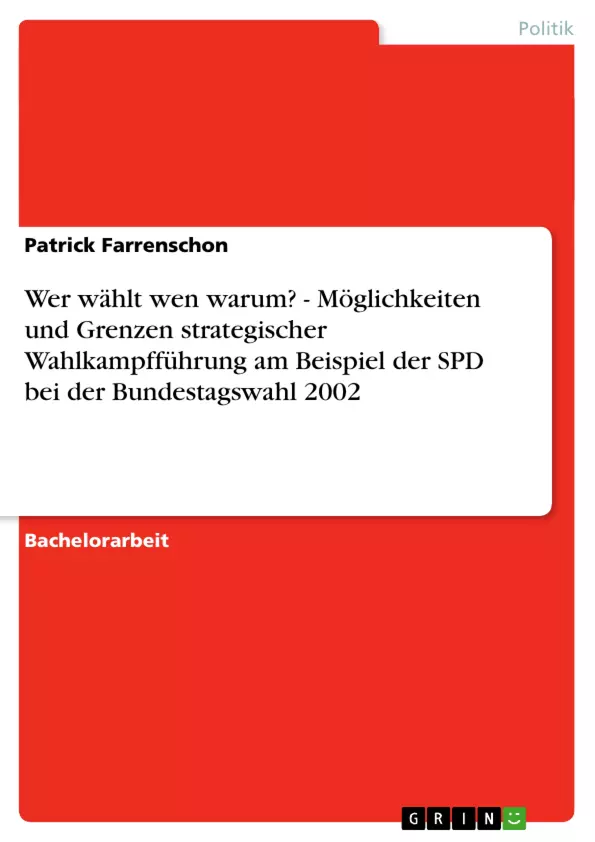Der Gewinn einer Bundestagswahl in Deutschland bedeutet die Erlangung von Macht auf Zeit. Diese Macht ermöglicht es den Akteuren, ihre politischen Zielvorstellungen umzusetzen und die Zukunft des Landes maßgeblich zu gestalten. Der Gewinn einer Bundestagswahl kommt jedoch nicht von ungefähr, es bedarf eines intelligenten Wahlkampfes, mit dem möglichst viele Wählerinnen und Wähler für das eigene Parteiprogramm gewonnen werden sollen. Der Wahlkampf ist in der heutigen Zeit sehr professionell geworden, man bedient sich - einem klaren Konzept folgend - in der betrieblichen Praxis der privaten Wirtschaft erfolgreich erprobter Managementpraktiken, Marketingphilosophien und Public Relations-Instrumenten, um seine Botschaften zielgruppengerecht zu kommunizieren. Ziel dieser Arbeit soll es sein, verschiedene Methoden strategischen Wahlkampfes aufzuzeigen, sie hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen ihres kalkulierbaren Erfolgswertes zu analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse schließlich am Beispiel der SPD bei der Bundestagswahl 2002 auf die Praxis anzuwenden. Dabei wird zunächst allgemein auf die klassischen Theorien des Wahlverhaltens eingegangen, aus deren Kenntnis heraus sich die Grundlage der Handlungsimplikationen für die Wahlkampfstrategen ableiten lässt. In einem zweiten Schritt wird - ebenfalls in allgemeiner Form - der moderne Wahlkampf beschrieben: Wer hält hinter dem Spitzenkandidaten die Fäden in der Hand, wie sehen die selbstgesteckten Ziele aus, und wie werden diese in einer medial wirksamen Inszenierung in konkrete Handlung umgesetzt. Auf der Grundlage dieser allgemeinen Erkenntnisse wird dann konkret auf das Wahlkampfverhalten der SPD im Vorfeld der Bundestagswahl 2002 eingegangen. Ein Interview mit BERND SCHOPPE, dem Leiter des Planungsstabes der SPD, soll zusätzlich einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und Aufschluss über Zielvorstellungen, deren Umsetzung und mögliche Störfaktoren geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klassische Theorien des Wahlverhaltens
- 2.1 Soziologischer Erklärungsansatz
- 2.2 Individualpsychologischer Erklärungsansatz
- 2.3 Theorie des rationalen Wählers
- 2.4 Konsequenzen und Handlungsimplikationen für Wahlkampftreibende
- 3. Wählerverhalten und Parteiensystem
- 3.1 Wahlbeteiligung und Wahlenthaltung
- 3.2 Stammwähler, Wechselwähler, Protestwähler
- 3.3 Veränderungen im Parteiensystem
- 4. Moderne Wahlkampfdramaturgie
- 4.1 Planungsphase
- 4.2 Personalrekrutierung
- 4.3 Festlegung der politischen Agenda
- 4.4 Mobilisierung der eigenen Wählerschaft
- 4.5 Die heiße Phase: Mobilisierung der Unentschlossenen
- 5. Wahlkampf konkret - die SPD bei der Bundestagswahl 2002
- 5.1 Das Wahlprogramm
- 5.2 Die Strategie
- 5.3 Das Wahlkampfhandbuch
- 5.4 Unwägbarkeiten: Die Flutkatastrophe und der Irak-Konflikt
- 5.5 Bewertung des Wahlkampfes
- 6. Blick hinter die Kulissen: Interview mit BERND SCHOPPE
- 6.1 Organisation und Planung
- 6.2 Zielvorstellung und Durchführung
- 6.3 Flut und Irak
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen strategischer Wahlkampfführung anhand des Beispiels der SPD bei der Bundestagswahl 2002. Ziel ist es, verschiedene Methoden des strategischen Wahlkampfes aufzuzeigen und hinsichtlich ihres Erfolgswertes zu analysieren. Die Erkenntnisse werden dann in die Praxis übertragen, um die konkreten Strategien der SPD im Wahlkampf zu beleuchten.
- Klassische Theorien des Wahlverhaltens
- Wählerverhalten und Parteiensystem
- Moderne Wahlkampfdramaturgie
- Wahlkampf der SPD bei der Bundestagswahl 2002
- Interview mit dem Leiter des Planungsstabes der SPD, BERND SCHOPPE
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung von strategischer Wahlkampfführung im Kontext von Bundestagswahlen. Kapitel 2 befasst sich mit den klassischen Theorien des Wahlverhaltens, die als Grundlage für die Analyse von Wahlkampagnen dienen. Kapitel 3 untersucht das Wählerverhalten und die Entwicklung des Parteiensystems. Kapitel 4 beschreibt die moderne Wahlkampfdramaturgie, die verschiedene Methoden der strategischen Wahlkampfführung umfasst. Kapitel 5 analysiert den konkreten Wahlkampf der SPD bei der Bundestagswahl 2002, einschließlich des Wahlprogramms, der Strategie und der Herausforderungen durch externe Faktoren wie die Flutkatastrophe und den Irak-Konflikt. Kapitel 6 gibt durch ein Interview mit BERND SCHOPPE einen Einblick in die Planung und Organisation des Wahlkampfes der SPD.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Wahlverhalten, strategische Wahlkampfführung, Parteiensystem, Wahlprogramm, Wahlstrategie, Wahlkampftaktiken, Bundestagswahl 2002, SPD, Interview, BERND SCHOPPE.
Häufig gestellte Fragen
Welche Wahlstrategie verfolgte die SPD bei der Bundestagswahl 2002?
Die SPD setzte auf eine professionelle Wahlkampfdramaturgie, die Mobilisierung von Wechselwählern und die geschickte Inszenierung des Spitzenkandidaten Gerhard Schröder.
Wie beeinflussten die Flutkatastrophe und der Irak-Konflikt die Wahl?
Diese unvorhersehbaren Ereignisse ermöglichten es der SPD, Kompetenz im Krisenmanagement zu zeigen und sich durch eine klare Haltung gegen den Irak-Krieg von der Opposition abzugrenzen.
Was sind klassische Theorien des Wahlverhaltens?
Dazu gehören der soziologische Ansatz (Milieus), der individualpsychologische Ansatz (Parteibindung) und die Theorie des rationalen Wählers (Nutzenmaximierung).
Was ist ein Wahlkampfhandbuch?
Ein Wahlkampfhandbuch enthält die strategischen Leitlinien, Botschaften und organisatorischen Anweisungen für die Parteibasis, um einen einheitlichen Auftritt im Wahlkampf zu sichern.
Welche Rolle spielt der Planungsstab einer Partei?
Der Planungsstab koordiniert die politische Agenda, die Personalrekrutierung und die mediale Inszenierung, um die Zielgruppen zielgenau anzusprechen.
- Arbeit zitieren
- Patrick Farrenschon (Autor:in), 2003, Wer wählt wen warum? - Möglichkeiten und Grenzen strategischer Wahlkampfführung am Beispiel der SPD bei der Bundestagswahl 2002, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30643