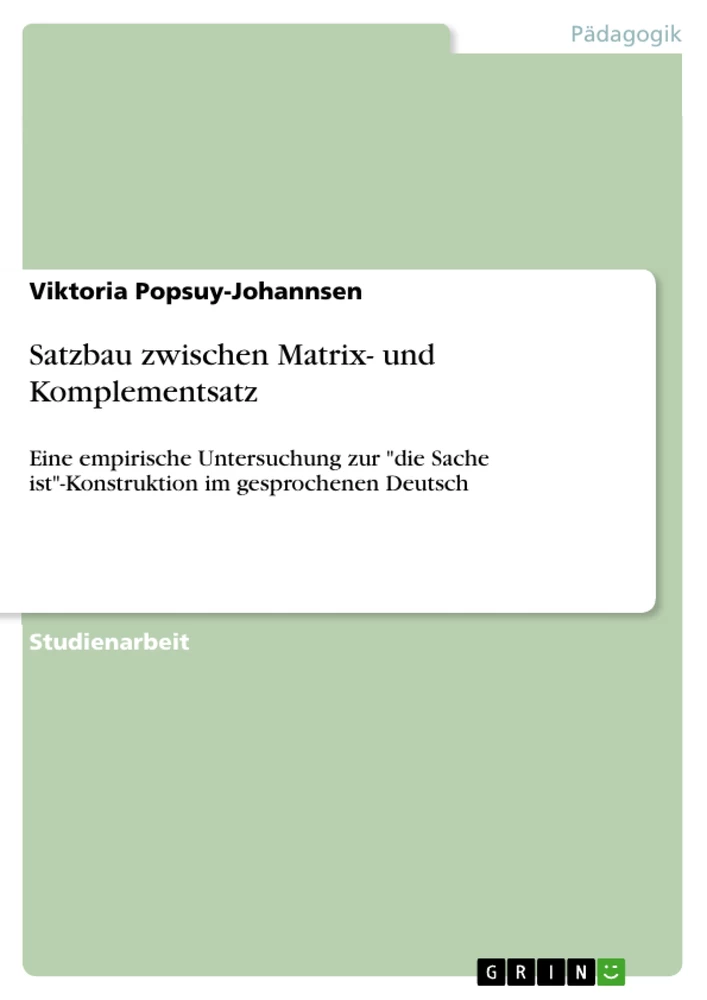In der vorliegenden Arbeit wird die Verwendung der Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist…“ als komplexere Strukturen in den alltäglichen Interaktionen sowie in der Schriftsprache dargestellt. Die Konstruktionen bestehen aus einer Nominalform (z. B. "der Punkt") und einer Kopula "ist." Nach diesen Konstruktionen folgt ein Satz mit der Hauptinformation.
Susanne Günthner unterscheidet in ihrer Untersuchung nach vier syntaktischen Varianten des zweiten Satzteils, der der Konstruktion folgt. Diese werden im zweiten Kapitel beschrieben. Dabei wird auch gezeigt, dass die Einordnung der Konstruktionen „Die Sache ist… usw.“ in das traditionelle Schema der Kategorien „Matrix-“ und „Komplementsatz“ problematisch ist und diese Äußerungen eine andere Funktion haben. Anschließend sollen die Verwendungsweisen der die Sache ist-Konstruktion mit einem anderen Korpus überprüft und damit die Theorie von Günthner bestätigt oder widerlegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verwendungsweisen der Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“ im gesprochenen Deutsch nach Susanne Günthner
- Die Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“ mit einem durch dass-Subjunktor eingeleiteten Komplementsatz mit der Verbendstellung
- Die Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“ ohne Subjunktor dass und mit einem „abhängigen Hauptsatz“
- Die Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“ mit einem längeren Diskurssegment
- Zusammenfassung zur Verwendungsweisen der Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“
- Empirische Überprüfung der Verwendungsweisen der Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung der Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“ im gesprochenen Deutsch. Sie setzt sich zum Ziel, die unterschiedlichen syntaktischen Varianten dieser Konstruktionen zu analysieren und zu zeigen, dass sie nicht den traditionellen Matrix- und Komplementsatz-Strukturen zugeordnet werden können. Die Arbeit greift auf die Untersuchungen von Susanne Günthner zurück und überprüft ihre Ergebnisse mit einem anderen Korpus.
- Analyse der syntaktischen Varianten der „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“-Konstruktionen
- Untersuchung der Funktion dieser Konstruktionen in der Kommunikation
- Vergleich der Ergebnisse mit den Untersuchungen von Susanne Günthner
- Diskussion der Problematik der Einordnung dieser Konstruktionen in das traditionelle Schema der Kategorien „Matrix-“ und „Komplementsatz“
- Bedeutung der Konstruktionen für die Grammatik des gesprochenen Deutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz der Untersuchung der Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“ für die Grammatik des gesprochenen Deutschen dar. Kapitel 2 befasst sich mit den Verwendungsweisen der Konstruktionen nach Susanne Günthner und analysiert die verschiedenen syntaktischen Varianten. Es wird gezeigt, dass diese Konstruktionen keine typischen Matrix- und Komplementsatz-Strukturen darstellen. Kapitel 3 präsentiert eine empirische Überprüfung der Verwendungsweisen der Konstruktionen mit einem anderen Korpus und bestätigt oder widerlegt die Theorie von Günthner.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Konstruktionen „Die Sache/das Ding/der Punkt ist...“ im gesprochenen Deutsch, der Grammatik des gesprochenen Deutschen, der Interaktionellen Linguistik, der Construction Grammar, Matrix- und Komplementsatz-Strukturen, syntaktischen Varianten, empirischer Forschung, Korpuslinguistik.
Häufig gestellte Fragen zum Satzbau im gesprochenen Deutsch
Was sind „Die Sache ist...“-Konstruktionen?
Dies sind komplexe Strukturen im Alltagssprachgebrauch, bestehend aus einer Nominalform (wie „Sache“, „Ding“ oder „Punkt“) und der Kopula „ist“, gefolgt von der Hauptinformation in einem zweiten Satzteil.
Warum ist die Einordnung in Matrix- und Komplementsätze schwierig?
Da diese Äußerungen im gesprochenen Deutsch oft eigene Funktionen haben, die vom traditionellen grammatischen Schema abweichen, lassen sie sich nicht immer eindeutig als abhängige Komplementsätze klassifizieren.
Welche syntaktischen Varianten unterscheidet Susanne Günthner?
Günthner unterscheidet vier Varianten, darunter Konstruktionen mit „dass“-Sätzen, abhängige Hauptsätze ohne Subjunktor sowie Verknüpfungen mit längeren Diskurssegmenten.
Was ist das Ziel der empirischen Überprüfung in dieser Arbeit?
Die Arbeit nutzt ein neues Korpus, um die Theorien von Susanne Günthner zu den Verwendungsweisen dieser Konstruktionen im gesprochenen Deutsch zu bestätigen oder zu widerlegen.
Was ist Interaktionelle Linguistik?
Es ist ein Forschungsansatz, der untersucht, wie sprachliche Strukturen (wie der Satzbau) in der direkten sozialen Interaktion und Kommunikation entstehen und genutzt werden.
- Quote paper
- Master of Education Viktoria Popsuy-Johannsen (Author), 2012, Satzbau zwischen Matrix- und Komplementsatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306562