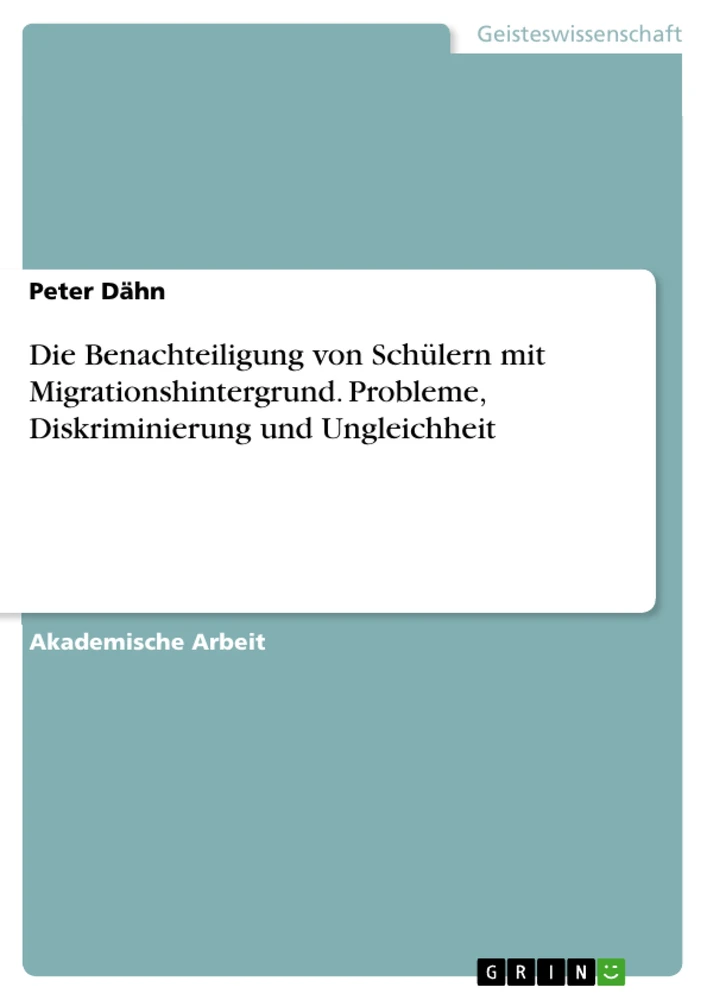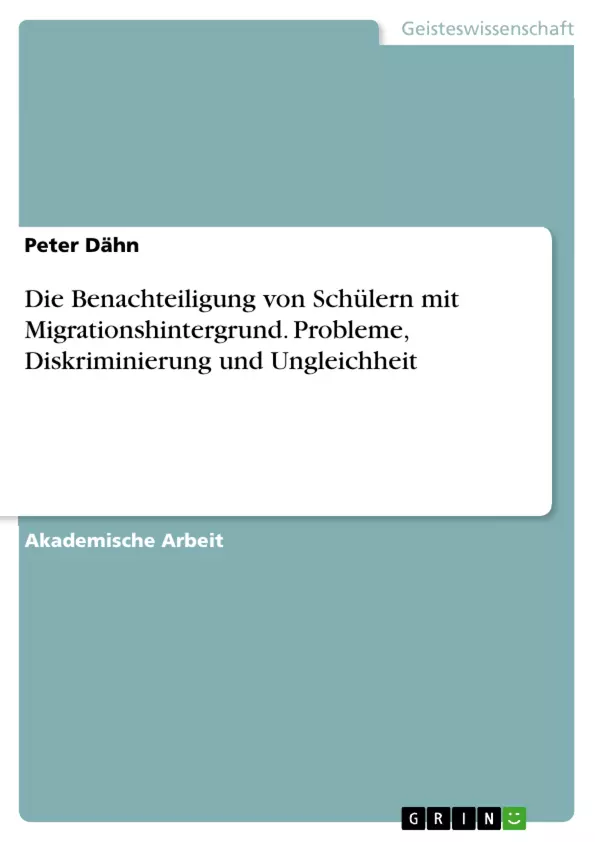Ein wichtiger Punkt, der bei Migrationskindern beachtet werden muss, ist die verschiedene Kultur, die innerhalb des schulischen und des heimischen Umfeldes vorherrscht. Kinder türkischer Eltern verlaufen eine andere Sozialisation als ihr deutsches Pendant.
Viele Eltern sind aus verschiedensten Motivationen heraus nach Deutschland gekommen, vor allem aber, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Dies führt allerdings nicht zwangsläufig zur Anpassung an die traditionelle deutsche Kultur. Häufig leben die Einwanderer in ihrer Häuslichkeit die eigene Kultur weiter, wodurch die Kinder vor ein großes Problem gestellt werden, sie leben in zwei verschiedenen Welten, morgens in Deutschland, abends in der Türkei.
Das Aufziehen der Kinder erfolgt in völlig anderer Weise als bei uns in Deutschland. Vorrangig bis zum sechsten Lebensjahr sind sie ausschließlich dem Umfeld der Mutter zugeordnet und genießen hohe gefühlsmäßige Aufmerksamkeit. Unterschiede findet man auch hier bei dem Aufwachsen von Kindern aus städtischer bzw. dörflicher Gegend. Ab dem sechsten Lebensalter beginnt die eigentliche geschlechtsspezifische Erziehung der Kinder, bei der die Jungen dem Vater zugeordnet werden und die Mädchen bei der Mutter verbleiben. Auch die Ausbildung nach islamischen Verhaltensregeln ist ein Pflichtprogramm bei der Erziehung der Kinder.
Behr schreibt in ihrem Aufsatz, dass türkische Kinder durchaus mehr Freiraum genießen, als deutsche Kinder, und vielmehr am Erwachsenenleben teilnehmen und somit auch eher eigenverantwortlich Tätigkeiten ausüben dürfen. Diese unterschiedlichen Erziehungsausrichtungen und Wertevorstellung können nach einer Einwanderung nach Deutschland zu inneren Konflikten bei den Kindern und Jugendlichen führen, bis dahin, dass sowohl das Wertesystem der türkischen, aber auch das der deutschen Kultur abgelehnt werden können. Wichtig ist hier dann darauf zu achten, dass man versucht die Kinder zu unterstützen, sich in beiden Wertesystemen zurechtzufinden.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Definitionen
- II.I Migrationshintergrund
- II.2 Integration
- II.3 Bildungsbenachteiligung / Bildungsbarrieren
- III Die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund
- III.1 Das Problem mit der Heimatkultur
- III.2 Deutsche Sprache und Spracherwerb
- III.3 Bildungsbenachteiligung aufgrund sozialer Faktoren
- III.3.1 Die Kapitaltheorie nach Pierre Bourdieu
- III.3.2 Reproduktion sozialer Ungleichheit und schulische Integration
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Sie untersucht, ob diese Benachteiligung hauptsächlich durch gesellschaftliche oder politische Bedingungen im Bildungssystem verursacht wird, oder ob auch persönliche Faktoren eine Rolle spielen. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe und Geschichte der Migration in Deutschland und wie sich die Pädagogik von einer Ausländer- zu einer Integrationspädagogik gewandelt hat.
- Die Definition von „Migrationshintergrund“ und „Integration“
- Die Rolle der Kultur, Sprache und des sozialen Hintergrunds bei der Bildungsbenachteiligung
- Die Auswirkungen von institutioneller Diskriminierung auf die Bildung von Migrantenkindern
- Die Relevanz der Segregation innerhalb der Sekundarstufe I
- Die Untersuchung, ob ausschließlich gesellschaftliche oder auch persönliche Faktoren zur Benachteiligung beitragen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Der zweite Teil widmet sich der Definition von Schlüsselbegriffen wie Migrationshintergrund, Integration und Bildungsbenachteiligung. Kapitel III behandelt die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund, wobei verschiedene Aspekte wie die Rolle der Heimatkultur, der deutsche Spracherwerb und die Auswirkungen des sozialen Hintergrunds beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund in Deutschland. Dabei stehen Themen wie Integration, kulturelle und soziale Unterschiede, Spracherwerb, institutionelle Diskriminierung und Segregation im Fokus. Die Kapitaltheorie nach Pierre Bourdieu spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der sozialen Ungleichheit und ihrer Auswirkungen auf die Bildungschancen von Migrantenkindern. Die Arbeit stützt sich auf empirische Studien, wie z.B. PISA, IGLU und TIMMS, um die Bildungsbenachteiligung von Migrantenkindern aufzuzeigen.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Schüler mit Migrationshintergrund oft benachteiligt?
Die Benachteiligung resultiert aus einer Kombination von Sprachbarrieren, institutioneller Diskriminierung und sozialen Faktoren, die den Zugang zu höherer Bildung erschweren.
Welche Rolle spielt die „Heimatkultur“ bei der Bildung?
Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen (z.B. in türkischen Familien) können zu inneren Konflikten führen, wenn Kinder zwischen zwei Wertesystemen – dem heimischen und dem schulischen – navigieren müssen.
Was besagt die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu?
Bourdieu argumentiert, dass der Schulerfolg stark vom kulturellen Kapital (Bildung der Eltern) und sozialen Kapital abhängt. Schulen reproduzieren oft bestehende soziale Ungleichheiten, statt sie auszugleichen.
Was ist institutionelle Diskriminierung im Schulsystem?
Damit sind Strukturen gemeint, die Migrantenkinder systematisch benachteiligen, wie etwa verfrühte Aufteilung auf Schulformen oder mangelnde Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit.
Wie wichtig ist der Spracherwerb für den Bildungserfolg?
Die deutsche Sprache ist der Schlüssel zum Bildungssystem. Defizite im Spracherwerb führen häufig zu schlechteren Leistungen in allen Schulfächern, wie Studien wie PISA belegen.
- Arbeit zitieren
- Peter Dähn (Autor:in), 2010, Die Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund. Probleme, Diskriminierung und Ungleichheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306585