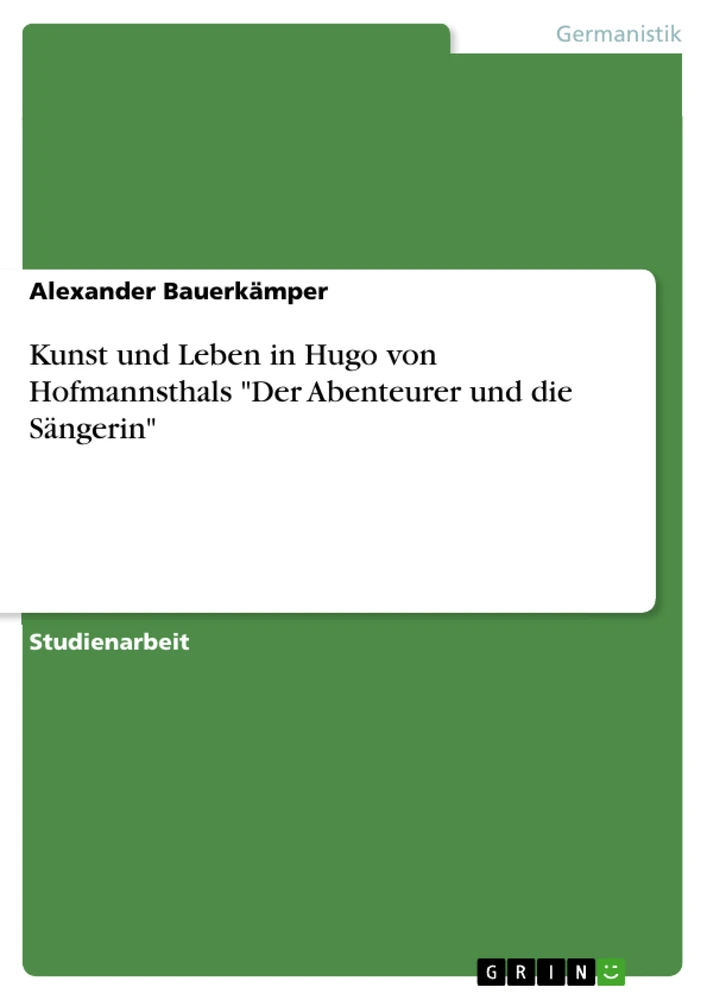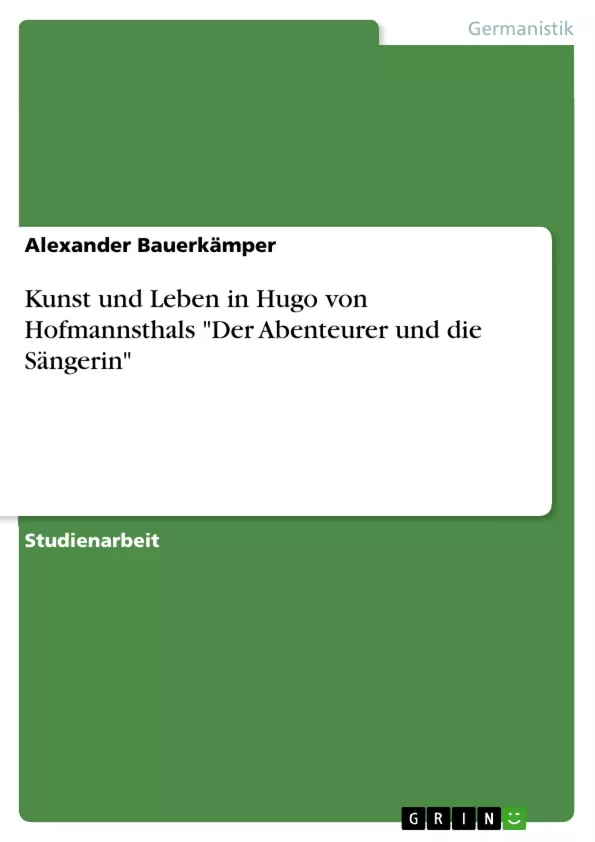Diese Arbeit untersucht das oszillierende Verhältnis zwischen Kunst und Leben in Hugo von Hofmannsthals "Der Abenteurer und die Sängerin". Dabei steht die Figur Vittoria im Mittelpunkt der Betrachtungen. An ihr scheint sich zu zeigen, dass eine ästhetizistische Daseinsform überwunden werden kann und Kunst und Leben keine voneinander entfremdeten, unvereinbaren Bereiche sein müssen.
Um nachzuzeichnen, wie Kunst und Leben in Der Abenteurer und die Sängerin zueinander stehen, werden zunächst die beiden zentralen Figuren, Casanova alias Weidenstamm und Vittoria, in Augenschein genommen und teilweise mit anderen Figuren abgeglichen werden. Anschließend lassen sich diese beiden, ihr Bezug zur Kunst sowie ihre unterschiedlichen Lebenskonzepte besser verorten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die zentralen Figuren
- Der Abenteurer
- Die Sängerin
- Abenteuer, Kunst und Leben
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht das ambivalente Verhältnis von Kunst und Leben in Hugo von Hofmannsthals Stück „Der Abenteurer und die Sängerin". Im Mittelpunkt steht die Figur der Vittoria, deren Leben als Sängerin und ihre Beziehung zu dem Abenteurer Casanova beleuchtet werden. Ziel der Arbeit ist es, zu zeigen, dass ein ästhetizistisches Dasein überwunden werden kann und Kunst und Leben keine unvereinbaren Bereiche sein müssen.
- Die Figur des Abenteurers als Vertreter eines Lebensentwurfs, der sich der Ungebundenheit und dem Genuss des Moments verschreibt
- Die Figur der Sängerin als Gegenpol zum Abenteurer und Ausdruck einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit der Kunst und ihren Auswirkungen auf das Leben
- Die problematische Beziehung zwischen Kunst und Leben im Kontext der Wiener Moderne und der „Kunst-versus-Leben-Dichotomie“
- Das Verhältnis von Erinnerung und Vergessen im Spiel von Kunst und Leben
- Die Rolle der Liebe in der Konfrontation von Kunst und Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar, indem sie die Beschäftigung der Wiener Moderne mit dem Verhältnis von Kunst und Leben beleuchtet. Sie thematisiert die „Kunst-versus-Leben-Dichotomie“ sowie die Figur des Abenteurers in den Werken dieser Epoche.
Das zweite Kapitel widmet sich den zentralen Figuren des Stückes, dem Abenteurer Casanova alias Weidenstamm und der Sängerin Vittoria. Es untersucht die Charakterzüge des Abenteurers, seine Ungebundenheit, seinen Hang zum Genuss des Moments und seine Unfähigkeit zur Wiederholung. Im Vergleich zu Lorenzo Venier, dem Ehemann Vittorias, wird die Figur des Abenteurers als Sehnsuchtsfigur dargestellt.
Schlüsselwörter
Kunst und Leben, Abenteurer, Sängerin, Ästhetizismus, Wiener Moderne, „Kunst-versus-Leben-Dichotomie", Giacomo Casanova, Hugo von Hofmannsthal, Vittoria, Der Abenteurer und die Sängerin, Erinnerung, Vergessen, Liebe.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Hofmannsthals 'Der Abenteurer und die Sängerin'?
Das Stück thematisiert das Spannungsverhältnis zwischen einem ästhetischen Dasein (der Abenteurer) und einem Leben, das durch Erinnerung, Liebe und Kunst Tiefe gewinnt (die Sängerin).
Wer ist die Figur des Abenteurers?
Die Figur basiert auf Giacomo Casanova (hier Weidenstamm). Er verkörpert das Ideal des Augenblicks, der Ungebundenheit und des Vergessens, ist aber letztlich unfähig zu echter Bindung.
Wie wird die Sängerin Vittoria charakterisiert?
Vittoria ist eine Künstlerin, die im Gegensatz zum Abenteurer fähig ist, die Vergangenheit zu bewahren. Sie überwindet den reinen Ästhetizismus und findet eine Verbindung zwischen ihrer Kunst und ihrem realen Leben.
Was bedeutet die 'Kunst-versus-Leben-Dichotomie'?
Es beschreibt den Konflikt der Wiener Moderne, ob man sich der künstlichen, schönen Welt der Kunst hingibt oder den Anforderungen des realen, oft banalen Lebens stellt.
Welche Rolle spielt die Erinnerung in dem Stück?
Erinnerung ist das Element, das Leben konstituiert. Während der Abenteurer durch sein Vergessen substanzlos bleibt, gewinnt Vittoria durch die Erinnerung an ihre Liebe und ihre Kunst an menschlicher Reife.
- Quote paper
- Alexander Bauerkämper (Author), 2013, Kunst und Leben in Hugo von Hofmannsthals "Der Abenteurer und die Sängerin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306689