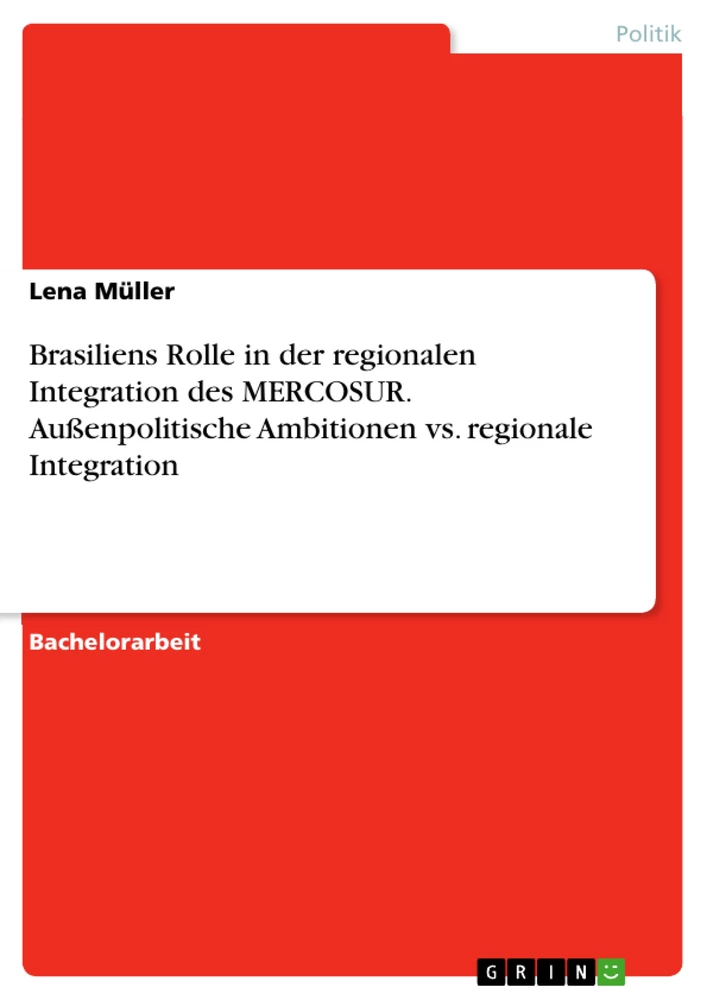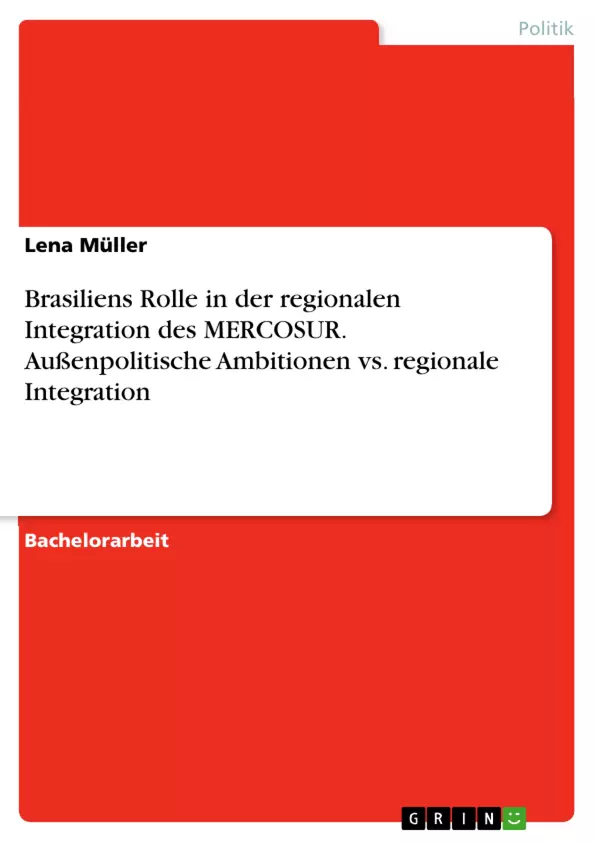Anhand der zur Verfügung stehenden und ausgewählten Literatur werden die wesentlichen Elemente unterschiedlicher Theorien der internationalen Beziehungen dazu verwendet, um Brasiliens teils doppeldeutiges Verhalten innerhalb des MERCOSUR zu erklären, welches augenscheinlich auf seine Machtansprüche und Beziehungen außerhalb des Bündnisses zurückzuführen sind, indem diese Elemente mit Begründung der Verwendung für die Analyse zuerst kurz erläutert werden.
Darauffolgend werden diese Elemente über ausgewählte empirische Fallbeispiele des brasilianischen Verhaltens, die die These verifizieren sollen, überprüft, um folglich das intraregionale Verhalten erklären zu können. Die Fallanalysen „leisten […] wichtige Beiträge zur Identifizierung von Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen.“
Die ausgewählten Fälle beziehen sich auf die bestehenden Beziehungen zu Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation (WTO), dem Bündnis der BRICS-Staaten und den Beziehungen zwischen dem MERCOSUR und der EU mit besonderer Fokussierung auf Brasilien. Diese sollen Folgerungen auf Brasiliens Verhalten innerhalb des südamerikanischen Wirtschafsbündnisses ziehen und somit Brasiliens außenpolitische Ambitionen, vor allem die innerhalb des MERCOSUR erklären.
Aus der Sicht qualitativer Forschung wird hier somit anhand der ausgewählten Theorie das brasilianische Verhalten auf der Makroebene versucht zu erklären und zu verstehen, welches ein singuläres Phänomen darstellt, da es nicht vollends mit bestehenden Analysen der regionalen Integration der EU vergleichbar ist.
Daher sollen insgesamt durch eine abduktive Analyse sowohl empirisch nachweisbare Aussagen mit Betrachtung theoretischer Aussagen als auch Fall- beziehungsweise Strukturaussagen getroffen werden, die die in dieser Arbeit behandelte These unterstützen und das brasilianische Verhalten erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und politikwissenschaftliche Herausforderung
- Aufbau und Vorgehensweise
- Literatur und Forschungsstand
- Theoretische Einordnung
- Regionale (wirtschaftliche) Integration
- Bedeutung einer regionalen Führungsmacht
- Institutionalisierung und Interdependenz
- Realistischer Intergouvernementalismus
- Globales Machtgleichgewicht
- Brasiliens außenpolitische Ambitionen
- Die regionale Integration im MERCOSUR
- Brasiliens Ansprüche auf eine regionale Führung
- Institutionelle Interdependenzen im MERCOSUR
- Einschränkungen regionaler Integration durch Intergouvernementalismus im MERCOSUR
- Brasiliens Rolle im globalen Kontext
- Das brasilianische Bestreben eines ständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat
- Verschiebung von globalen Machtverhältnissen in der Welthandelsorganisation
- Brasilien und die BRICS
- Interregionale Beziehung zwischen dem MERCOSUR und der EU
- Abschließende Betrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rolle Brasiliens in der regionalen Integration des MERCOSUR und analysiert die Wechselwirkungen zwischen Brasiliens außenpolitischen Ambitionen und dem regionalen Integrationsprozess.
- Die Bedeutung des MERCOSUR für Brasilien als Instrument zur Stärkung der regionalen und globalen Position
- Die Herausforderungen der regionalen Integration im MERCOSUR im Kontext von Brasiliens globalen Machtansprüchen
- Die Rolle des Intergouvernementalismus und die Auswirkungen auf die Institutionalisierung des MERCOSUR
- Brasiliens Beziehungen zu extraregionalen Akteuren, wie der EU, den BRICS und den Vereinten Nationen, und deren Einfluss auf die regionale Integration
- Die Frage, ob Brasiliens außenpolitische Ambitionen den regionalen Integrationsprozess im MERCOSUR fördern oder behindern
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Problemstellung sowie die politikwissenschaftliche Herausforderung dar. Außerdem werden Aufbau, Vorgehensweise und der Forschungsstand der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2 bietet eine theoretische Einordnung der regionalen Integration, der Bedeutung einer regionalen Führungsmacht und der Rolle von Institutionalisierung und Interdependenz. Außerdem wird der Realistische Intergouvernementalismus als theoretischer Rahmen vorgestellt.
- Kapitel 3 analysiert Brasiliens außenpolitische Ambitionen im Kontext der regionalen Integration im MERCOSUR. Es werden Brasiliens Ansprüche auf eine regionale Führungsrolle, die institutionellen Interdependenzen innerhalb des MERCOSUR und die Einschränkungen regionaler Integration durch den Intergouvernementalismus beleuchtet. Außerdem wird Brasiliens Rolle im globalen Kontext mit Fokus auf die Beziehungen zur EU, den BRICS und den Vereinten Nationen untersucht.
Schlüsselwörter
Regionale Integration, MERCOSUR, Brasilien, Außenpolitik, Führungsrolle, Intergouvernementalismus, Institutionalisierung, Interdependenz, BRICS, EU, UN, Welthandelsorganisation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Brasilien im MERCOSUR?
Brasilien agiert als regionale Führungsmacht, nutzt den MERCOSUR aber oft primär als Instrument für seine globalen machtpolitischen Ambitionen.
Warum ist die Institutionalisierung des MERCOSUR schwach?
Aufgrund des „Realistischen Intergouvernementalismus“ behalten die Nationalstaaten (besonders Brasilien) lieber die Kontrolle, statt Kompetenzen an supranationale Organe abzugeben.
Was sind Brasiliens globale Ziele?
Dazu gehören ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat, Einfluss in der Welthandelsorganisation (WTO) und die Stärkung des BRICS-Bündnisses.
Wie ist das Verhältnis zwischen MERCOSUR und der EU?
Die Arbeit untersucht die interregionalen Beziehungen und wie Brasilien versucht, durch Verhandlungen mit der EU seine wirtschaftliche Position zu stärken.
Fördert Brasiliens Außenpolitik die regionale Integration?
Die Arbeit analysiert die Spannung zwischen Brasiliens Streben nach globaler Geltung und der notwendigen Rücksichtnahme auf die kleineren MERCOSUR-Partner.
- Quote paper
- Lena Müller (Author), 2015, Brasiliens Rolle in der regionalen Integration des MERCOSUR. Außenpolitische Ambitionen vs. regionale Integration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306756