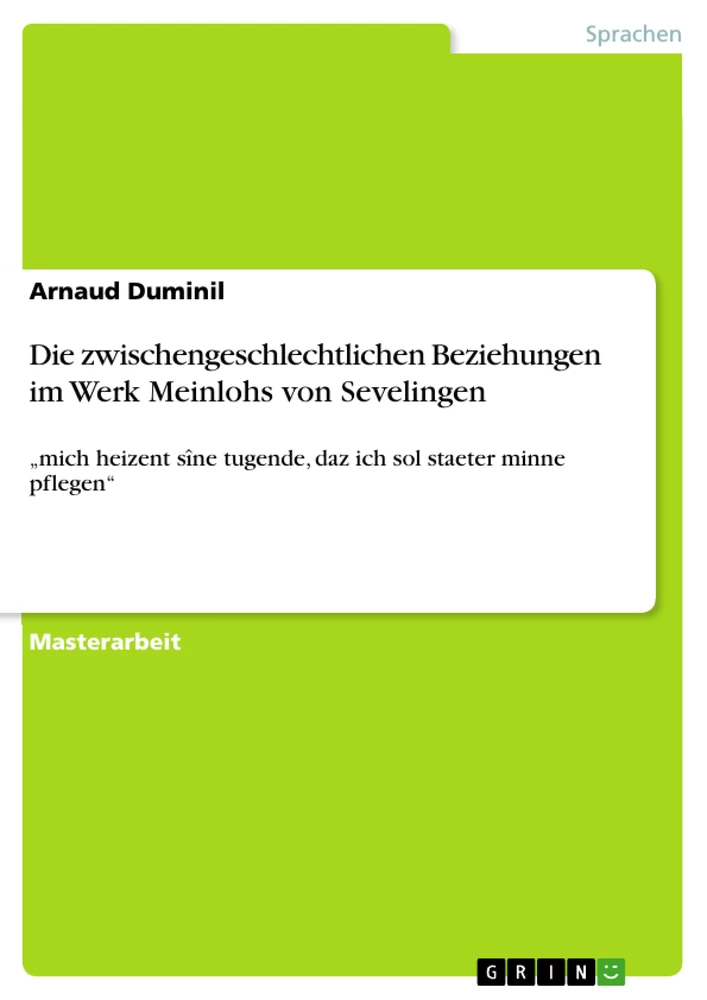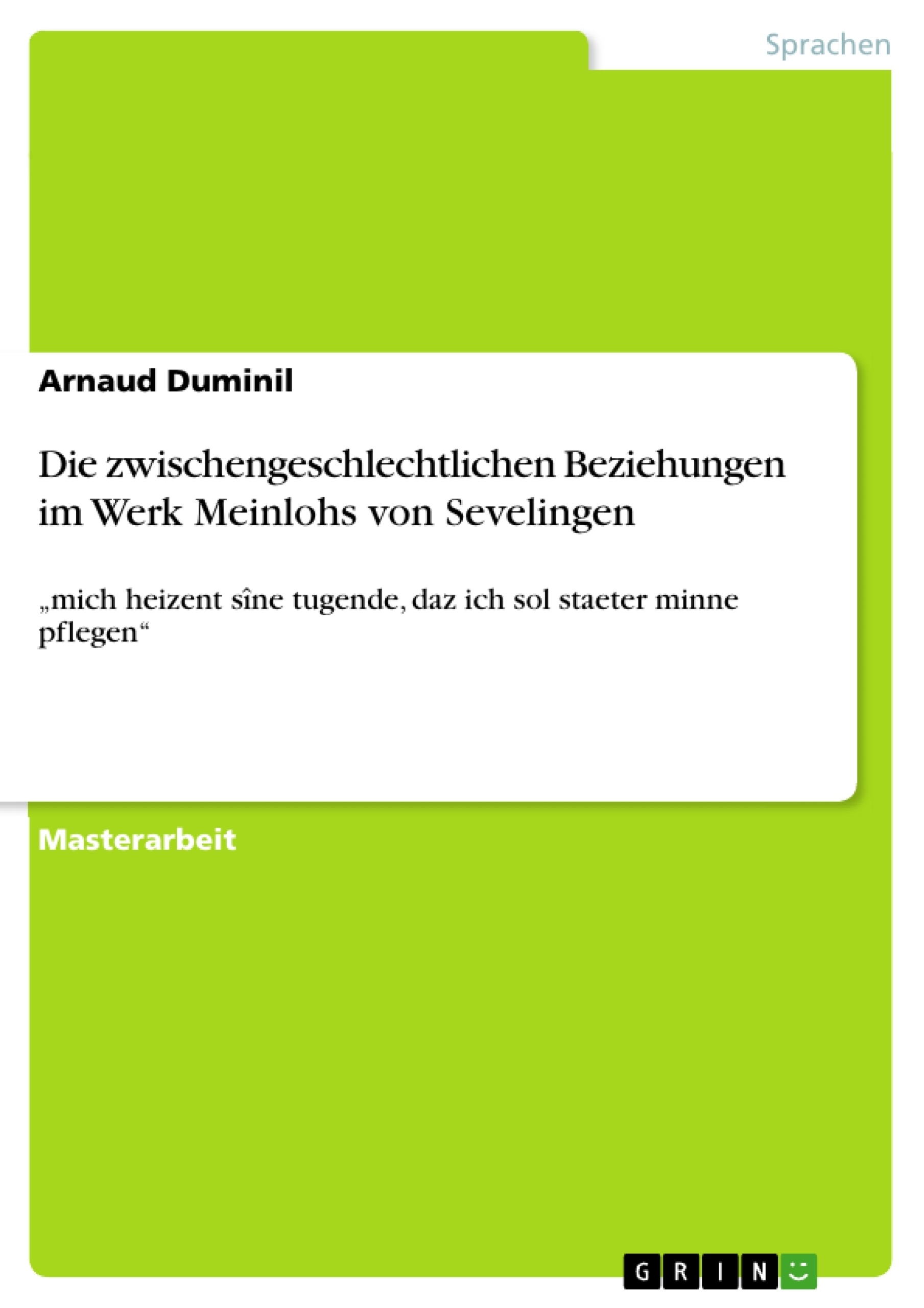Es wird durch die Heilige Schrift überliefert, dass es um Gottes guten Willen gewesen sei, dass Er den Menschen nach Seinem Bild geschaffen habe. Als aber der erste Mann sich in der Schöpfung befunden habe, habe er sich trotz der Gesellschaft der Tiere und Pflanzen einsam auf Erden gefühlt und sich einen Freund gewünscht, der ihn hätte besser verstehen können als die Tiere. Daher habe er die Gottheit darum gebeten, dass Er ihm diesen Freund schaffe. Und so, dem Genesisbericht nach (Gen 1-3), erblickte die erste Frau das Licht der Welt. Da aber Eva durch die verschwörerischen Ratschläge der argen Schlange die Sünde in den Garten Eden habe kommen lassen, seien Adam und Eva mit der Sterblichkeit bestraft worden und die Frau sei dem Mann unterworfen worden (Gen 3, 16: „aber er soll dein Herr sein“), weil nicht Adam, sondern Eva als erste gesündigt und dadurch ihren Mann verraten habe. So sollte in den urjüdischen und urchristlichen Gemeinden gerechtfertigt werden, dass der Mann die Hauptrolle zu spielen und die Frau ihm untertänig zu dienen habe, weil Er es so wolle.
Seitdem der Kaiser Theodosios I. 380 das Christentum faktisch zur Staatsreligion erhoben und dadurch die alten heidnischen Religionen des Imperiums und hiermit ihre Darstellungen der zwischengeschlechtlichen Beziehungen verteufelt wurden, hatten sich dieses Bild des Verrats der Frau und die Vorstellung ihrer Unterwürfigkeit befestigt, bis zu den meist schon (arianisch-)christlichen Völkern, die das Imperium überfielen und von da an die Geschichte der westlichen Welt bestimmten. Da aber die Christen nicht immer den Wörtern der Bibel „treufest“ gefolgt haben und die christlich geprägte Gesellschaft sich nach und nach verweltlicht hat, konnte sich die Frau verhältnismäßig emanzipieren und sozusagen ihr eigener Mann werden. Heutzutage aber ist der weibliche Mensch noch nicht durch und durch gesellschaftlich betrachtet dem männlichen gleichgestellt und es herrschen immer noch Ungleichheiten, sowohl in Bezug auf die Gesetze, als auch in den Köpfen mancher Menschen des 21. Jahrhunderts. Die Geschichte der Beziehungen zwischen Mann und Frau ist überhaupt nicht als friedlich zu kennzeichnen. Es geht hier um Konflikt, und der dualistische Antagonismus zwischen den beiden Geschlechtern prägt immer noch die heutige „aufgeklärte“ Gesellschaft, ob man will oder nicht, wie er die Gesellschaft des Mittelalters, mit der sich diese Arbeit befasst, geprägt hat. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I/ Meinloh und seine Zeit
- A/ Autorschaft im Mittelalter
- B/ Die ars litteraria als höfisches Medium
- C/ Die Kunst der discussio
- II/ Meinlohs Auffassung der „minne“
- A/ Wen lieben?
- B/ Die „minne“ und die Ehepraxis
- C/ Die Rolle der Kirche
- III/ Die „minne“ als gesellschaftliches Spiel
- A/ Warum leiden?
- B/ Moral und Sexualität
- C/ Meinlohs Frauen und Männer
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den zwischengeschlechtlichen Beziehungen im Werk Meinlohs von Sevelingen, einem Minnesänger des 13. Jahrhunderts. Sie untersucht, wie Meinloh die „minne“ definiert, welche Rolle sie im gesellschaftlichen Kontext spielt und wie sie sich von anderen zeitgenössischen Auffassungen unterscheidet.
- Die Rolle der „minne“ im höfischen Kontext des Mittelalters
- Die Verbindung zwischen „minne“ und Ehepraxis
- Die Bedeutung der Kirche im Kontext der „minne“
- Die Darstellung der Frau in Meinlohs Werk
- Die „minne“ als gesellschaftliches Spiel und ihre Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Mann und Frau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Mann und Frau. Sie stellt den Kontext des Mittelalters und die Bedeutung der „minne“ als zentrale Thematik dar.
Kapitel I beleuchtet die Zeit Meinlohs und die literarische Tradition, in der er steht. Es behandelt die Autorschaft im Mittelalter, die „ars litteraria“ als höfisches Medium und die Kunst der „discussio“.
Kapitel II widmet sich Meinlohs eigener Auffassung der „minne“. Es analysiert, wen er liebt, wie er die „minne“ mit der Ehepraxis verknüpft und welche Rolle die Kirche spielt.
Kapitel III untersucht die „minne“ als gesellschaftliches Spiel. Es beleuchtet die Gründe für Leid in der Liebe, die Verbindung zwischen Moral und Sexualität und Meinlohs Darstellung von Frauen und Männern.
Schlüsselwörter
Minnesang, „minne“, Mittelalter, höfisches Leben, Ehe, Kirche, Gesellschaft, Geschlechterrollen, Literatur, „ars litteraria“, „discussio“, Meinloh von Sevelingen.
- Arbeit zitieren
- Arnaud Duminil (Autor:in), 2014, Die zwischengeschlechtlichen Beziehungen im Werk Meinlohs von Sevelingen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306810