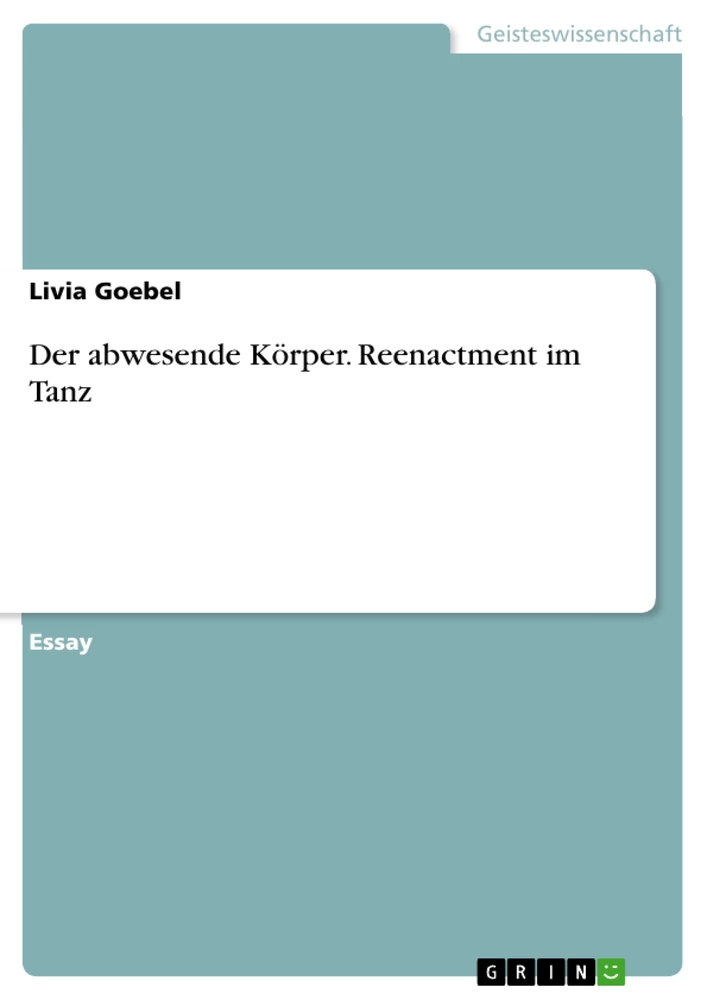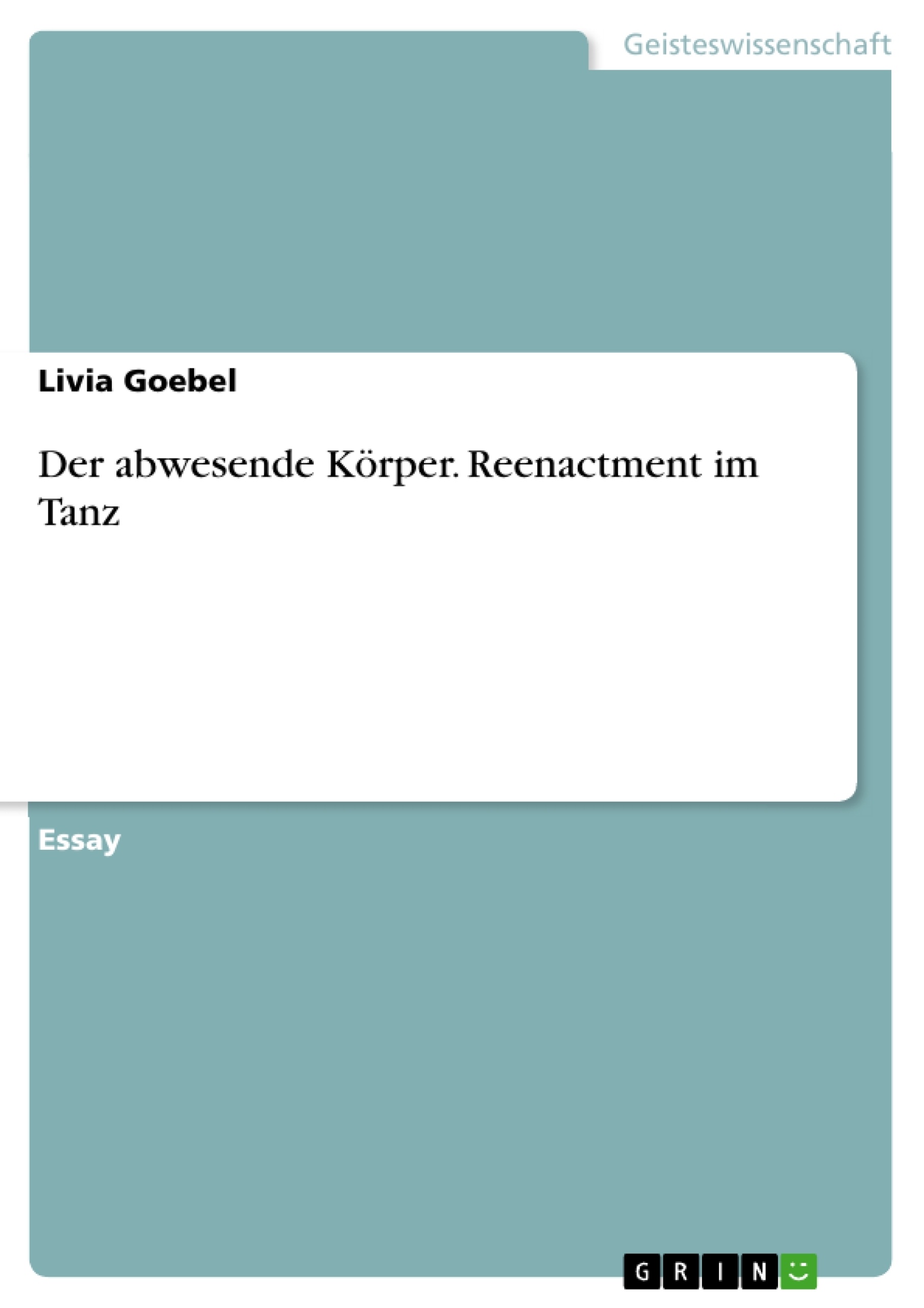Bei jedem tänzerischen Reenactment steht der Körper im Mittelpunkt. Er ist Archiv und gegenwärtiges Medium in einem. Über ihn wird erinnert und tradiert.
Diese „Geste des Bewahrens“ sowie das daraus resultierende Ergebnis sollen hier anhand von Beispielen untersucht werden.
Ausgehend von der Untersuchung wie Bewegung erinnert wird wird, anhand der Derra de Moroda Dance Archives, ein Tanzarchiv vorgestellt.
In der Betrachtung des (Neu-)Tanzens wird die Unterscheidung zwischen der Rekonstruktion und des Reenactments herausgearbeitet, um das Reenactment, ein schwer zu fassender Begriff, besser definieren zu können.
Hierbei werden die Begriffe der Rekonstruktion und des Reenactments nach Annemarie Matzke verwendet.
Darüber werden, anhand der Arbeit „50 ans de danse – 50 years of dance“ von Boris Charmatz, die Herausforderungen im tänzerischen Reenactment im Umgang mit archivarischen Material, die durch die Schwierigkeiten im Umgang mit der Flüchtigkeit der Bewegung einhergehen, erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erinnerte Bewegung
- Archivierter Tanz
- Das Reenactment
- „,50 ans de danse - 50 years of dance“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Besonderheiten von Reenactments im Tanz. Sie untersucht die Beziehung zwischen Erinnerung, Archivierung und dem (Neu-)Tanzen von Bewegung.
- Erinnern von Bewegung als individueller, körperlicher Prozess
- Die Rolle von Tanzarchiven als Speichermedien für flüchtiges Bewegungswissen
- Unterschiede zwischen Rekonstruktion und Reenactment
- Die Herausforderungen des Reenactments im Umgang mit archivarischem Material
- Das Reenactment als „Geste des Bewahrens“ und seine Auswirkungen auf die ursprüngliche Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor und führt in die Thematik des tänzerischen Reenactments ein. Sie beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die mit dem Erhalt und der Wiedergabe von Bewegung verbunden sind.
- Erinnerte Bewegung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Erinnern von Bewegung und stellt die Frage, wie Bewegung im menschlichen Gedächtnis gespeichert und wiedergegeben wird. Es wird dabei auf die Unterschiede zwischen dem natürlichen, internen Gedächtnis und externen Speichermedien eingegangen.
- Archivierter Tanz: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle von Tanzarchiven als Speichermedien für Bewegung. Es stellt die Derra de Moroda Dance Archives als Beispiel vor und beleuchtet die Besonderheiten dieses Archivs im Vergleich zu anderen.
- Das Reenactment: Dieses Kapitel erklärt den Begriff des Reenactments und unterscheidet ihn von der Rekonstruktion. Es geht auf die unterschiedlichen Herangehensweisen beim (Neu-)Tanzen von Bewegung ein und zeigt die Herausforderungen auf, die mit dem Reenactment verbunden sind.
- „,50 ans de danse - 50 years of dance“: Dieses Kapitel beleuchtet die Arbeit von Boris Charmatz und analysiert die Herausforderungen, die im tänzerischen Reenactment im Umgang mit archivarischem Material auftreten. Es fokussiert auf die Schwierigkeiten im Umgang mit der Flüchtigkeit der Bewegung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Reenactment, Tanzarchiv, Bewegungserinnerung, Körperlichkeit, Flüchtigkeit, Rekonstruktion, Archivierung, Derra de Moroda Dance Archives, „,50 ans de danse - 50 years of dance“, Boris Charmatz.
- Arbeit zitieren
- Livia Goebel (Autor:in), 2015, Der abwesende Körper. Reenactment im Tanz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306886