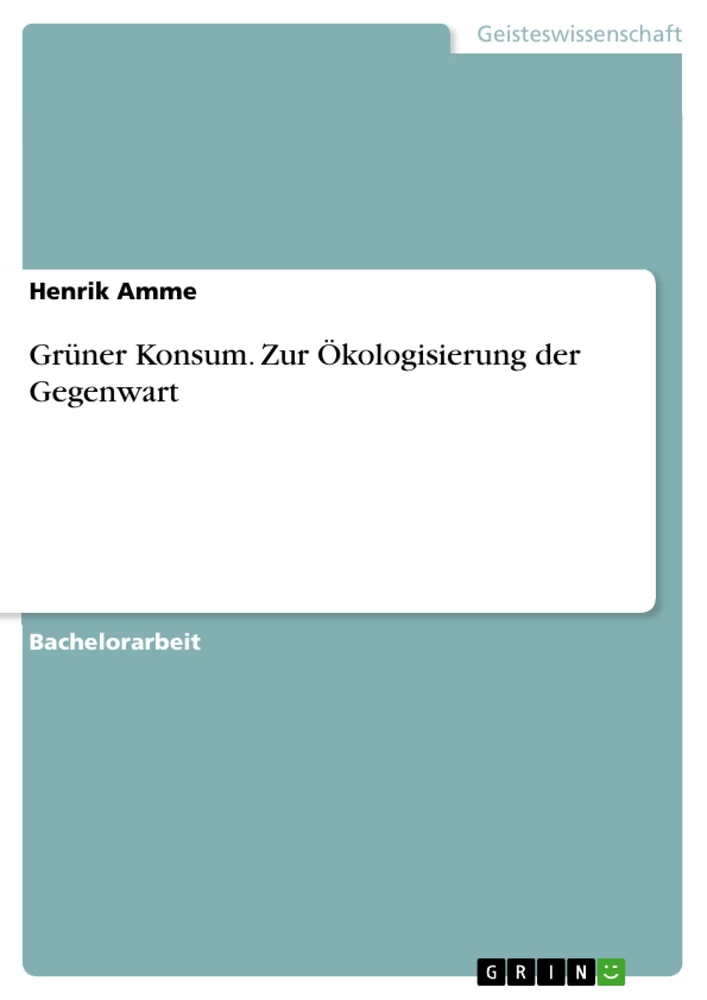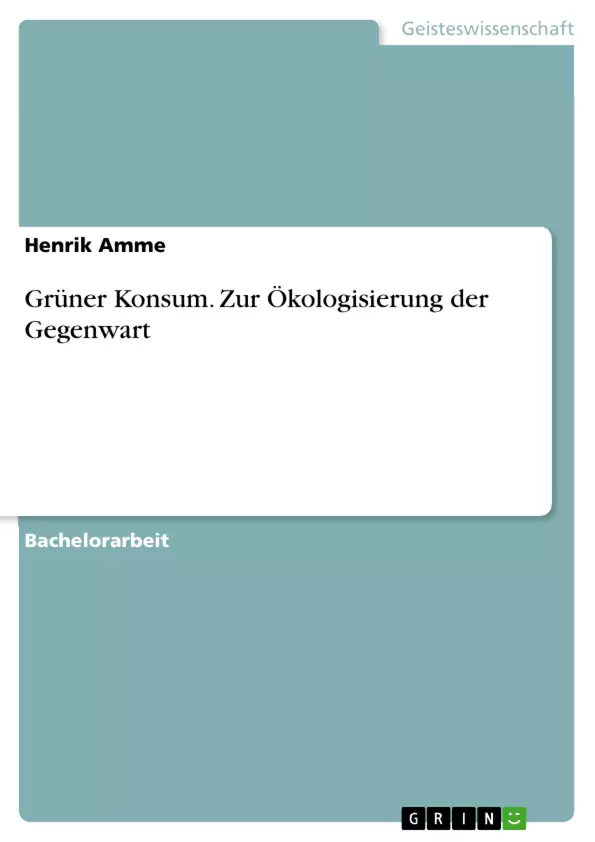Wie in einer Gesellschaft konsumiert wird, verrät ihren Gegenwartszustand. Wo Konsum dazu dient, das Überleben zu sichern oder grundlegende Bedürfnisse zu befriedigen, nimmt das gesellschaftliche Zusammenleben gänzlich andere Formen an als in hoch vermögenden Gesellschaften, wie sie in Westeuropa vorzufinden sind. Wenn durch die materiellen Bedingungen einer Gesellschaft die physische Not beseitigt oder zumindest marginalisiert worden ist, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich der Konsum in Form verschiedenster Konsumstile vervielfachen und ausdifferenzieren kann.
Konsumfragen stellen sich heute in erster Linie als Lebensstilfragen: Wie wollen wir leben? Wer wollen wir sein? Konsum hat in unberechenbarem Maße an Symbol- und Prestigefunktion zugenommen. Der ökologische Diskurs trägt seit den 1970er Jahren bis heute deutlich erkennbare und kaum fassbare Blüten. Von der Nahrung über das Wohnen bis hin zu Freizeitaktivitäten – die Wahl der Kartoffel, des Eigenheims oder des Friseurs kann zur ökologischen Frage werden.
Diese Arbeit möchte aufzeigen, wie aus der Sicht der deutschen Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Konsumfragen beantwortet werden sollten. Ferner, was es heißt nach grünen Prämissen zu leben: Welche Handlungsempfehlungen werden von den GRÜNEN in Deutschland gegeben, wie können diese aus soziologischer Sicht verstanden werden und zu welchen sozialen Konsequenzen führt das Lob grüner Tugenden?
Inhaltsverzeichnis
- Diagnoseschwerpunkt
- Konsum und Soziologie
- Ökologisierung des Konsums.
- Konsum und Lebensstil.
- Genese des Konsums..
- Ökologischer Diskurs.
- Methodischer Schwerpunkt
- Diskursanalyse und Konsum.
- Kritische Diskursanalyse.....
- Analyseschwerpunkt...
- Konsum im ökologischen Diskurs .
- Grüner Konsum
- Form, Inhalt und Rhetorik.
- Macht..
- Sicherheit..
- Lifestyle........
- Risiko
- Prävention........
- Zusammenfassung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den grünen Konsum aus der Perspektive der deutschen Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sie beleuchtet, wie die GRÜNEN Konsumfragen beantworten und einen grünen Lebensstil fördern möchten. Dabei werden die Handlungsempfehlungen der GRÜNEN aus soziologischer Sicht analysiert und die sozialen Konsequenzen des grünen Konsums untersucht.
- Die Ökologisierung des Konsums und die Rolle der GRÜNEN in diesem Prozess
- Der Zusammenhang zwischen Konsum und Lebensstil
- Die soziologische Analyse grüner Handlungsempfehlungen
- Die sozialen Konsequenzen des grünen Konsums
- Die Bedeutung der sociology of consumption für die Analyse des grünen Konsums
Zusammenfassung der Kapitel
Diagnoseschwerpunkt
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet die Rolle des Konsums in der Gesellschaft und die wachsende Bedeutung der Ökologisierung des Konsums. Er analysiert den Zusammenhang zwischen Konsum und Lebensstil sowie die Genese des Konsums. Weiterhin wird der ökologische Diskurs und seine Relevanz in der heutigen Zeit betrachtet.
Methodischer Schwerpunkt
Dieser Teil der Arbeit widmet sich der Methode der Diskursanalyse und ihrer Anwendung auf den Konsum. Insbesondere wird die kritische Diskursanalyse vorgestellt, die es ermöglicht, Machtstrukturen und Diskurseffekte im Zusammenhang mit dem Konsum zu untersuchen.
Analyseschwerpunkt
Im dritten Teil der Arbeit wird der Konsum im ökologischen Diskurs analysiert, wobei der Fokus auf dem grünen Konsum liegt. Die Arbeit untersucht die Form, den Inhalt und die Rhetorik des grünen Konsums sowie die damit verbundenen Machtstrukturen, Sicherheitsaspekte, Lebensstilvorstellungen, Risiken und Präventionsmaßnahmen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind grüner Konsum, Ökologisierung, Lebensstil, Diskursanalyse, Nachhaltigkeit, soziale Konsequenzen, GRÜNE, sociology of consumption.
- Arbeit zitieren
- Henrik Amme (Autor:in), 2011, Grüner Konsum. Zur Ökologisierung der Gegenwart, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306988