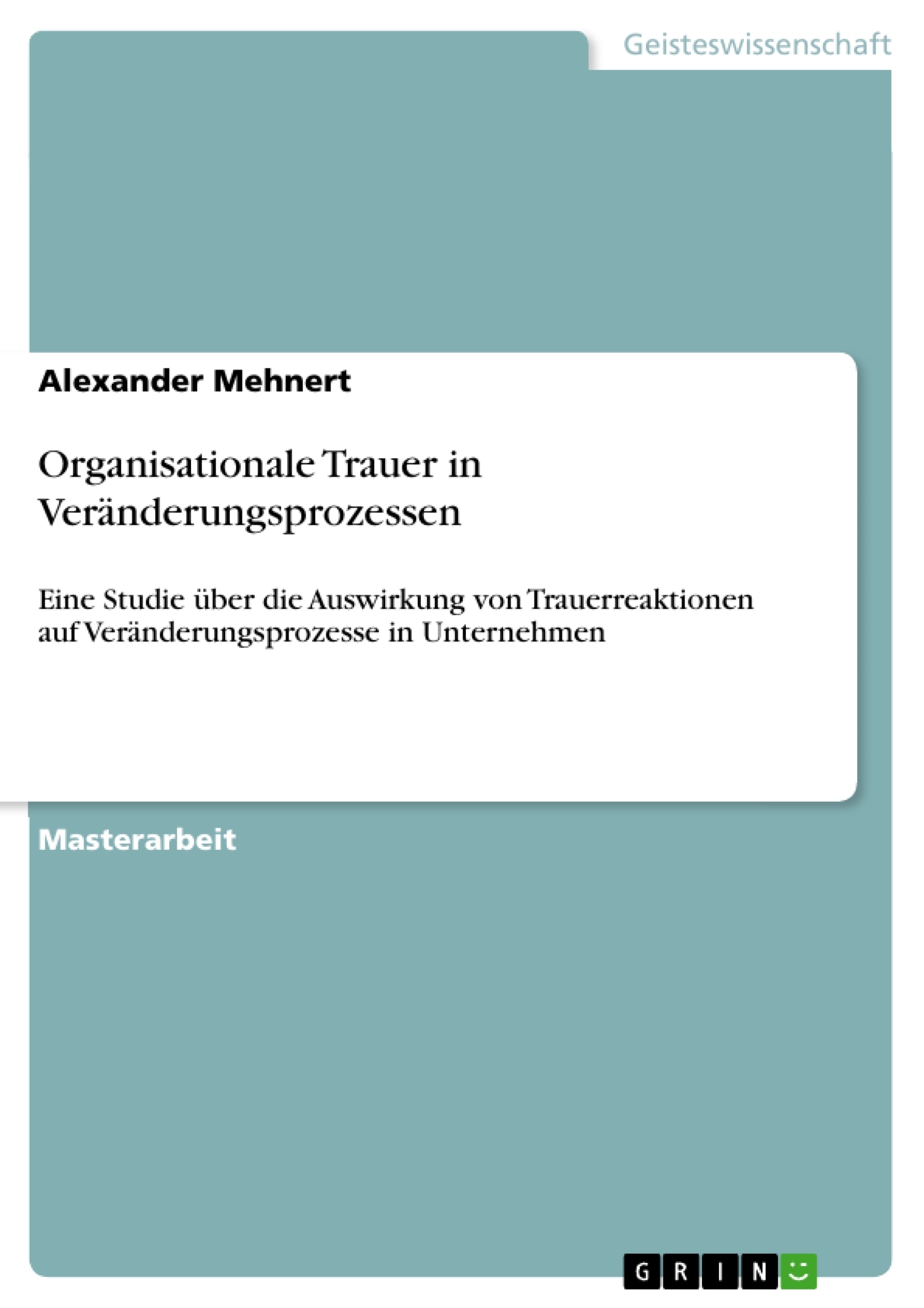Organisationen sind ständig im Wandel. Veränderungen in den Märkten machen eine regelmäßige Anpassung notwendig, wenn das Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben will. Die meisten Veränderungsprozesse misslingen jedoch, selbst wenn sie nach den Regeln des Change-Managements durchgeführt werden.
Diese Studie weist nach, dass es in Veränderungsprozessen zu den gleichen Trauersymptomen kommen kann, wie sie beim Verlust geliebter Menschen auftreten. Diese Trauerreaktionen können direkt den Erfolg von Veränderungsprozessen beeinflussen.
Das Modell der organisationalen Trauer führt das Change-Management und die Trauerforschung zusammen und setzt sie in den Rahmen von Beziehungen im Unternehmen. Es zeigt auf, wie stark Veränderungsprozessgestaltung und Trauerarbeit aufeinander angewiesen sind und zeigt Wege auf, Veränderungsprozesse unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse erfolgreich zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Theoretischer und empirischer Forschungsstand
- 2.1 Change Management
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Geschichte
- 2.1.3 Change-Management heute
- 2.1.4 Woran Veränderungen scheitern
- 2.1.5 Zusammenfassung
- 2.2 Individuelle Trauer
- 2.2.1 Was ist Trauer? Versuch einer Definition
- 2.2.2 Forschungsstand in der Trauerarbeit
- 2.2.2.1 Biologischer Zugang
- 2.2.2.2 Phasentheoretische Ansätze
- 2.2.2.3 Coping-Ansätze
- 2.2.3 Trauersymptome
- 2.2.4 Normale und komplizierte Trauer
- 2.2.5 Soziale Trauer
- 2.2.6 Trauerarbeit und Krisenintervention - Eine Abgrenzung
- 2.2.6.1 Geschichte der Krisenintervention
- 2.2.6.2 Krisenintervention heute
- 2.2.6.3 Unterschiede zwischen Trauerarbeit und Krisenintervention
- 2.2.7 Zusammenfassung
- 2.1 Change Management
- 3. Konzept der organisationalen Trauer
- 4. Fragestellungen und Hypothesen
- 5. Methode
- 5.1 Untersuchungsdesign
- 5.2 Instrumente
- 5.3 Stichprobenkonstruktion und Untersuchungsdurchführung
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Stichprobenbeschreibung
- 6.1.1 Demografie
- 6.1.2 Veränderung
- 6.1.3 Trauer
- 6.2 Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen und Hypothesen
- 6.3 Weitere Befunde
- 6.1 Stichprobenbeschreibung
- 7. Diskussion
- 7.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- 7.2 Organisationale Trauer - Beurteilung des Modells
- 7.3 Einschränkungen der Studie
- 7.4 Handlungsempfehlungen zur Gestaltung von Veränderungen
- 7.4.1 Maßnahmen zur Vorbereitung einer Veränderung
- 7.4.1.1 Change-Management
- 7.4.1.2 Trauerarbeit
- 7.4.2 Maßnahmen während einer Veränderung
- 7.4.2.1 Change-Management
- 7.4.2.2 Trauerarbeit
- 7.4.3 Tabellarische Übersicht
- 7.4.1 Maßnahmen zur Vorbereitung einer Veränderung
- 8. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Trauerreaktionen auf Veränderungsprozesse in Unternehmen. Ziel ist es, ein Modell der organisationalen Trauer zu entwickeln und aufzuzeigen, wie Change-Management und Trauerarbeit miteinander verknüpft sind, um erfolgreiche Veränderungsprozesse zu gestalten.
- Organisationale Trauer als Reaktion auf Veränderungen
- Zusammenhang zwischen Change-Management und Trauerprozessen
- Einfluss sozialer Faktoren auf die Verarbeitung organisationaler Trauer
- Entwicklung eines Modells zur Bewältigung organisationaler Trauer in Veränderungsprozessen
- Handlungsempfehlungen für die Gestaltung erfolgreicher Veränderungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der organisationalen Trauer in Veränderungsprozessen ein. Es wird die Problematik des häufigen Scheiterns von Veränderungsprozessen trotz Anwendung von Change-Management-Methoden aufgezeigt und die zentrale These der Studie vorgestellt: Die Parallelen zwischen individueller Trauer und den Reaktionen auf organisationale Veränderungen. Das Kapitel skizziert den Aufbau der Arbeit und formuliert die Forschungsfrage.
2. Theoretischer und empirischer Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert den aktuellen Stand der Forschung zu Change Management und individueller Trauer. Es werden verschiedene Ansätze des Change Managements, ihre Stärken und Schwächen sowie typische Fehlerquellen analysiert. Im Bereich der Trauerforschung werden Definitionen, Phasentheorien, Coping-Strategien und die Unterscheidung zwischen normaler und komplizierter Trauer ausführlich dargestellt. Der Abschnitt zu Krisenintervention beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Trauerarbeit und liefert den theoretischen Hintergrund für das Verständnis organisationaler Trauer.
3. Konzept der organisationalen Trauer: Aufbauend auf den Ergebnissen des zweiten Kapitels wird in diesem Kapitel das zentrale Konzept der organisationalen Trauer entwickelt. Es werden die Parallelen zwischen den Trauerreaktionen auf den Verlust geliebter Menschen und die Reaktionen auf organisationale Veränderungen herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Prozesse und Symptome der organisationalen Trauer und ihrer Auswirkungen auf das Unternehmen.
4. Fragestellungen und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die Forschungsfragen und Hypothesen der Studie, die auf Basis des theoretischen Rahmens entwickelt wurden. Die Fragen zielen darauf ab, den Zusammenhang zwischen organisationaler Trauer und dem Erfolg von Veränderungsprozessen zu untersuchen und die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen zur Bewältigung der Trauer zu prüfen.
5. Methode: Das Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden das Untersuchungsdesign, die verwendeten Instrumente (z.B. Fragebögen), die Stichprobenkonstruktion und die Durchführung der Studie detailliert dargestellt. Die Wahl der Methoden wird begründet und die Validität und Reliabilität der eingesetzten Instrumente wird diskutiert.
6. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse zur Stichprobenbeschreibung, die Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen und Hypothesen und weitere, unerwartete Befunde werden umfassend und detailliert beschrieben. Statistische Analysen und relevante Grafiken werden verwendet, um die Ergebnisse zu visualisieren und zu interpretieren.
7. Diskussion: Das Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Studie im Kontext des theoretischen Rahmens. Die Ergebnisse werden diskutiert und im Hinblick auf die Forschungsfragen und Hypothesen bewertet. Die Stärken und Schwächen der Studie werden kritisch reflektiert und mögliche Einschränkungen werden thematisiert. Es werden Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Veränderungsprozessen unter Berücksichtigung der Ergebnisse abgeleitet.
Schlüsselwörter
Organisationale Trauer; Change Management; Veränderungsprozesse; Trauerarbeit; Krisenintervention; Unternehmen; Mitarbeiter; soziale Faktoren; Erfolg; Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Organisationale Trauer in Veränderungsprozessen
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die Auswirkungen von Trauerreaktionen auf Veränderungsprozesse in Unternehmen. Sie konzentriert sich auf die Parallelen zwischen individueller Trauer und den Reaktionen auf organisationale Veränderungen und zielt darauf ab, ein Modell der organisationalen Trauer zu entwickeln.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt die folgenden zentralen Themen: Organisationale Trauer als Reaktion auf Veränderungen, den Zusammenhang zwischen Change-Management und Trauerprozessen, den Einfluss sozialer Faktoren auf die Verarbeitung organisationaler Trauer, die Entwicklung eines Modells zur Bewältigung organisationaler Trauer in Veränderungsprozessen und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung erfolgreicher Veränderungsprozesse.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie gliedert sich in acht Kapitel: Einführung, Theoretischer und empirischer Forschungsstand (inkl. Change Management und individueller Trauer), Konzept der organisationalen Trauer, Fragestellungen und Hypothesen, Methode (inkl. Untersuchungsdesign, Instrumente und Stichprobenkonstruktion), Ergebnisse (inkl. Stichprobenbeschreibung und Analyse der Fragestellungen), Diskussion (inkl. Interpretation der Ergebnisse, Einschränkungen und Handlungsempfehlungen) und Zusammenfassung und Ausblick.
Was sind die zentralen Forschungsfragen und Hypothesen?
Die Forschungsfragen und Hypothesen zielen darauf ab, den Zusammenhang zwischen organisationaler Trauer und dem Erfolg von Veränderungsprozessen zu untersuchen und die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen zur Bewältigung der Trauer zu prüfen. Konkrete Fragen und Hypothesen werden im Kapitel 4 detailliert dargestellt.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine empirische Untersuchungsmethode. Kapitel 5 beschreibt detailliert das Untersuchungsdesign, die eingesetzten Instrumente (z.B. Fragebögen), die Stichprobenkonstruktion und die Durchführung der Studie. Die Validität und Reliabilität der eingesetzten Instrumente wird diskutiert.
Welche Ergebnisse liefert die Studie?
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, inklusive Stichprobenbeschreibung, Ergebnisse zu den einzelnen Fragestellungen und Hypothesen sowie weitere Befunde. Statistische Analysen und Grafiken visualisieren und interpretieren die Ergebnisse.
Welche Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen werden gezogen?
Kapitel 7 interpretiert die Ergebnisse und bewertet sie im Kontext des theoretischen Rahmens. Es werden die Stärken und Schwächen der Studie kritisch reflektiert, mögliche Einschränkungen thematisiert und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung von Veränderungsprozessen unter Berücksichtigung der Ergebnisse abgeleitet, insbesondere Maßnahmen zur Vorbereitung und während einer Veränderung, unter Berücksichtigung von Change-Management und Trauerarbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Organisationale Trauer; Change Management; Veränderungsprozesse; Trauerarbeit; Krisenintervention; Unternehmen; Mitarbeiter; soziale Faktoren; Erfolg; Handlungsempfehlungen.
Wie ist der Aufbau der Studie strukturiert?
Die Studie beginnt mit einer Einführung und einem Überblick über den theoretischen und empirischen Forschungsstand zu Change Management und individueller Trauer. Anschließend wird das Konzept der organisationalen Trauer entwickelt, bevor die Forschungsfragen und Hypothesen formuliert werden. Die Methodik, die Ergebnisse, die Diskussion und der Ausblick runden die Arbeit ab.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel der Studie. Die Zusammenfassung der Kapitel liefert eine prägnante Übersicht über die Inhalte jedes Kapitels.
- Quote paper
- Alexander Mehnert (Author), 2015, Organisationale Trauer in Veränderungsprozessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307132