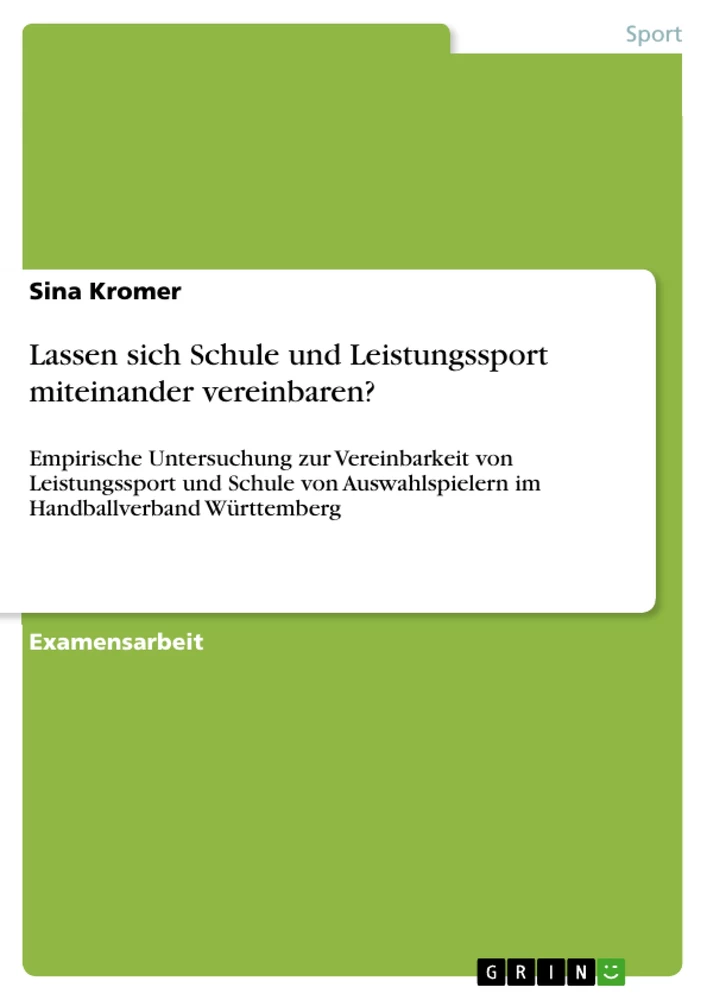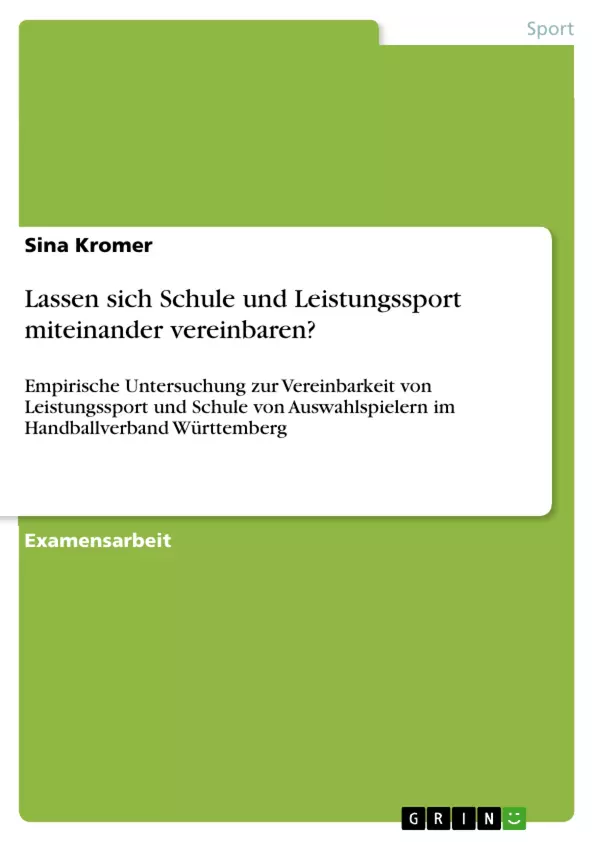Früh wird mit talentierten Sportlern begonnen systematisch zu trainieren, um sie langfristig und vor allem systematisch auszubilden und auf die zukünftigen Belastungen im Spitzenbereich vorzubereiten. Anhand der unterschiedlichen sportartspezifischen Rahmentrainingskonzeptionen (RTK) wird deutlich, dass der langfristige Leistungsaufbau von Spitzenleistungen in unterschiedlichen Sportarten im Kindesalter nicht zeitgleich beginnt und die Anforderungen im Nachwuchstraining bis hin zum Spitzenleistungsalter sportartspezifisch differieren. Dennoch sind die einzelnen Ausbildungsstufen zur systematischen altersgerechten Entwicklung von Leistungsvoraussetzungen und Leistungen mit dem Grundlagentraining, Aufbautraining, Anschlusstraining und Hochleistungstraining die gleichen (Schnabel et al., 2011).
Dadurch, dass durch Sichtungsmaßnahmen des Dachverbandes der Einstieg ins Nachwuchsleistungstraining formell beginnt und eine systematische allgemeine, sowie sportart-spezifische Ausbildung der Nachwuchsleistungssportler im Jugend- bzw. jungendlichen Erwachsenenalter beginnt, treten besondere Herausforderungen an die Ausbildung heran. Das Besondere in dieser Ausbildungsphase ist, dass die Sportler mit dem Absolvieren der Schullaufbahn einer weiteren - und wohl auch konkurrierenden - Leistungsanforderung ausgesetzt sind (Nordrhein-Westfalen, 2014). Über diesen langen Zeitraum der Parallelität schulischer und nachwuchssportlicher Ausbildungszeiträume, muss die Effizienz des Trainings, aber auch die individuelle Persönlichkeitsentwicklung hochgehalten werden, um die gesetzten Ziele zu realisieren. Zur Sicherung des sportlichen Leistungsfortschritts und der schulischen Ausbildung sind deshalb individuelle Hilfen erforderlich. Hier muss zuzüglich angemerkt werden, dass nicht nur die Herausforderung im Zusammenspiel dieser beiden Karrieren mit zunehmenden Alter ansteigt, sondern auch die jeweils einzelnen Anforderungen sowohl im sportlichen Bereich (Trainingsumfänge, siehe dazu Brand et al., 2009), als auch im schulischen Bereich wachsen.
Als ein zentrales unterstützendes Element innerhalb dieses Prozesses werden „sportbetonte Schulen“ angesehen, die die Bedürfnisse der Sportler berücksichtigen sollen (siehe dazu Brettschneider & Klimek, 1998). Durch sie soll der Einklang zwischen Schule und Sport hergestellt werden, sodass die Ausbildung sinnvoll miteinander koordiniert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kennzeichnung der Problematik
- Zielstellung der Arbeit
- Struktur der Arbeit
- Theoretische Vorbetrachtung
- Sportliches Training
- Definition des sportlichen Trainings
- Ziel und Aufgaben des sportlichen Trainings
- Trainingsumfänge
- Trainingsalter
- Talente im Sport
- Definition „sportliches Talent“
- Kriterien von sportlichen Talenten
- Konzepte zur Förderung von Schule und Sport in Deutschland
- Verbundsysteme von Schule und Leistungssport
- Kooperationsmodelle von Schule und Sport
- Die geschichtliche Entwicklung der Verbundsysteme
- Kinder- und Jugendsportschulen der DDR
- Partnerschulen des Leistungssports/ Sportbetonte Schulen
- Eliteschule des Sports- aktuellste Entwicklungsform des Verbundsystems „Schule- Leistungssport“
- Sportinternate
- Schule und Sport in Baden-Württemberg
- Schulsystem in Baden-Württemberg
- Strukturen zur Förderung von Leistungssport in Baden-Württemberg
- Regionalkonzept Baden-Württemberg
- Umfang der schulischen Anforderungen und Trainingsanforderungen im Leistungssport
- Allgemeine und spezielle Fragestellung
- Methodik
- Stichprobe
- Material und Methoden
- Untersuchungsablauf
- Statistische Bearbeitung
- Ergebnisse
- Charakteristik der untersuchten Spieler und Spielerinnen
- Trainingsaufwand der untersuchten Spieler und Spielerinnen
- Nettotrainingszeiten
- Bruttotrainingszeiten
- Zusätzliche Sportarten
- Kooperation zwischen Schule und Sport
- Priorisieren von Handball zu Ungunsten der Schule
- Nachhilfe als Unterstützungsleistungen
- Notwendigkeit von weiteren Unterstützungsleistungen – Internat
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Vereinbarkeit von Leistungssport und Schule am Beispiel von Auswahlspielern im Handballverband Württemberg. Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Vereinbarkeit von sportlichem Training und schulischen Anforderungen zu untersuchen.
- Analyse der Trainingsbelastung und schulischen Anforderungen von Handballtalenten
- Untersuchung der Kooperation zwischen Schule und Sport im Handballverband Württemberg
- Bewertung der Unterstützungsleistungen, die Handballtalenten zur Verfügung stehen
- Diskussion der Möglichkeiten und Herausforderungen der Vereinbarkeit von Leistungssport und Schule
- Entwicklung von Empfehlungen zur Optimierung der Vereinbarkeit von Leistungssport und Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Vereinbarkeit von Leistungssport und Schule ein und beschreibt die Problematik, die Zielsetzung und die Struktur der Arbeit. Die theoretische Vorbetrachtung beleuchtet die Konzepte des sportlichen Trainings, die Definition von Talenten im Sport und die verschiedenen Fördermodelle von Schule und Sport in Deutschland, insbesondere in Baden-Württemberg. Die Methodik beschreibt die Stichprobe, das Material, die Methoden und den statistischen Ablauf der Untersuchung. In den Ergebnissen werden die Trainingsbelastung, die schulischen Anforderungen und die Kooperation zwischen Schule und Sport der untersuchten Handballtalente analysiert. Die Zusammenfassung und das Fazit fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen und geben Empfehlungen zur Optimierung der Vereinbarkeit von Leistungssport und Schule.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenbereiche Leistungssport, Schule, Vereinbarkeit, Handball, Training, Talentförderung, Kooperation, Baden-Württemberg und Unterstützungsleistungen.
- Quote paper
- Sina Kromer (Author), 2014, Lassen sich Schule und Leistungssport miteinander vereinbaren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307167