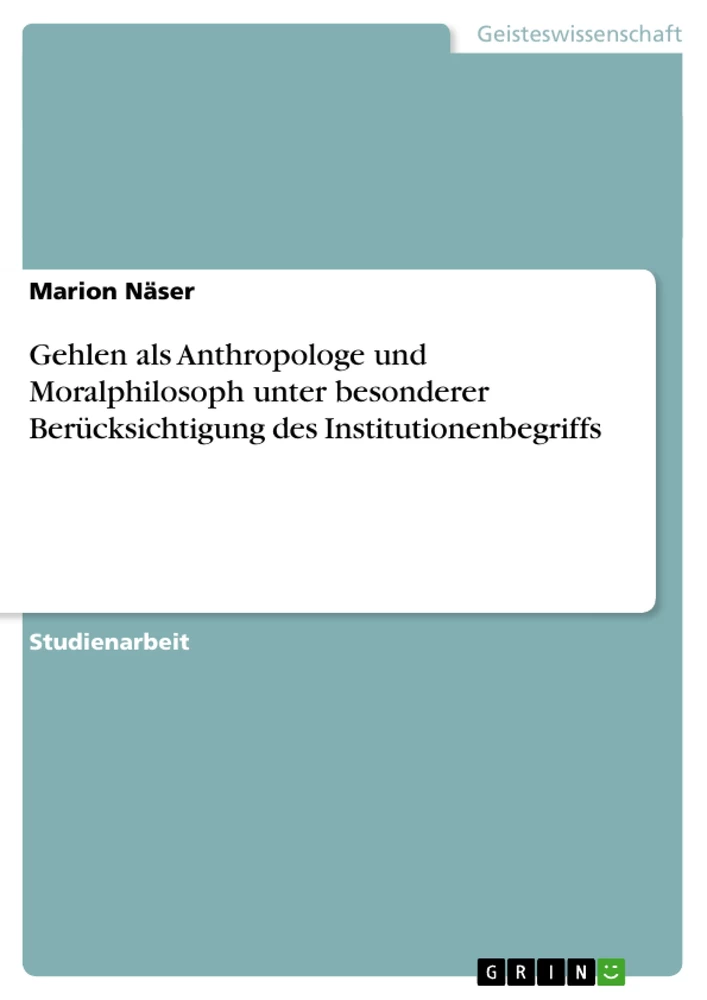Neben Scheler und Plessner war Arnold Gehlen (1904 – 1976) einer der bedeutendsten Anthropologen
des 20. Jahrhunderts.
Thema meiner Arbeit ist eine umfassende Diskussion und Kritik der Gehlenschen Konzeption.
Ich werde zuerst auf Gehlens Anthropologie, danach auf seine Institutionenlehre und zum
Schluß auf die Moralphilosophie eingehen, wobei einem deskriptiven Teil jeweils eine Erörterung
verschiedener Kernpunkte aus diesen Bereichen folgt.
Die Auswahl der betrachteten Problemkomplexe erfolgte danach, welche der Thesen meines
Erachtens am meisten kontroverse Fragen aufwerfen und am ehesten einer konsequenten Analyse
und Aufzeigung ihrer impliziten Konsequenzen bedürfen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Mensch
- 1.1 Anthropogenese und Anthropina
- 1.2 Kritik der Gehlenschen Anthropologie
- 1.2.1 Mensch und Instinkte
- 1.2.2 Gehlen und der Evolutionismus
- 1.2.3 Die Mängelwesen-Theorie
- 1.2.4 Die Sonderstellung des Menschen
- 2. Die Institutionen
- 2.1 Bedeutung der Institutionen
- 2.1.1 Institutionen als mentale Ordnungsfunktion
- 2.1.2 Institutionen als Selbstschutz
- 2.1.3 Institutionen als Bedingung der Möglichkeit zum Handeln
- 2.1.4 Institutionen als Voraussetzung für Kultur
- 2.1.5 Institutionen als Wurzel der Ethik
- 2.2 Institutionen und historische Analyse: „Heading for Destruction“
- 2.3 Fragen des Institutionenbegriffs
- 2.3.1 Psychologische Probleme: Institutionen als Zwang
- 2.3.2 Institutionenwandel
- 2.3.3 Gefahren von Institutionalisierung
- 2.3.4 Sinn von Institutionen
- 2.3.5 Abschließende Diskussion: Institutionen und Rationalismus
- 2.1 Bedeutung der Institutionen
- 3. Moral
- 3.1 Gehlens ethische Konzeption
- 3.2 Kritik der Ethik
- 3.2.1 Aufteilung der Ethikbereiche
- 3.2.2 Verkürzung der Ethik
- 3.2.3 Das Problem der legitimierten Aggressivität
- 3.2.4 Widerlegung Gehlens innerhalb seiner ethischen Konzeption
- 3.3 Alternative zur pluralistischen Ethik
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Werk von Arnold Gehlen, einem prominenten Anthropologen des 20. Jahrhunderts, und untersucht seine Konzepte der Anthropologie, der Institutionenlehre und der Moralphilosophie kritisch. Die Arbeit widmet sich den zentralen Thesen Gehlens, die kontroverse Fragen aufwerfen und einer detaillierten Analyse bedürfen.
- Die Sonderstellung des Menschen als „Mängelwesen“
- Die Rolle von Institutionen als Kompensationsmechanismen für menschliche Mängel
- Die Kritik an Gehlens Instinktreduktionstheorie
- Die ethische Konzeption Gehlens und ihre Kritikpunkte
- Die Bedeutung von Kultur als zweite Natur des Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Arnold Gehlen als bedeutenden Anthropologen des 20. Jahrhunderts vor und erläutert das Ziel und den Aufbau der Arbeit.
- Der Mensch: Dieses Kapitel behandelt Gehlens Anthropologie, seine Kritik an der Metaphysik und der Abstammungslehre. Es untersucht die Sonderstellung des Menschen als „Mängelwesen“ und die Bedeutung von Kultur als Kompensationsmechanismus.
- Die Institutionen: Dieses Kapitel fokussiert auf Gehlens Institutionenlehre. Es analysiert die Bedeutung von Institutionen als Ordnungsfunktion, Selbstschutzmechanismus und Bedingung der Möglichkeit zum Handeln. Es stellt auch Fragen zum Institutionenbegriff und untersucht Probleme wie Zwang, Wandel und Gefahren der Institutionalisierung.
- Moral: Dieses Kapitel diskutiert Gehlens ethische Konzeption und beleuchtet Kritikpunkte an seiner Aufteilung der Ethikbereiche, der Verkürzung der Ethik und dem Problem der legitimierten Aggressivität. Es präsentiert alternative ethische Konzepte.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die den Fokus der Arbeit repräsentieren, sind: Anthropologie, Institutionenlehre, Moralphilosophie, Arnold Gehlen, Sonderstellung des Menschen, Mängelwesen, Kultur, Instinktreduktion, Ethik, Institutionen, Institutionalisierung, Handlung, Selbstschutz, mentale Ordnungsfunktion, Triebhypertrophie.
- Citar trabajo
- M.A. Marion Näser (Autor), 2004, Gehlen als Anthropologe und Moralphilosoph unter besonderer Berücksichtigung des Institutionenbegriffs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30721