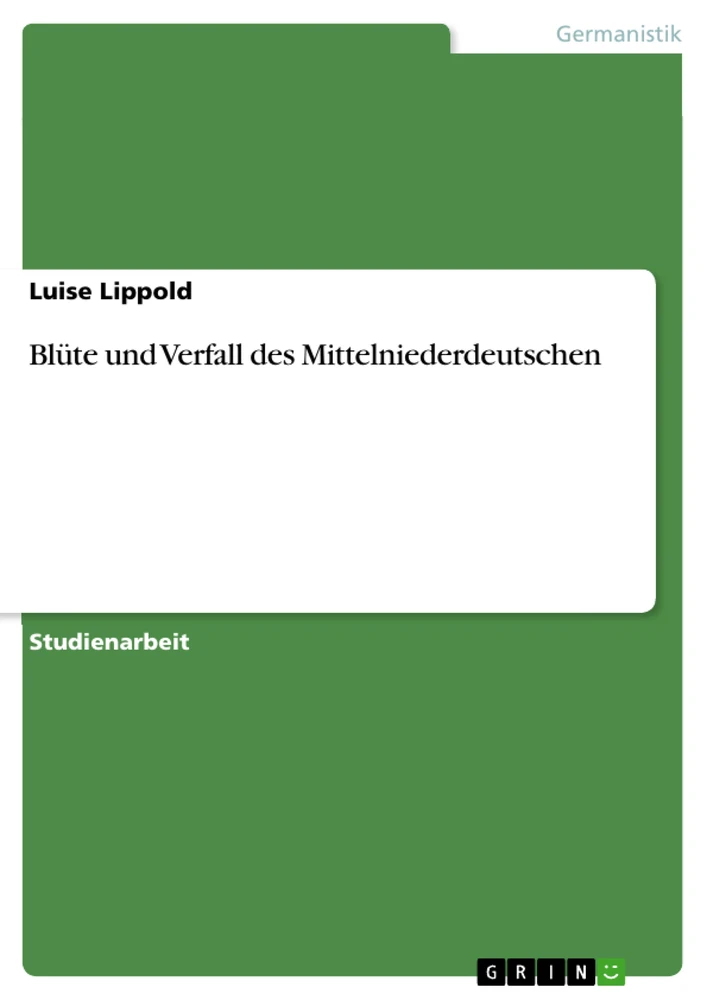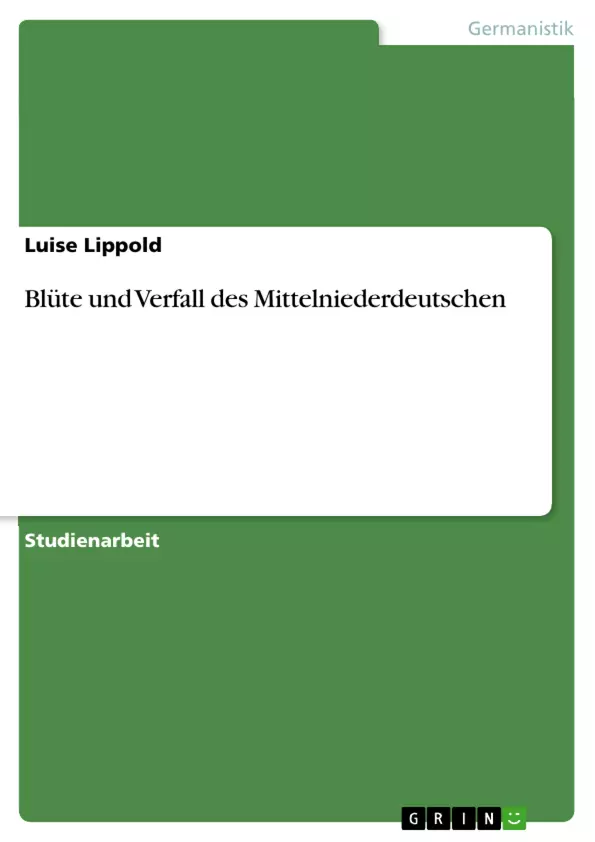Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Etappe des Mittelniederdeutschen in der niederdeutschen Sprachgeschichte genauer zu untersuchen. Dabei sollen zum einen sprachstrukturelle Entwicklungsbesonderheiten reflektiert werden und das Mittelniederdeutsche in seiner Funktion als Hanse-, Rechts-, und Kirchensprache analysiert werden. Betrachtet werden soll außerdem, wie die einst so weit verbreite Sprache mit dem Untergang der Hanse ein jähes Ende fand, bis sich ab 1850 schließlich neue Formen der schriftlichen Tradierung festigten.
Setzt man sich mit dem Niederdeutschen auseinander, lernt man eine ganz eigene Sprache kennen, die auf den ersten Blick unzählige Unterschiede zu unserer heutigen Sprache und dem Sprachgebrauch aufzeigt, auf den zweiten Blick jedoch ebenso Gemeinsamkeiten beinhaltet und Vergleiche zulässt. Die bewusste Auseinandersetzung mit dieser alten norddeutschen Sprache hat somit das große Potential, Mehrsprachigkeit auf eine andere Art und Weise erfahrbar zu machen. So kann man z.B. Schülerinnen und Schülern genannte Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Auseinandersetzung mit dem Niederdeutschen gleichzeitig nutzbar machen. Darüber hinaus liefert die niederdeutsche Sprache die wertvolle Möglichkeit, identitätsstiftende Momente zu schaffen.
Grundlage für die Kontextualisierung in der Bildungslandschaft ist das EU-Recht. Niederdeutsch wird dort als Regionalsprache und nicht als Dialekt definiert. Diese findet ihren Bezugsrahmen in der „Europäischen Charta für Regional-, und Minderheitssprachen“. Deutschland ist somit verpflichtet, Niederdeutsch als Minderheitensprache zu fördern und zu schützen.
Abschließend sollen im Rahmen dieser Arbeit die theoretischen Ergebnisse daher genutzt werden, um eine Brücke mit entsprechendem Praxisbezug in die Gegenwart zu schlagen und das Potential eines sprachgeschichtlichem Themas wie dem Niederdeutschen für Schülerinnen und Schüler darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Periodisierung des Niederdeutschen
- Mittelniederdeutsch
- Die Hansesprache
- Mittelniederdeutsch in der Kirche
- Mittelniederdeutsch zur Fixierung von Recht
- Übergang zum Neuniederdeutschen
- Exkurs: Niederdeutsch im Kontext der Bildungspolitik
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Etappe des Mittelniederdeutschen und analysiert dessen sprachstrukturelle Entwicklungsbesonderheiten sowie seine Rolle als Hanse-, Rechts- und Kirchensprache. Des Weiteren werden die Gründe für den Niedergang des Mittelniederdeutschen untersucht und die Entwicklung neuer Formen der schriftlichen Tradierung im 19. Jahrhundert beleuchtet. Die Arbeit möchte außerdem den Mehrwert des Niederdeutschen für die Bildungsarbeit und die Identitätsbildung in der heutigen Zeit aufzeigen.
- Sprachstrukturelle Entwicklungen des Mittelniederdeutschen
- Das Mittelniederdeutsche als Hanse-, Rechts- und Kirchensprache
- Der Niedergang des Mittelniederdeutschen und der Aufstieg des Hochdeutschen
- Das Potential des Niederdeutschen für die Bildungsarbeit und die Identitätsbildung
- Kontextualisierung des Niederdeutschen im Rahmen des EU-Rechts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Niederdeutschen Sprache und seine vielfältigen Mundarten vor. Sie beleuchtet die kontroverse Abgrenzung zwischen Dialekt und Sprache und erklärt den Ursprung des Begriffs „Plattdeutsch“. Außerdem wird die Bedeutung des Mittelniederdeutschen als Höhepunkt der niederdeutschen Sprachgeschichte hervorgehoben.
- Periodisierung des Niederdeutschen: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Niederdeutschen in einzelnen Etappen und beleuchtet die wichtigsten kulturellen, ökonomischen und politischen Einflüsse. Die Epochen des Alt-, Mittel-, und Neuniederdeutschen werden anhand ihrer zeitlichen Abgrenzung und spezifischen sprachlichen Merkmale dargestellt.
- Mittelniederdeutsch: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Funktionen des Mittelniederdeutschen. Die Bedeutung der Sprache als Hanse-, Rechts- und Kirchensprache wird detailliert erläutert. Die sprachstrukturellen Besonderheiten des Mittelniederdeutschen werden ebenfalls betrachtet.
- Übergang zum Neuniederdeutschen: Dieses Kapitel analysiert den Niedergang des Mittelniederdeutschen, der mit dem Untergang der Hanse einsetzte. Es werden die Ursachen für den Rückgang des Niederdeutschen und die Entstehung neuer Formen der schriftlichen Überlieferung im 19. Jahrhundert diskutiert.
- Exkurs: Niederdeutsch im Kontext der Bildungspolitik: Dieser Abschnitt beleuchtet das Niederdeutsche im Kontext der heutigen Bildungspolitik. Er betont die Bedeutung des Niederdeutschen als Regionalsprache und die Möglichkeiten, es in der Bildungsarbeit zu nutzen.
Schlüsselwörter
Niederdeutsche Sprachgeschichte, Mittelniederdeutsch, Hanse, Rechtssprache, Kirchensprache, Bildungspolitik, Mehrsprachigkeit, Identität, EU-Recht, Europäische Charta für Regional- und Minderheitssprachen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte das Mittelniederdeutsche in der Hanse?
Es war die Lingua Franca des nordeuropäischen Handelsraums und diente als verbindliche Verkehrs- und Korrespondenzsprache für Kaufleute.
Warum ging das Mittelniederdeutsche unter?
Mit dem wirtschaftlichen Niedergang der Hanse und dem Aufstieg des Hochdeutschen als Bildungs- und Kanzleisprache verlor es ab dem 16. Jahrhundert an Bedeutung.
Ist Niederdeutsch ein Dialekt oder eine Sprache?
Laut EU-Recht (Europäische Charta für Regional- oder Minderheitssprachen) wird Niederdeutsch als eigenständige Regionalsprache definiert.
Was bedeutet der Begriff „Plattdeutsch“?
„Platt“ bezieht sich ursprünglich auf die flache Landschaft Norddeutschlands oder auf eine „verständliche, klare“ Ausdrucksweise des einfachen Volkes.
Welches Potenzial hat Niederdeutsch heute in Schulen?
Es fördert die Mehrsprachigkeit, schafft identitätsstiftende Momente und ermöglicht Schülern einen direkten Zugang zur regionalen Geschichte.
- Quote paper
- Luise Lippold (Author), 2015, Blüte und Verfall des Mittelniederdeutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307211