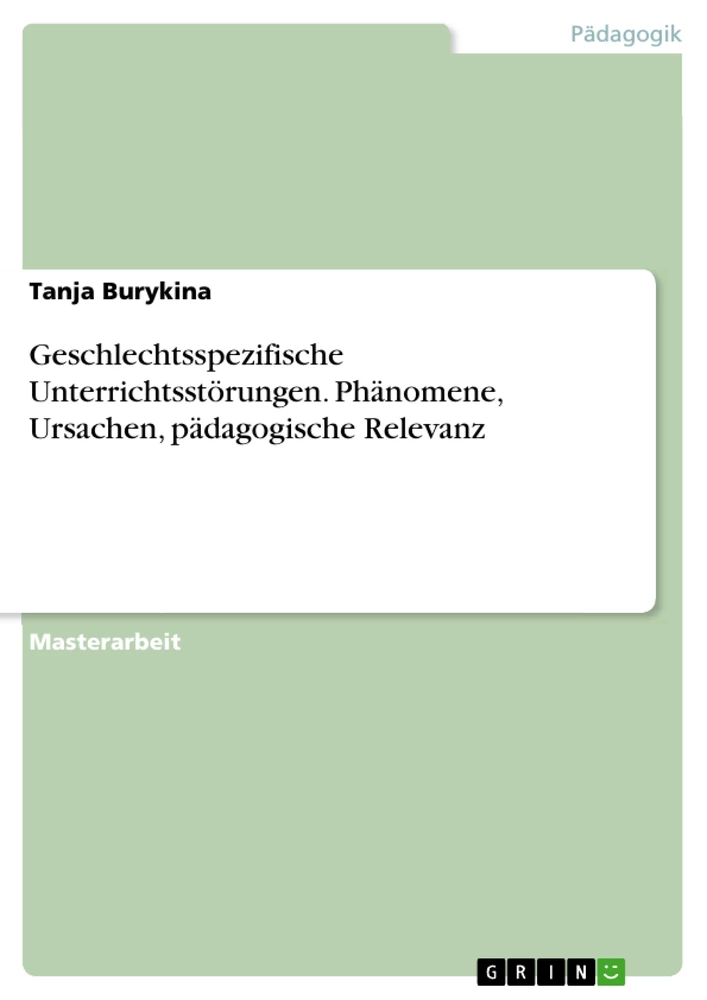Lehrerinnen und Lehrer sind in ihrem Arbeitsalltag immer wieder mit Unterrichtsstörungen konfrontiert, der Umgang mit ihnen macht somit einen wichtigen Teil der pädagogischen Arbeit aus.
Diverse Studienergebnisse zeigen dabei, dass es sowohl qualitative als auch quantitative Unterschiede im Störverhalten von Mädchen und Jungen gibt. Die vorliegende Arbeit widmet sich daher der Frage, inwiefern sich die jeweiligen sogenannten geschlechtsspezifischen Unterrichtsstörungen voneinander unterscheiden und wie das unterschiedliche Verhalten von Jungen und Mädchen aus soziologischer und sozialpsychologischer Sicht zu erklären ist.
Ziel ist es einerseits zu klären, wie Geschlecht in unserer Gesellschaft konstruiert wird und wie Geschlechterrollen sozial reproduziert werden. Andererseits soll geklärt werden, inwiefern diese geschlechtlichen Sozialisationsprozesse auch in der Schule stattfinden, wie Lehrkräfte daran mitwirken (doing gender) und wie Mädchen und Jungen ihr Geschlecht selbst inszenieren.
Hierzu werden zunächst verschiedene gängige Sozialisationstheorien vorgestellt und diskutiert, um diese dann auf die Erkenntnisse über Störverhalten von männlichen und weiblichen Schüler_innen anzuwenden. Anschließend wird die Rolle der Lehrperson konkreter besprochen, sowie die Auswirkungen von Rollenverhalten für Mädchen und Jungen dargestellt.
Es zeigt sich somit, dass Geschlecht auch in der Schule allgegenwärtig ist und bei vielen Interaktionen eine große Rolle spielt. Eine Schlussfolgerung ist, dass es auch beim Umgang mit Unterrichtsstörungen nicht genügt, die in der Fachliteratur empfohlenen allgemeinen Techniken der Reaktion und Prävention zu beherrschen. Vielmehr müssen Lehrkräfte auch Genderkompetenz mitbringen, um bestimmte Störsituationen analysieren, bewerten und adäquat auf diese regieren zu können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Sozialisation und Geschlecht
- 2.1 sex und gender
- 2.2 Sozialisationstheorien
- 2.2.1 Lerntheoretische Erklärungsansätze
- 2.2.1.1 Bekräftigungstheorie
- 2.2.1.2 Imitationstheorie
- 2.2.2 Kognitiver Erklärungsansatz
- 2.2.3 Sozialpsychologischer Erklärungsansatz
- 2.2.4 Zwischenfazit
- 2.3 doing gender
- 2.3.1 Inszenierung von Männlichkeit
- 2.3.2 Inszenierung von Weiblichkeit
- 2.4 Mediale Einflüsse
- 2.5 Geschlechterrollen
- 2.6 Geschlechterstereotype
- 3. Mädchen, Jungen, Unterrichtsstörungen
- 3.1 Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikte
- 3.2 Repräsentation in Fallbeispielen
- 3.3 Unterrichtsstörungen durch Jungen
- 3.4 Unterrichtsstörungen durch Mädchen
- 3.5 Schlussfolgerungen
- 4. Die Rolle der Lehrperson
- 4.1 Aufmerksamkeitsverteilung
- 4.2 gendering-Prozesse
- 4.3 Geschlecht der Lehrperson
- 5. Folgen
- 5.1 Selbstkonzepte
- 5.2 Schulische Leistungen
- 6. Genderkompetenz als Handlungsperspektive
- 6.1 Was ist Genderkompetenz?
- 6.2 Elemente von Genderkompetenz
- 6.3 Genderkompetenz und Unterrichtsstörungen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich das Störverhalten von Jungen und Mädchen unterscheidet und wie diese Unterschiede zu erklären sind. Darüber hinaus wird die Rolle der Lehrperson im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Unterrichtsstörungen untersucht. Die Arbeit soll Lehramtsstudierenden und Lehrer_innen dabei helfen, Unterrichtsstörungen aus einem Gender-Blickwinkel zu betrachten und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Sozialisationstheorien und ihre Anwendung auf geschlechtsspezifisches Verhalten
- Die Konstruktion von Geschlecht und die Reproduktion von Geschlechterrollen in der Schule
- Unterschiedliche Muster von Unterrichtsstörungen bei Jungen und Mädchen
- Die Bedeutung von Genderkompetenz im Umgang mit Unterrichtsstörungen
- Handlungsmöglichkeiten für Lehrer_innen im Umgang mit geschlechtsspezifischen Unterrichtsstörungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit ein und stellt die Relevanz der Untersuchung von geschlechtsspezifischen Unterrichtsstörungen heraus. Es wird der Fokus auf die Unterschiede im Störverhalten von Jungen und Mädchen gelegt und die Bedeutung der Genderperspektive in der pädagogischen Arbeit betont.
- Kapitel 2: Sozialisation und Geschlecht
Dieses Kapitel untersucht die sozialisationsbedingten Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede. Es werden die Begriffe „sex“ und „gender“ definiert und verschiedene Sozialisationstheorien vorgestellt und diskutiert. Der Begriff „doing gender“ wird erläutert und anhand von Beispielen die Inszenierung von Männlichkeit und Weiblichkeit verdeutlicht. Darüber hinaus werden Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype analysiert.
- Kapitel 3: Mädchen, Jungen, Unterrichtsstörungen
In diesem Kapitel werden Unterrichtsstörungen von Jungen und Mädchen näher betrachtet. Es wird definiert, was unter einer Unterrichtsstörung zu verstehen ist und Fallbeispiele für geschlechtsspezifische Störungen aus der Fachliteratur werden analysiert. Das Störverhalten von Jungen und Mädchen wird beschrieben und anhand der im ersten Kapitel vorgestellten Theorie ein Zwischenfazit gezogen.
- Kapitel 4: Die Rolle der Lehrperson
Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Lehrperson im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen und Geschlecht. Es wird die Bedeutung der Aufmerksamkeitsverteilung durch Lehrer_innen und die Rolle von gendering-Prozessen im Unterricht diskutiert. Zudem wird die Bedeutung des Geschlechts der Lehrperson im Zusammenhang mit Unterrichtsstörungen analysiert.
- Kapitel 5: Folgen
Dieses Kapitel analysiert die Folgen von geschlechtsspezifischen Unterrichtsstörungen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Selbstkonzepte und die schulischen Leistungen von Mädchen und Jungen.
- Kapitel 6: Genderkompetenz als Handlungsperspektive
Dieses Kapitel stellt Genderkompetenz als Handlungsperspektive für Lehrer_innen vor. Es wird definiert, was Genderkompetenz bedeutet und welche Elemente dazugehören. Der Zusammenhang zwischen Genderkompetenz und Unterrichtsstörungen wird beleuchtet und Handlungsmöglichkeiten für Lehrer_innen im Umgang mit geschlechtsspezifischen Unterrichtsstörungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Geschlechtsspezifische Unterrichtsstörungen, Gender, Sozialisation, doing gender, Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype, Lehrer_innenrolle, Genderkompetenz, Handlungsperspektive, Schulische Leistungen, Selbstkonzepte.
- Citation du texte
- Tanja Burykina (Auteur), 2014, Geschlechtsspezifische Unterrichtsstörungen. Phänomene, Ursachen, pädagogische Relevanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307298