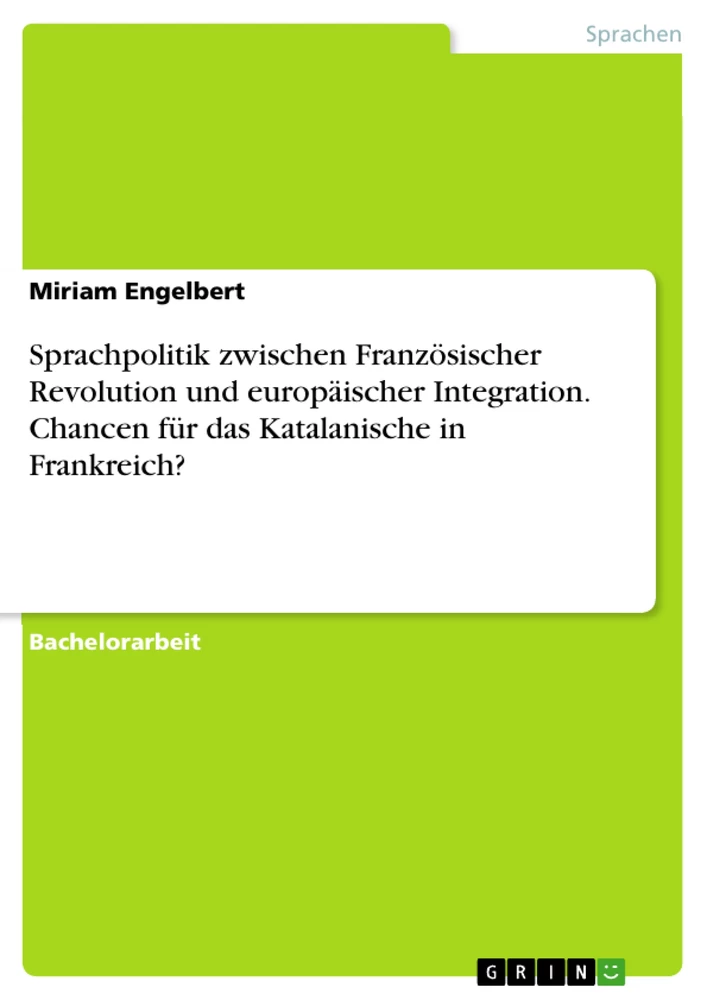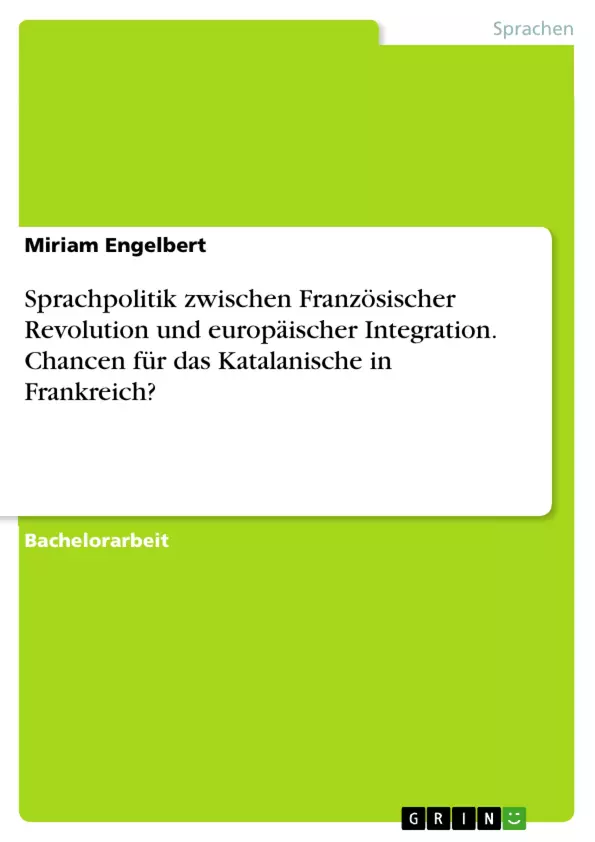Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, den Blick der Wissenschaft und der Politik auf die katalanische Sprachgemeinschaft im scheinbar monolinguistischen Frankreich zu werfen.
Des Weiteren sollen die Chancen für den Fortbestand des Katalanischen in Frankreich auch in Hinblick auf eine fortgeschrittene Globalisierung untersucht werden, die zweifelsohne sprachlich vom Englischen dominiert wird. Das Problem der Minderheiten- und Regionalsprachen, neben dem Katalanischen auch das Baskische, Okzitanische, etc., ist gerade in Frankreich untrennbar mit der spezifisch zentralstaatlichen Organisation der Institutionen verbunden – auch im Hinblick auf die Sprachpolitik. Sollte Frankreich also aus Angst vor der Hegemonialstellung des Englischen in der Welt seine Regionalsprachen verleumden, um eine einzige Nationalsprache als Vertreterin für alle im Land lebenden Sprecher zu proklamieren, um somit dem Englischen ein gestärktes und geeintes Französisch entgegenzusetzen? Oder liegen die Gründe für die Zurückhaltung in Bezug auf die Regional- und Minderheitensprachen im eigenen Land woanders? Geht man davon aus, dass vom französischen Staat keine Förderung der Minderheiten- und Regionalsprachen zu erwarten ist, so stellt sich außerdem die Frage, inwieweit diese Sprachen in Frankreich fortbestehen können. Ist ein Überleben des Katalanischen also nur dadurch gewährleistet, dass im Nachbarland Spanien die Regionalsprache zumindest in der Autonomen Region Katalonien offiziellen Status genießt und von der Sprechergemeinschaft aktiv gefördert wird? Oder gibt es Anzeichen dafür, dass auch auf französischer Seite das Katalanische mittlerweile gefördert wird und sich die Regionalsprachen im französischen Nationalstaat letztendlich doch institutionalisiert haben? Diese Fragen gilt es im Verlauf dieser Arbeit zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Verleumdete Vielfalt – Die Sprachenlandschaft Frankreichs
- 2.1 Das Katalanische - lengua puente zwischen den Extremen
- 2.1.1 Ein kurzer Überblick über die Geschichte des catalá
- 2.1.2 Das katalanische Sprachgebiet heute
- 3.0 Geschichte der französischen Sprachgesetzgebung – ein Abriss
- 4.0 Französische Sprachpolitik heute
- 4.1 Frankreichs Sprachgesetze des 20. und 21. Jahrhunderts
- 4.1.1 Der Staat greift ein: Loi relative à l'emploi de la langue française
- 4.1.2 Der Umgang Frankreichs mit den Regionalsprachen: Loi Deixonne und Circulaire Savary
- 5.0 Neue Hoffnung für das Katalanische in Frankreich: Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
- 6.0 Das Nachbarland Spanien - ein Vorbild für Frankreich im Umgang mit den Regional- und Minderheitensprachen?
- 7.0 Die neue Akzeptanz: La politique du plurilinguisme en France
- 8.0 Das Katalanische aus Sicht seiner Sprecher -Zwischen Prestige, Vorurteilen und auto-odi
- 9.0 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit analysiert die Situation des Katalanischen in Frankreich, einer Region, die vom französischen Staat als einsprachig französisch betrachtet wird. Das Ziel ist es, zu verstehen, wie sich die französische Sprachpolitik auf das Überleben des Katalanischen auswirkt und welche Chancen es im Kontext der europäischen Integration und der Globalisierung hat.
- Die Geschichte und der aktuelle Status des Katalanischen in Frankreich
- Die französische Sprachpolitik und ihre Auswirkungen auf Regionalsprachen
- Die Rolle der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
- Der Vergleich mit der Sprachpolitik in Spanien und die mögliche Vorbildfunktion
- Die Bedeutung des Katalanischen für die Identität seiner Sprecher
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- 1.0 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz des Katalanischen in Frankreich im Kontext der europäischen Sprachpolitik dar.
- 2.0 Verleumdete Vielfalt – Die Sprachenlandschaft Frankreichs: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die Sprachenlandschaft Frankreichs, fokussiert auf die Situation des Katalanischen und dessen Geschichte.
- 3.0 Geschichte der französischen Sprachgesetzgebung – ein Abriss: Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung der französischen Sprachpolitik und deren Einfluss auf die Regionalsprachen.
- 4.0 Französische Sprachpolitik heute: Dieser Abschnitt untersucht die aktuelle französische Sprachpolitik, insbesondere die Gesetze, die den Umgang mit Regionalsprachen regeln.
- 5.0 Neue Hoffnung für das Katalanische in Frankreich: Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen: Dieser Abschnitt analysiert die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen und deren Bedeutung für das Katalanische in Frankreich.
- 6.0 Das Nachbarland Spanien - ein Vorbild für Frankreich im Umgang mit den Regional- und Minderheitensprachen?: Dieser Abschnitt vergleicht die Sprachpolitik in Spanien mit der in Frankreich und untersucht, ob Spanien ein Vorbild für Frankreich im Umgang mit Regionalsprachen sein könnte.
- 7.0 Die neue Akzeptanz: La politique du plurilinguisme en France: Dieser Abschnitt analysiert die Entwicklung einer neuen Akzeptanz für Mehrsprachigkeit in Frankreich und deren Auswirkungen auf das Katalanische.
- 8.0 Das Katalanische aus Sicht seiner Sprecher -Zwischen Prestige, Vorurteilen und auto-odi: Dieser Abschnitt beleuchtet die Perspektive der Katalanischsprachigen in Frankreich und deren Erfahrungen mit Prestige, Vorurteilen und dem Phänomen des "auto-odi".
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Katalanischen in Frankreich, der französischen Sprachpolitik, Regionalsprachen, Minderheitensprachen, Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, Mehrsprachigkeit, Identität, Sprachkontakt, Globalisierung und "auto-odi".
Häufig gestellte Fragen
Wie ist die aktuelle Situation des Katalanischen in Frankreich?
Das Katalanische wird in Frankreich als Regionalsprache in einem Umfeld betrachtet, das staatlich stark monolinguistisch französisch geprägt ist. Die Arbeit untersucht, ob die Sprache ohne aktive Förderung durch den französischen Staat überleben kann.
Welche Rolle spielt die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen?
Die Charta gilt als Hoffnungsschimmer für den Erhalt des Katalanischen in Frankreich, da sie einen rechtlichen Rahmen für den Schutz von Minderheitensprachen auf europäischer Ebene bietet.
Dient Spanien als Vorbild für die französische Sprachpolitik?
In Spanien genießt das Katalanische in der Autonomen Region Katalonien offiziellen Status. Die Arbeit vergleicht diesen aktiven Schutz mit der eher zurückhaltenden französischen Gesetzgebung.
Was bedeutet der Begriff "auto-odi" im Kontext dieser Arbeit?
"Auto-odi" bezeichnet den Selbsthass oder die Ablehnung der eigenen Sprache und Identität, die durch gesellschaftliche Vorurteile und mangelndes Prestige der Regionalsprache entstehen kann.
Welche Gesetze regeln den Umgang mit Sprachen in Frankreich?
Wichtige gesetzliche Grundlagen sind die "Loi relative à l'emploi de la langue française" (Loi Toubon) sowie spezifischere Regelungen wie die Loi Deixonne und die Circulaire Savary für Regionalsprachen.
Wie beeinflusst die Globalisierung das Katalanische?
Die Globalisierung führt zu einer Dominanz des Englischen, was den Druck auf kleinere Sprachen wie das Katalanische erhöht, sich neben der Nationalsprache Französisch zu behaupten.
- Quote paper
- Miriam Engelbert (Author), 2012, Sprachpolitik zwischen Französischer Revolution und europäischer Integration. Chancen für das Katalanische in Frankreich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307400