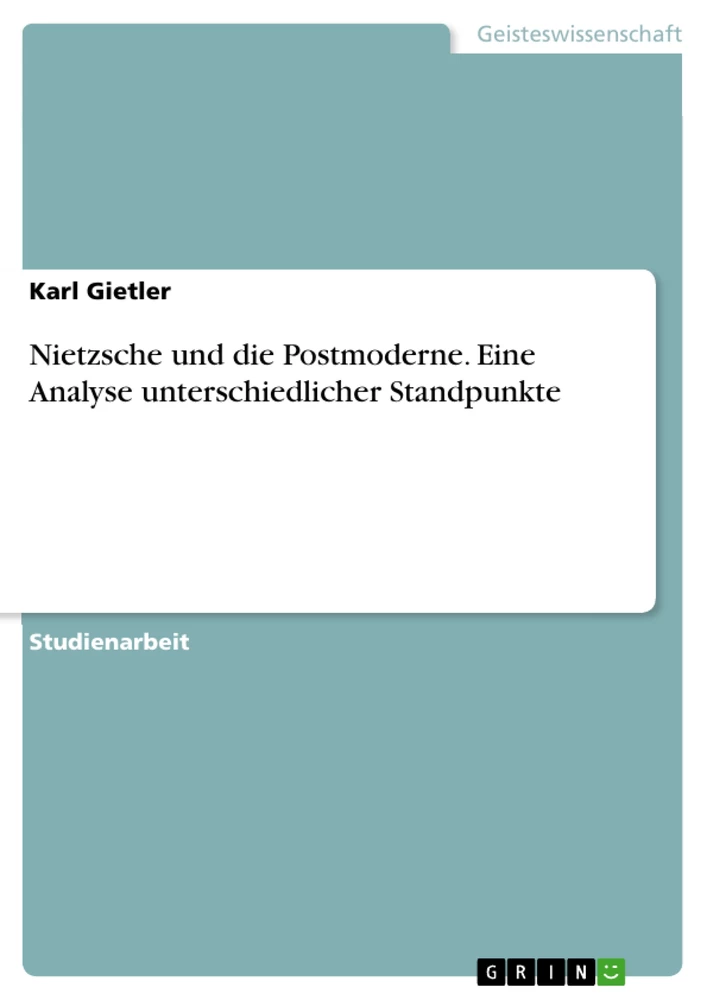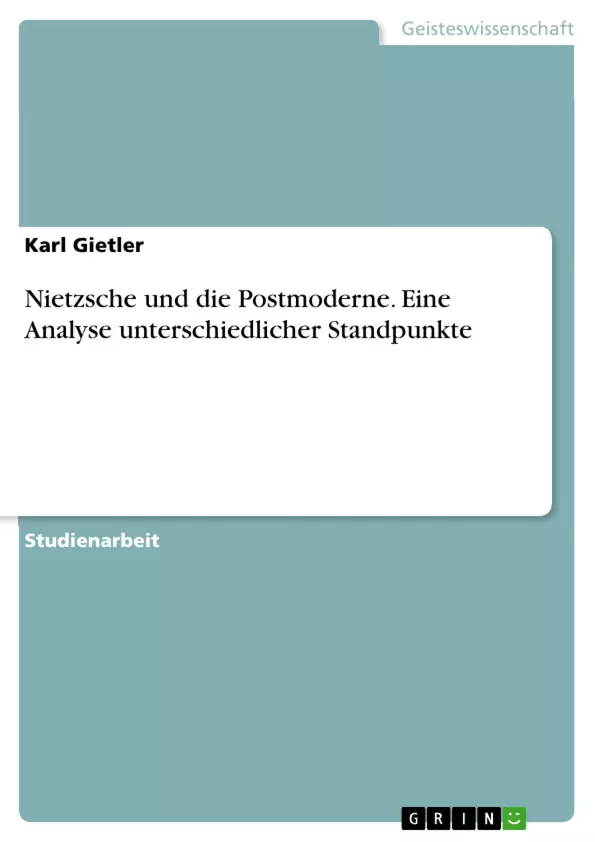Die vorliegende Arbeit analysiert Nietztsche im Zusammenhang der Postmoderne.
Hierbei werden Ansichten zu Nietzsche von den großen Philosophen der Postmoderne untersucht: Georges Bataille, Michel Foucault, Gilles Deleuze und Gianni Vattimos Standpunkte zu Nietzsche sind dargelegt.
Außerdem wird auf den Menschenpark, die Eugenik und Humangenetik, die Zukunftsmenschen, das Gewachsene und das Gemachte, den operablen Menschen sowie das Gen eingegangen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Georges Bataille
- Michel Foucault - das befreite Subjekt
- Gilles Deleuze - Das Viele und das Werden
- Gianni Vattimo - Jenseits vom Subjekt
- Der Menschenpark........
- Eugenik und Humangenetik.
- Zukunftsmenschen
- Das Gewachsene und das Gemachte
- Der operable Mensch....
- Das Gen.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rezeption des Philosophen Friedrich Nietzsche in der französischen Postmoderne. Sie zeigt auf, wie sich Nietzscheanische Gedanken in den Werken von Georges Bataille, Michel Foucault, Gilles Deleuze und Gianni Vattimo niederschlagen und wie diese Autoren, ausgehend von Nietzsche, neue philosophische und gesellschaftliche Konzepte entwickeln.
- Die Bedeutung von Heterogenität, Pluralismus, Begehren und Differenz
- Die Absage des Glaubens an eine unumstößliche Wahrheit
- Die Kritik an metaphysischen Systemen und deren Auswirkungen auf das Subjekt
- Die Praxis der Selbstsorge und Selbstbemeisterung
- Der Wille zur Macht und seine Ausprägung in verschiedenen Lebensbereichen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Georges Bataille: Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Nietzsche-Rezeption von Georges Bataille. Bataille interpretiert Nietzsche als einen Befürworter eines radikalen dionysischen Willens zur Macht, der sich in grenzüberschreitenden Erfahrungen und der Ablehnung bürgerlicher Normen zeigt. Batailles Konzept des neuen Menschen steht zwischen Mensch und Übermensch und zeichnet sich durch Freiheit und Souveränität aus.
- Michel Foucault - das befreite Subjekt: Der zweite Teil untersucht Michel Foucaults Nietzsche-Rezeption, wobei er die zentralen Themen des Dionysischen und der Macht beleuchtet. Foucault kritisiert metaphysische Systeme, die das Subjekt in Abhängigkeit bringen und die Freiheit einschränken. Seine späteren Arbeiten widmen sich der „Praxis des Selbst“ und der Selbstsorge als Mittel zur Selbstbefreiung und zur Herausbildung eines eigenen Ethos.
- Gilles Deleuze – Das Viele und das Werden: Im dritten Teil werden Foucaults und Deleuzes Nietzsche-Rezeptionen miteinander verglichen. Deleuze betont das Differentielle und die Prozesshaftigkeit der Wirklichkeit. Ähnlich wie Foucault kritisiert er die Philosophie der Indifferenz, die auf festen Werten beruht und den Einfluss von Zeit und Herkunft negiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit thematisiert zentrale Konzepte der französischen Postmoderne im Zusammenhang mit Nietzsche, wie Heterogenität, Pluralismus, Differenz, Wille zur Macht, Dionysisches, Freiheit, Selbstsorge, Selbstbemeisterung und die Kritik an metaphysischen Systemen. Sie beleuchtet die Werke wichtiger Denker der Postmoderne wie Georges Bataille, Michel Foucault und Gilles Deleuze und zeigt auf, wie diese Nietzsche interpretieren und seine Ideen weiterentwickeln.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Friedrich Nietzsche für die Postmoderne?
Nietzsche gilt als wichtiger Vorläufer. Seine Kritik an absoluten Wahrheiten und metaphysischen Systemen inspirierte Denker wie Foucault und Deleuze zu Konzepten von Differenz und Pluralismus.
Wie interpretierte Georges Bataille Nietzsche?
Bataille fokussierte sich auf den dionysischen Willen zur Macht und die Ablehnung bürgerlicher Normen, um ein Konzept des souveränen, freien Menschen zu entwickeln.
Was versteht Michel Foucault unter der „Praxis des Selbst“?
Inspiriert von Nietzsche, sieht Foucault darin die Möglichkeit des Individuums, sich durch Selbstsorge und die Gestaltung eines eigenen Ethos von staatlichen und gesellschaftlichen Machtstrukturen zu befreien.
Was betont Gilles Deleuze in seiner Nietzsche-Rezeption?
Deleuze betont das Werden, das Differentielle und die Prozesshaftigkeit der Wirklichkeit gegenüber festen, indifferenten Werten.
Was thematisiert der Abschnitt über den „Menschenpark“?
Hier geht es um moderne bioethische Fragen wie Eugenik und Humangenetik und die philosophische Unterscheidung zwischen dem „Gewachsenen“ und dem „Gemachten“ (operablen) Menschen.
- Quote paper
- Karl Gietler (Author), 2015, Nietzsche und die Postmoderne. Eine Analyse unterschiedlicher Standpunkte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307416