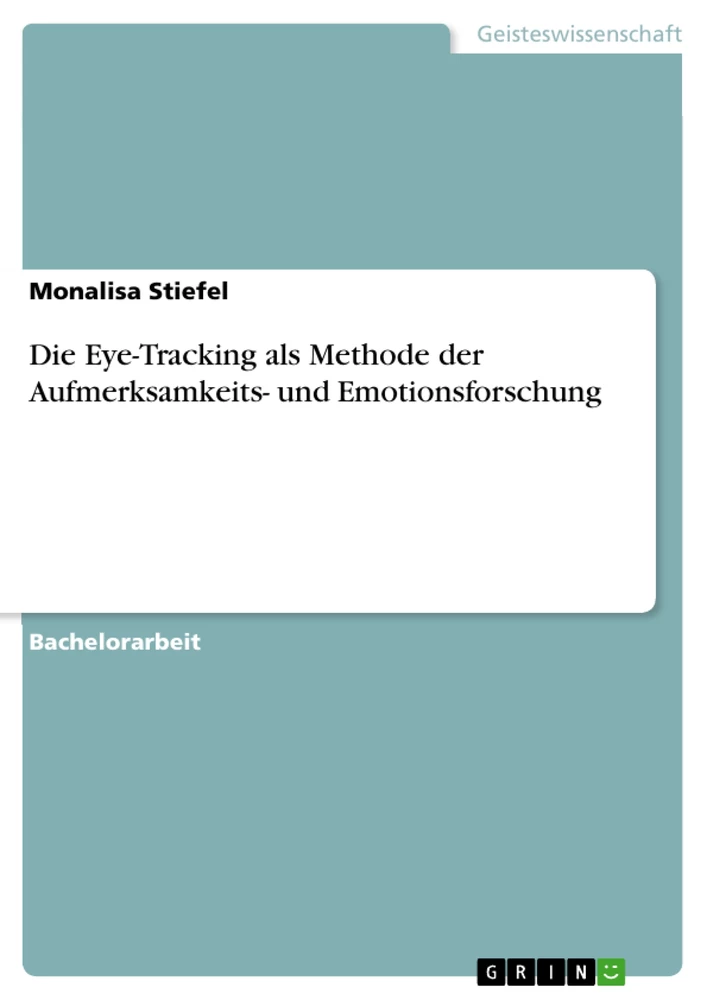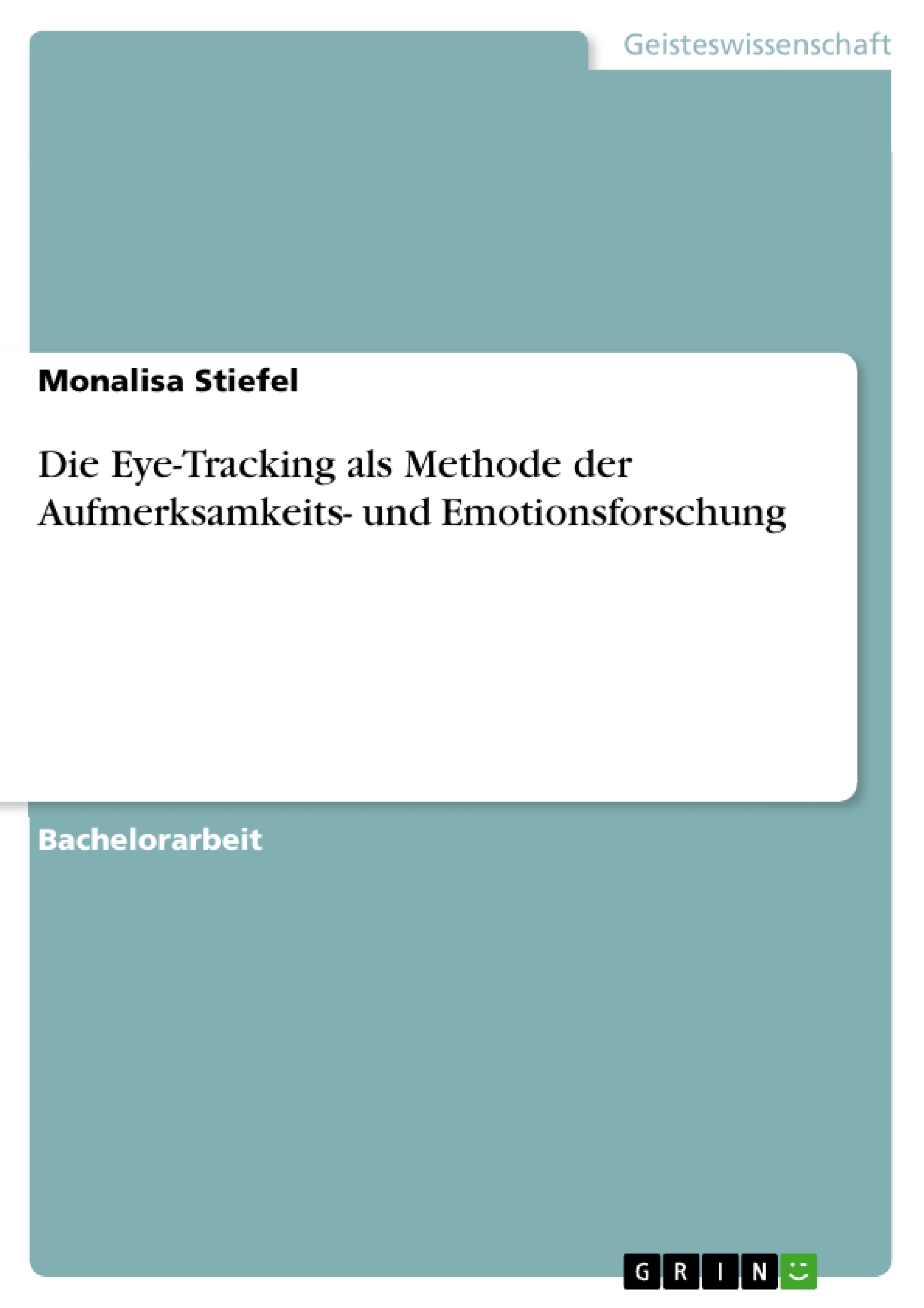Aufmerksamkeitsausrichtung und Emotionsregulation sind eng miteinander verbunden und nehmen gegenseitig Einfluss aufeinander. Mit modernen Eye-Tracking-Methoden lassen sich die verschiedenen Komponenten der Aufmerksamkeit direkt und kontinuierlich messen. In dieser Arbeit werden Befunde aus Eye-Tracking-Studien zu wechselseitigen Effekten der Aufmerksamkeitsausrichtung und der Emotionsregulation vorgestellt.
Die Befunde können in drei Bereiche gegliedert werden. Erstens wird untersucht, inwiefern für die depressive Störung eine verzerrte Aufmerksamkeitsausrichtung und eine dysfunktionale Emotionsregulation charakteristisch sind. Zweitens wird darauf eingegangen, wie man mit Meditation als Training in die Aufmerksamkeitsregulation eingreifen und die Kontrolle darüber erhöhen kann. Und als drittes interessiert, was die Ausprägung des Serotonin-Transporter-Gens 5-HHTLPR für einen Einfluss auf die Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation hat.
Insgesamt zeigen die besprochenen Befunde, dass Depressive Schwierigkeiten haben, ihren Blick von negativen Stimuli wegzulenken, wenn der Fokus einmal dort ist. Dies kann zu langanhaltend negativer Emotionsverarbeitung führen, was auch für maladaptive Emotionsregulationsstrategien typisch ist. Personen mit einer S- oder LG-Homozygotie des 5-HTTLPR-Gens scheinen eine erhöhte emotionale Sensitivität aufzuweisen und brauchen ebenfalls länger, ihre Aufmerksamkeit von negativer Information wegzulenken. Meditationstraining schliesslich führt zu erhöhter Kontrolle der Aufmerksamkeit, was die Weglenkung erleichtert. Vulnerabilität für Depression kann somit mit genetischen Komponenten assoziiert werden, mit Hilfe von Aufmerksamkeitstraining wie Meditation kann jedoch bewusst in dysfunktionale Aufmerksamkeits- und Emotionsregulationsmechanismen eingegriffen werden. Die Eye-Tracking-Methode gewährt dabei Einblick in kleinste behaviorale Ablaüfe und erlaubt exaktere Forschung als herkömmliche Methoden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Emotionale Reaktivität
- 2.2 Emotionsregulation
- 2.3 Eye-Tracking
- 3. Eye-Tracking-Befunde im Bereich der Aufmerksamkeits- und Emotionsforschung
- 3.1 Aufmerksamkeitsausrichtung und Emotionsregulation bei psychisch gesunden Menschen
- 3.2 Aufmerksamkeitsausrichtung und Emotionsregulation bei depressiven Menschen
- 3.3 Der Einfluss des Serotonin-Transporter-Gens 5-HTTLPR auf Aufmerksamkeit und emotionales Erleben
- 3.4 Meditation als Aufmerksamkeitstraining
- 4. Diskussion
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Aufmerksamkeit und Emotionen anhand von Befunden aus Eye-Tracking-Studien. Der Fokus liegt dabei auf den wechselseitigen Einflüssen der Aufmerksamkeitsausrichtung und der Emotionsregulation. Die Arbeit betrachtet dabei drei Bereiche: 1) die Rolle der Aufmerksamkeitsausrichtung bei der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Symptome, 2) den Einfluss des Serotonin-Transporter-Gens 5-HTTLPR auf die emotionale Sensitivität und die Aufmerksamkeitsausrichtung und 3) die Möglichkeiten der Meditation zur Verbesserung der Aufmerksamkeit und der Emotionsregulation.
- Aufmerksamkeitsausrichtung und Emotionsregulation im Kontext der depressiven Störung
- Der Einfluss des Serotonin-Transporter-Gens 5-HTTLPR auf emotionale Verarbeitung
- Die Rolle der Meditation als Aufmerksamkeitstraining
- Eye-Tracking als Methode zur Untersuchung der Aufmerksamkeitsausrichtung
- Zusammenhänge zwischen Aufmerksamkeit, Emotionen und genetischen Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in das Thema der Aufmerksamkeit und ihrer Beziehung zu Emotionen ein und stellt die Eye-Tracking-Methode als ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung dieser Prozesse vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der emotionalen Reaktivität und der Emotionsregulation sowie die Funktionsweise des Eye-Trackings. Das dritte Kapitel präsentiert Ergebnisse aus Eye-Tracking-Studien, die den Einfluss der Aufmerksamkeit auf die Emotionsregulation bei psychisch gesunden und depressiven Menschen untersuchen. Es wird zudem der Einfluss des 5-HTTLPR-Gens auf die emotionale Sensitivität und die Aufmerksamkeitsausrichtung betrachtet. Schliesslich wird im vierten Kapitel die Rolle der Meditation als Aufmerksamkeitstraining und die Auswirkungen auf die Emotionsregulation beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Eye-Tracking, Aufmerksamkeitsausrichtung, Emotionsregulation, Depression, 5-HTTLPR und Meditation. Sie untersucht, wie diese Faktoren miteinander verbunden sind und wie sie sich auf die Entstehung, Aufrechterhaltung und Regulation von Emotionen auswirken. Der Fokus liegt auf der Anwendung der Eye-Tracking-Methode zur Erforschung von Aufmerksamkeitsprozessen im Kontext von emotionalen Reaktionen und Störungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hilft Eye-Tracking in der Depressionsforschung?
Eye-Tracking zeigt, dass depressive Menschen Schwierigkeiten haben, ihren Blick von negativen Stimuli wegzulenken, was auf eine gestörte Emotionsregulation hinweist.
Welchen Einfluss hat das Gen 5-HTTLPR auf Emotionen?
Bestimmte Ausprägungen dieses Gens (S- oder LG-Homozygotie) führen zu einer erhöhten emotionalen Sensitivität und einer längeren Fixierung auf negative Informationen.
Kann Meditation die Aufmerksamkeit verbessern?
Ja, Meditationstraining erhöht die Kontrolle über die Aufmerksamkeitsregulation und erleichtert das bewusste Weglenken von belastenden Reizen.
Was sind die Vorteile von Eye-Tracking gegenüber herkömmlichen Methoden?
Eye-Tracking erlaubt die direkte und kontinuierliche Messung kleinster behavioraler Abläufe, was exaktere Daten liefert als subjektive Befragungen.
Hängt die Vulnerabilität für Depressionen mit den Genen zusammen?
Die Forschung deutet darauf hin, dass genetische Komponenten wie das Serotonin-Transporter-Gen die Anfälligkeit für Depressionen durch Beeinflussung der Aufmerksamkeitssteuerung erhöhen können.
- Citar trabajo
- Monalisa Stiefel (Autor), 2015, Die Eye-Tracking als Methode der Aufmerksamkeits- und Emotionsforschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307514